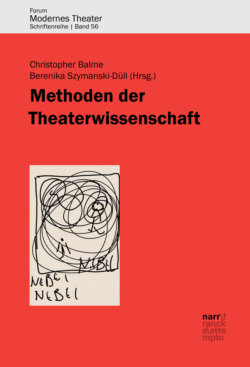Читать книгу Methoden der Theaterwissenschaft - Группа авторов - Страница 10
Sozialwissenschaftliche Ansätze
ОглавлениеDas Stichwort ‚Quantifizierung‘ führt die Theaterwissenschaft in die Nachbardisziplin der Sozialwissenschaften, wo quantitative und qualitative empirische Forschung das methodische Grundrüstzeug bilden. In den vier hier versammelten Beiträgen (Friedemann Kreuder, Thomas Renz, Mara Käser und Jonas Tinius) wird eine unübersehbare Öffnung der Theaterwissenschaft zu sozialwissenschaftlichen Methoden dokumentiert. Daran sieht man, dass die Theaterwissenschaft zunehmend die soziale und nicht nur die ästhetische Dimension des Theaterdispositivs als legitimen Forschungsgegenstand anerkennt. Dieses erneute Interesse hängt zweifelsohne mit der Wiederentdeckung des Publikums als Forschungsthema zusammen.1 Publikumsforschung setzt empirische Forschung voraus, wenn sie valide, überprüfbare Aussagen treffen will. Dieses Interesse führt Thomas Renz, in seinem Beitrag „Ansätze einer empirisch-quantitativen Theaterforschung“, zumindest teilweise auf das Aufkommen des Kulturmanagements seit den 2000er Jahren zurück. Deren Leitideologie der Betriebsoptimierung setzt fundierte Erkenntnisse über die ‚Kulturnutzer*innen‘, sprich Zuschauer*innen, voraus. Dieses Erkenntnisinteresse ließe sich allerdings teilweise von Marktforschung nicht unterscheiden. Dennoch gibt es eine zunehmende Zahl an Befragungen von Theaterbesucher*innen aber auch von Nichtbesucher*innen, die versuchen, demographische Daten und Präferenzen zu erheben. Davon kann die Theaterwissenschaft profitieren.2
Renz kritisiert zurecht, dass diese Form der Publikumsforschung selten qualitative Methoden zulässt. Jedoch ist für die aktuelle empirische Theaterforschung gerade die Verbindung von qualitativen und quantitativen Methoden kennzeichnend. In dieser Forschungspraxis werden quantitative Daten mit subjektiven Äußerungen ausgewählter Interviewpartner ‚trianguliert‘, d.h. kombiniert und abgeglichen. Dies wird auch als mixed methods approach bezeichnet. Für die qualitative Forschung hat sich das leitfadengestütze Experteninterview als bevorzugte Methode herausgestellt. ‚Expert*innen‘ können sowohl versierte Theaterzuschauer*innen als auch professionelle Theatermacher*innen (Intendant*innen, Dramaturg*innen, Regisseur*innen usw.) oder andere Stakeholder (Kulturpolitiker*innen) sein. Hier wird eine Reihe von definierten, aber offenen Fragen in einer Gesprächssituation gestellt. Erkenntnisleitend ist die Forschungsfrage der Untersuchung.3 Die Ergebnisse der Interviews werden in einem zweiten Schritt durch eine sogenannte ‚Inhaltsanalyse‘ abgeglichen und ausgewertet. Die Antworten werden nach Begriffen, Argumentationsfiguren, und programmatischen Statements abgesucht und geordnet. Hierdurch können diskursive Cluster gebildet werden, die eventuell über eine höhere und verbindlichere Aussagekraft als einzelne Äußerungen verfügen. Einen Einblick in diese qualitative Methode, die innerhalb der Theaterwissenschaft immer mehr Verbreitung findet, gibt uns im vorliegenden Band Mara Käser: Anhand leitfadengestützer Experteninterviews hat sie eine Untersuchung des Intendanzwechsels von Dieter Dorn zu Frank Baumbauer an den Münchner Kammerspielen vorgenommen.
Das Interesse an sozialwissenschaftlichen Methoden ist nicht nur durch Publikumsforschung bestimmt, sondern zeugt von einer Auseinandersetzung mit institutionellen Fragen. In seinem Beitrag plädiert Friedemann Kreuder für „eine Erweiterung des theaterwissenschaftlichen Methodenrepertoires um eine soziologisch ausgerichtete Differenzierungsforschung.“ Dies betreffe vor allem die infrastrukturell-institutionelle Dimension des Theaters, die als „Praxiskomplex“ definiert wird und in seinem Fall die Ausbildung, Auswahl und Positionierung von Schauspieler*innen in diesem Komplex untersucht. Die soziologische Ausrichtung sieht man daran, dass „insbesondere die organisations- und institutionentheoretische Perspektivierung des Praxiskomplexes als ‚organisationales Feld‘ als [disziplinär anschlussfähig]“ anerkannt wird. Der aus der Organisationssoziologie entlehnte Begriff des ‚organisationales Felds‘ nimmt nicht die einzelne Einrichtung, sondern die Bildung von komplexeren ‚Feldern‘ in den Blick, wobei sich einzelne Organisationen immer mehr angleichen (Isomorphismus) und dadurch institutionelle Macht erlangen.4 Auch wenn institutionelle oder organisationssoziologische Untersuchungen innerhalb der Theaterwissenschaft immer noch Seltenheitswert haben, gibt es gegenwärtig Bestrebungen, die auf eine Annäherung hinweisen. Neben Kreuders eigenem Projekt, das Teil einer DFG-Forschungsgruppe zum Thema „Humandifferenzierung“ bildet, 5 gibt es an der LMU München eine ortsverteilte Forschungsgruppe, die sich mit institutionellen Transformationsdynamiken in den darstellenden Künsten der Gegenwart beschäftigt (FOR 2734), und in der sozialwissenschaftliche Methoden eine zentrale Rolle spielen.6
Neben der Organisationssoziologie ist vermutlich die Ethnologie bzw. Ethnografie dasjenige sozialwissenschaftliche Fach, das besonders in den letzten Jahren von der Theaterwissenschaft intensiv rezipiert wurde. In seinem Beitrag, „Die Ethnografie als Methode der Theaterwissenschaft?“ differenziert der bekennende Sozialanthropologe Jonas Tinius, der an der Universität Cambridge über das Theater an der Ruhr in Mülheim promovierte, zwischen den verschiedenen in der Anthropologie gängigen Methoden. Dabei ist die Ethnografie, die häufig mit Feldforschung und teilnehmender Beobachtung gleichgesetzt wird, nur eine bestimmte Phase innerhalb eines anthropologischen Forschungsdesigns. Ethnografie bedeutet für Tinius daher „eine Phase und Art anthropologischer Praxis, die sich dem Widmen und Beschreiben von Feldforschung widmet. Es bedeutet eben auch einfach: Schreiben über Menschen.“ Dies setzt aber eine Beschäftigung mit „diesen Menschen“ über einen längeren Zeitraum voraus, der landläufig unter dem Begriff der teilnehmenden Beobachtung firmiert. Auch wenn zwischen Ethnografie und Performance Studies ein enger fachgeschichtlicher Konnex besteht, nicht zuletzt wegen der bereits erwähnten Gründer Richard Schechner und Dwight Conquergood, und weil Erika Fischer-Lichtes Ästhetik des Performativen einige Anleihen bei Victor Turners Theorie der Liminalität macht, bleiben diese Beziehungen oft auf der Ebene der metaphorischen Begrifflichkeit und selten in einem echten Dialog über gemeinsame Methoden und Gegenstände. Da sich Ethnografie nicht auf eine Methode verkürzen lasse, so Tinius, könne man nicht mit einem fertigen methodischen Werkzeugkasten ins Feld ziehen. Im Gegenteil: Das Feld und seine Erfordernisse bestimmen die Methode(n) und nicht umgekehrt. Letztlich setzt ethnografische Forschung eine lang andauernde, sich meistens über Monate erstreckende Beobachtung und Begleitung des Forschungsgegenstands, sei es Probenprozesse,7 die prekäre Projektarbeit in der Freien Szene8 oder die komplexe institutionelle Verfasstheit einer einzelnen Theaterorganisation, voraus.9