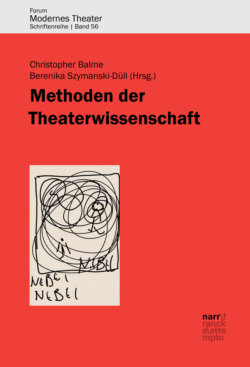Читать книгу Methoden der Theaterwissenschaft - Группа авторов - Страница 19
2. Die Methode (oder der Umweg) der Lektüre
ОглавлениеDie Öffnung auf das Singuläre – des je spezifisch konstituierten Gegenstandes wie der je spezifischen Konstitution in seiner Betrachtung – setzt methodologisch zunächst einmal ein jeder Methode entgegenlaufendes Einspruchs- und Mitgestaltungsrecht des Gegenstandes voraus. Einer der Begriffe, die in die Theaterwissenschaft für die damit bezeichnete Praxis aus dem Kontext vor allem der US-amerikanischen ‚Literary Theory‘ übernommen werden können, ist derjenige der ‚Lektüre‘. Lesen, so gaben Theoretiker wie Paul de Man, Werner Hamacher, Carol Jacobs, Hillis Miller oder Samuel Weber1 zu bedenken, ist im Zentrum der Interpretation wie der Institutionen, die auf ihr aufbauen (Disziplinen, Institute, Fakultäten, Universitäten) ein Akt, der sich auf keine Weise formalisieren lässt. Die Interpretation eines Textes fußt auf dessen Lektüre, ja einem Imperativ der Lektüre – man muss lesen. Und das Lesen unterscheidet sich dabei prinzipiell nicht vom Schauen und Hören der Theaterbesucher*innen. Hier wie da wird in einem einmaligen, wenngleich nur in der Wiederholung zugänglichen Akt ein Netz von Verknüpfungen hergestellt, in dem sich ein Gegenstand erkennen lässt. Doch dieses Erkennen muss zwangsläufig vorläufig, überstürzt, blitzhaft bleiben. Im tendenziell unendlichen Aufschub des Sinns eingeschrieben, eignet es sich so wenig wie die einmalige Konstitution eines Theatervorgangs in seiner Analyse zur dauerhaften Grundlage. Auch die Wiederholbarkeit des Lektüreakts, die etwa Hans-Thies Lehmann als Unterscheidungsmerkmal zwischen Theater- und Literaturwissenschaft anführt2, ändert daran nichts, denn niemals steigen wir als derselbe Leser bzw. dieselbe Leserin in den gleichen Fluss der Sinnproduktion ein. Eben das, worauf die Interpretation fußen möchte, verweist von daher in der Interpretation und über sie hinaus auf den prinzipiellen Zweifel an der Lesbarkeit jedes Textes, einen Zweifel, der sich – kurz und andeutungsweise formuliert – aus dem Textcharakter des Textes selbst ergibt.3 Er muss überall dort vergessen werden, wo Texte auf Thesen reduziert werden, eine von mehreren Les- und Bedeutungsarten auf Kosten aller anderen privilegiert wird. Mit diesem Zweifel beginnt andererseits ein Lesen, das den Text selbst bereits als Inszenierung begreift, als Resultat eines Kompromisses zwischen unterschiedlichen Interessen, bedingt wie begrenzt durch Ort und Zeit seiner Niederschrift wie seiner Lektüre. Jede so verstandene ‚Lektüre‘ bedeutet auch die Eröffnung einer Chance für die in solchem Kompromiss unterdrückten Tendenzen, für das, was sich in einer bestimmten geschichtlichen Situation nicht äußern, bzw. keine Rolle spielen konnte.
Nur wenn man allerdings den Text bereits als Inszenierung, als Theater begreift – und die zitierten Theoretiker wie eine ganze Reihe weiterer legen dies nahe – können umgekehrt die Inszenierung oder Aufführung auch neuerlich mit einem Text verglichen werden – ohne dass dies die Theaterwissenschaft unmittelbar zurückwirft auf die lange Zeit vorherrschende Auffassung, Theater sei nur die Fortsetzung oder Umsetzung von Literatur auf einer Bühne und insofern mit den Mitteln literaturwissenschaftlicher Interpretationstechniken, letztlich als Teil von Literaturwissenschaft erforschbar. Übertragen auf die Inszenierungs-, Aufführungs- und Dispositivanalyse oder auch nur auf die Analyse und Deutung einzelner Elemente aus diesen – etwa einer schauspielerischen Geste, des bestimmten Verhaltens in einer Szene, einer Sequenz von aufeinanderfolgenden szenischen Anordnungen oder einer räumlichen Einrichtung – ergibt sich aus der Einsicht in die Aporien des Lesens eine doppelte Grundannahme: Jedes theatrale Ereignis ist prinzipiell unendlich ausdeutbar. Jede Lektüre ist prinzipiell unabschließbar. Beide Annahmen ergeben sich, noch einmal anders ausgedrückt, daraus, dass Arbeiten im Theater wie Texte, mit einer von Walter Benjamin geprägten Formulierung, kaum anders denn als „von Spannungen gesättigte Konstellationen“4 zu begreifen sind. Wo ihrer doppelten Unendlichkeit und Unabschließbarkeit zum Trotz eine Beschreibung unternommen, eine Deutung versucht wird, da ist diese unweigerlich an ein Moment gebunden, das man – vielleicht missverständlich – als subjektiv oder – mit Foucault und Butler als kritisch5, in jedem Fall aber als nicht weiter legitimierbar, als nicht länger anders denn im Zusammenhang einer Politik der Lektüre halt- und begründbar bezeichnen müsste.
Es könnte nun so scheinen, als sollte damit einer willkürlichen, letztlich relativistischen Deutungspraxis das Wort geredet werden: Tatsächlich geht es aber ganz im Gegenteil darum, die Voraussetzung gängiger Deutungspraxis – und damit einer Archi-Methodologie, einer allen weiteren Praktiken der Theaterwissenschaft zugrundeliegenden Methode vor aller Methodenvielfalt – offenzulegen und dadurch auf die Verankerung der Analyse, Interpretation, Lektüre und Kritik in einem Bereich hinzuweisen, den man in den klassischen Kategorien der Ethik zuweisen müsste. Die „mikrologischen“ Lektüren Adornos6, die sich in ihrer Vertiefung ins Detail Maß und Takt von ihrem Gegenstand diktieren lassen, oder die Lektüre der „Spur des Anderen“ bei Lévinas und vor allem Derrida können als exemplarische Formen solcher Praxis gelten7: Eben weil der Andere mir immer schon vorausgegangen sein wird im Moment meiner Auseinandersetzung, bzw. meiner Deutungspraxis, gibt er mir zugleich eine unendliche Aufgabe wie auch das unausweichliche Scheitern an dieser vor – gemessen am Anspruch eines das Ganze umfassenden Verständnisses. Dem korrespondierend folgt aus dem Lesen von Spuren (und nicht von Zeichen oder Botschaften) des Anderen einerseits ein Imperativ des Verstehens und daraus resultierend ein mit allen Mitteln traditioneller Hermeneutik vorgehender Deutungsprozess, andererseits aber notwendig zugleich dessen Umschlag in einen Imperativ des Nicht-Verstehens. Dieser Umschlag resultiert aus der Grenze des Verstehens in der schon aufgrund der Differenz von Zeit, Ort und Lebensgeschichte niemals restlos erschließbaren Andersheit des Anderen. ‚Der Andere‘ als Denkfigur der Alterität unterliegt allerdings mit einiger Berechtigung einer Kritik, die der mit ‚ihm‘ häufig verbundenen Homogenisierung gilt. Weist Derrida in seiner Auseinandersetzung mit Levinas auf dessen tendentielle Unterschlagung der sexuellen Differenz in der unifizierenden Rede vom Anderen im – vermutlich generisch intendierten, jedoch darauf nicht reduzierbaren – Maskulinum hin, so kritisiert Spivak mit Blick auf Foucault und Deleuze die Rede vom homogenen Anderen als eine „unser Wohlwollen […] verriegeln[de]“ Form der Ersetzung einer auf keine Weise auf ein Gemeinsames reduzierbaren Vielheit unterschiedlicher ‚Subalterner‘ durch ein ‚alter ego‘.8 Die Aporien und immer neuen und je anderen Folgen aus der jeden Grund erschütternden Grundfigur der Alterität nicht zu vergessen, vielmehr für sie die Verantwortung zu übernehmen, könnte als (an-)archi-methodologischer Imperativ bezeichnet werden, der eine Allgemeine Theaterwissenschaft wenn nicht zu begründen und zu fundieren, so doch von jeder anderen Form des Umgangs mit Theater zu unterscheiden vermag.