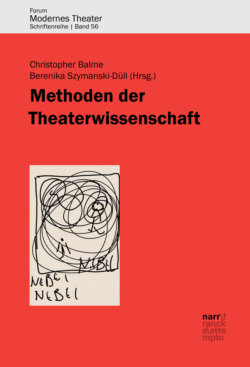Читать книгу Methoden der Theaterwissenschaft - Группа авторов - Страница 18
1. Ohne Grund
ОглавлениеNicht selten unterliegt die Theaterwissenschaft dem Spott, es handle sich angesichts der Flüchtigkeit der Aufführung in ihrer unwiederholbaren Einmaligkeit nicht nur um ein Fach ohne Methode, sondern vor allem auch um ein Fach ohne Gegenstand: Während die Literaturwissenschaftler*innen auf die Bibliotheken und die Historiker*innen darüber hinaus auf die Archive verweisen können, blieben den Theaterwissenschaftler*innen von dem, was im Zentrum ihres Interesses steht, nur die Erinnerung in den Köpfen der Zuschauer*innen, die Dokumentation in der zumeist eher unzuverlässigen Form der Theaterkritik oder des Werbetextes der Theater selbst, außerdem die meist unzuverlässigen Zeugnisse der Beteiligten. Dieser Spott verliert nicht sein Moment von Wahrheit angesichts neuerer Aufzeichnungsmethoden und Speichermedien. Sie erweitern zwar die Grundlage, doch stellen sie die Theaterwissenschaft zugleich vor neue Probleme: Der Raum wird hier auf ein Bild verkürzt, das Bild auf binär codierte Daten. Veränderungen der Perspektive, der Rahmung, der Lichtverhältnisse und der Akustik, des Abstands zum Bühnengeschehen und darüber hinaus die meist komplette Unterschlagung der Interaktion im Zuschauerraum sind ebenso zu bedenken wie jene Veränderungen, die sich aus der Ablösung der aufgezeichneten Aufführung vom Ort und aus der Zeit ihrer Aufzeichnung ergeben. Wie gelungen auch immer in technologischer Hinsicht die Aufzeichnung ausfällt, das Resultat taugt allenfalls als Gedächtnisstütze, das hilft, die Erfahrung zu fixieren, als Indiz mit begrenzter Aussagekraft. Kurz: Soweit im Zentrum der Theaterwissenschaft die Inszenierungs- oder Aufführungspraxis bzw. das als Kunst begriffene Theater stehen soll – und nicht eine als gleichsam kybernetische Grundlage konzipierte ‚Theatralität‘ oder ‚Performativität‘ –, taucht zurecht der Verdacht mangelnder ‚Substanz‘ oder fehlender ‚Essenz‘ auf.
Dieser Verdacht soll hier nicht zurückgewiesen werden, lässt er doch tatsächlich auch eine mögliche Stärke des Faches erkennen. Im Unterschied zu Fächern, die sich auf ‚Grundlagen‘ stützen, muss sich eine Theaterwissenschaft, in deren Zentrum das Theater als Kunst steht, ihrem je besonderen und potentiell singulären Gegenstand ohne Vorbehalt ausliefern. Sie kann nichts als unverrückbares Fundament voraussetzen, was nicht im Verlauf der Auseinandersetzung mit ihren Untersuchungsgegenständen einer rückhaltlosen Kritik und Revision unterliegen könnte. Sie hat ihren Gegenstand nicht, sie muss ihn allererst ‚konstituieren‘ und dies in jedem einzelnen Fall. Dieser Ausgangspunkt eines in keiner Weise ontologisierbaren Forschungsobjekts und insofern gewissermaßen einer Leere im Zentrum kennzeichnet das Fach als ein sehr spezifisch modernes. Dies geht weit über die historische Tatsache hinaus, dass die Theaterwissenschaft eine junge Disziplin ist, die erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts sich aus dem Umkreis der Literaturwissenschaft ablöste und zum eigenen Fach wurde,1 und die insofern bis in die jüngste Zeit mit gutem Recht für sich in Anspruch nehmen konnte, dass sie noch am Aufbau ihrer Grundlagen zu arbeiten hätte.
Was aber heißt Konstitution: Als grundlegend und genauer abgründig für die Theaterwissenschaft in diesem Sinne erweist sich zunächst einmal, was eher missverständlich als „linguistic turn“2 diskutiert wird. Theater ist uns nur vermittelt durch ein Medium zugänglich: durch die Sprache der Beschreibung seiner Wahrnehmung bzw. Erfahrung. Dieser Einsicht korrespondiert nun allerdings in der neueren Theaterwissenschaft eine zweite, auf die speziell die Erforschung der „theatricality“ oder „théatralité“ in den USA3 und Frankreich4 neue Aufmerksamkeit gelenkt haben: Das sprachliche Medium ist nicht im Sinne eines Instruments zu begreifen, mit dem etwas gesagt werden kann, und auch nicht als ‚begreifbarer Gegenstand‘, sondern viel eher „als ein höchst problematischer Vorgang, in den wir verstrickt, ja eingeschrieben sind“5. Exakt das, was hierbei als ‚Verstrickung‘ bezeichnet wird, kann aber mit Derrida, Nancy und Lacoue-Labarthe auch als Archi-Theater6 oder schlichter als das anfängliche unhintergehbare Theater in jeder sprachlich verfassten Äußerung bezeichnet werden: Diese findet sich von Beginn an in einer ihr gleichursprünglichen, zeiträumlichen und materialen Anordnung vor, die sie zugleich verändert, wie sie auch von ihr verändert wird. Sprache und Theater, so könnte man von daher formulieren, lassen sich nur ausgehend von ihrer wechselseitigen Beziehung betrachten: Theater ist nur sprachlich vermittelt zugänglich, Sprache jedoch immer schon theatral konstituiert und destituiert.
Missverständlich kann die Bezeichnung eines linguistic turn für diese Erkenntnis – des Verstricktseins von Sprache in Theater, Theater in Sprache – erscheinen, weil sich bei genauerer Betrachtung speziell literarischer, aber auch philosophischer Quellen kaum mehr ausmachen lässt, wann dieser ‚turn‘ denn noch nicht stattgehabt hat. Setzt die Rede von einem „turn“ voraus, dass es ein Vorher und ein Nachher gibt, so wird man bei genauerer Lektüre der philosophischen Texte der abendländischen Tradition keinen ausfindig machen können, der nicht in gewisser Hinsicht bereits von jener Verstricktheit in Sprache gekennzeichnet ist, die mit dem ‚linguistic turn‘ benannt wird. Statt von einem ‚turn‘ zu reden, sollte man also vielleicht eher konstatieren, dass in wiederholter Einmaligkeit der mit diesem ‚turn‘ bezeichnete Wechsel in der Perspektive vollzogen und als nicht mehr hintergehbar erkannt wurde: Bei Platon, bei Rousseau, Kant, Hölderlin, Nietzsche, Freud, Benjamin, Heidegger, Blanchot, Levinas und zuletzt vor allem im Umkreis des ‚Poststrukturalismus‘ bzw. der ‚Dekonstruktion‘ Paul de Mans7 und Jacques Derridas,8 welche die ihnen vorausgehende Tradition auf den Begriff gebracht und in ihr an einer Öffnung hin auf das ‚Singuläre‘9 gearbeitet haben.
Das Singuläre erscheint, wie speziell Jean-Luc Nancy zu denken gibt, in jedem Fall zusammen mit anderen Singularitäten. Singulär sein, heißt paradoxerweise immer schon: zugleich auch plural sein.10 Wir sind – jede*r einzelne – in dem Maß singulär, wie jede*r in ein spezifisches Netz von Beziehungen verstrickt ist, in einem je anderen Gefüge steht, durch ein anfängliches mitgeprägt wird. Theater in seiner allgemeinsten Form, ‚Theater überhaupt‘11, kann als der paradigmatische Begriff für diese singulär plurale Seinsweise und Erscheinungsform des ‚Mit‘ begriffen werden. Dies wirft nun allerdings die berechtigte Frage auf, wie sich jenes in keiner Weise essentialisierbare ‚Theater‘ zu den je besonderen Fragestellungen einer Allgemeinen und Vergleichenden Theaterwissenschaft verhält und welche methodischen Konsequenzen die Einsicht in die theatrale Verfasstheit hat.