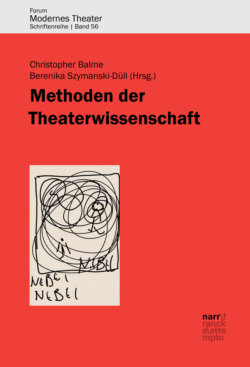Читать книгу Methoden der Theaterwissenschaft - Группа авторов - Страница 13
II. Methode und Antimethode
ОглавлениеMit ‚Methodologie‘ soll an dieser Stelle, wie gesagt, dezidiert zugleich mehr und weniger als die Gesamtheit der Methoden des Fachs Theaterwissenschaft (oder eines spezifischen Erkenntniszusammenhangs, oder gar der Wissenschaft allgemein) angesprochen werden. Dahinter stünde ein Anspruch, der einerseits vermessen wäre, sich aber andererseits auch in einer bloßen Additionsaufgabe erschöpfen müsste, verbände er sich nicht mit der grundlegenden Frage nach einer Typologie (theater-)wissenschaftlicher Methoden.1 Aus Gründen, die aus dem Folgenden deutlich werden sollten, halte ich eine solche Frage jedoch für wenig hilfreich. So scheint es konsequent, dass sich die Herausgeber*innen des vorliegenden Bandes dagegen entschieden haben, mit der Auswahl der Beiträge ein Gesamtbild aller Methoden des Fachs zeichnen oder Vollständigkeit auch nur suggerieren zu wollen. Dass diese Entscheidung mit der historischen Genese, der institutionellen Einbettung und der spezifischen Unschärfe des Gegenstandsbereiches von ‚Theaterwissenschaft‘ zu tun hat und dass der vorgeschlagene Rahmen – gerade in der Vielfalt der einzelnen Methoden, die im Fach Theaterwissenschaft zur Anwendung kommen – klar disziplinär begründet ist, liegt dabei auf der Hand.
Zurück zum Begriff: Das im einleitend angeführten Bonmot stellvertretend skizzierte, einigermaßen vage Verständnis von ‚Methode‘ als ‚Weg‘ ist etymologisch gewendet plausibel: Das griechische Kompositum methodos (μέθοδος < μεθ- < μετά- und ὁδός) beschreibt einen spezifischen ὁδός (hodos), einen Weg, μετά (meta), nach irgendwo, aber auch auf irgendetwas hin. Das Wort ‚Methode‘ hat also einen konzeptmetaphorischen Hintergrund,2 und es lohnt sich, darüber nachzudenken, inwieweit dessen Implikationen belastbar sind: Ein Weg auf etwas hin – sagen wir: ein Wanderweg – ist, hat man ihn erst einmal gebahnt, beschreib- und markierbar. Er kann von ganz unterschiedlichen Akteur*innen immer wieder beschritten und bewältigt werden und führt mit einiger Sicherheit immer zum selben Ziel. Diese Hintergrundmetaphorik macht sich die Ratgeber- und Selbstoptimierungsliteratur zunutze; mit Disziplin und der rechten Methode (so wird suggeriert) sei das Erreichen des Ziels – Ordnung auf dem Schreibtisch, der perfekte Körper, gar ein glückliches Leben – nur eine Frage der Zeit.
Nun ist ein fachwissenschaftliches Methodenhandbuch kein Wanderführer und kein Diät-Ratgeber; das, worauf wissenschaftliches Arbeiten zielt, ist komplexer als der ordentliche Schreibtisch und weniger umfassend als individuelles Glück. Tatsächlich jedoch setzt auch die klassische Definition des Historischen Wörterbuchs der Philosophie an dem bestechend konkreten Bild an, welches das griechische Wort transportiert. ‚Methode‘ im engeren Sinne meint, so Joachim Ritter, den „Nachgang im Verfolgen eines Zieles im geregelten Verfahren“.3 Und gerade im 20. Jahrhundert hat sich die Diskussion um das Für und Wider einer spezifischen Methode oder methodischen Arbeitens generell immer wieder an den Implikationen der Metaphorik von Weg und Ziel gerieben: Sei es mit der Annahme, Methoden übertrügen ihre eigene Gleichförmigkeit auf den Gegenstand – so etwa bei Hans Magnus Enzensberger, der unter Aufgreifen des bekannten Sontag’schen Essays „Against Interpretation“4 die martialische Metapher prägt, eine literaturwissenschaftliche Interpretation mache aus einem Gedicht eine Keule –5, sei es mit der Vorstellung, erst mit dem Abweichen vom Weg entstünde neues Wissen oder könne sich das alte verändern (so bei Paul Feyerabend).6
Auch Michel Foucault stellt die Frage nach dem Verhältnis von Weg und Ziel als Vorgehen und Ergebnis der Analyse; er dreht das Konzept um und beschreibt seine Arbeitsweise als ein heuristisches Tasten, das erst ex post, vom Ziel des Weges her, als methodisch rekonstruierbar sei. Die bekannte Beschreibung seiner Schriften als Werkzeugkasten, aus denen sich die geneigte Leserschaft ganz nach akutem Bedarf mit einem Hammer, einer Säge oder einer Zange zu bedienen habe, markiert ein Verständnis vom Methodischen, das die etymologische Grundlage kollabieren lässt.7
Der Frage nach der Methode ist Wissenschaft nach der Postmoderne freilich nicht enthoben; vielmehr sieht sie sich mit der Herausforderung konfrontiert, mit einer Pluralität von Methoden umzugehen und sich in der Frage nach der Methode (und nach dem Methodischen) der eigenen Arbeit immer wieder neu zu positionieren. In erster Linie sehen sich wohl die Geistes- und Kultur-, zuweilen auch die Sozialwissenschaften mit dem Vorwurf eines Fehlens von Methode und Methodik konfrontiert – letztere insbesondere dort, wo sie mit qualitativen Ansätzen oder gar nicht empirisch, sondern in erster Linie reflexiv operieren.8
Wenn einer akademischen Disziplin aus externer Beobachtungsposition die Methode zu fehlen scheint, dann hat das oftmals mit einem normativen und disziplinäre Differenzen nivellierenden Methodenbegriff zu tun. Ein solcher Methodenbegriff ist dann meist entweder (je nach Wissenschaftskultur und Wissenschaftssprache9 möglicherweise wenig adäquat) formallogisch bestimmt oder (nicht weniger problematisch) aus einem unscharfen Alltagsverständnis abgeleitet ist. Wie angedeutet, lässt sich die Theaterwissenschaft, verstanden als ein Kollektivsingular, immer weniger über eine beschränkbare Zahl an Leitparadigmen definieren;10 und die Erweiterung des Spektrums an Theorien und Methoden stellt mit den Analogien, die diese nahelegen, und Optionen des modellhaften Vergleichs den Gegenstandsbereich des Fachs immer neu auf die Probe. Im Folgenden soll entsprechend für die Diskussion eines flexiblen Rahmens optiert werden, innerhalb dessen man von ‚Methode‘ sprechen kann.
Ein generelles Problem der methodischen Diversität der Fächer, die sich als geistes- oder kulturwissenschaftlich verstehen, und ihrer methodologischen Differenz zu den Naturwissenschaften besteht darin, dass in ihnen Sprache nicht so sehr als bloßes Instrument der Distribution von Forschungsergebnissen gedacht wird. Wäre dies so, dann wäre ihr Wissen weitgehend unabhängig von der Darstellungssprache und der konkreten Verbalisierung zu verstehen. Doch in den Geistes- und Kulturwissenschaften erscheint der sprachliche Ausdruck selbst als ein zentrales Forschungsinstrument und als Arbeitsform. Der Innenwahrnehmung einer großen Methodendiversität steht die Außenwahrnehmung einer großen Homogenität geistes- und kulturwissenschaftlichen Arbeitens und seiner Methoden gegenüber: Trotz der Hinwendung zu sozialwissenschaftlich-empirischen und zu nicht-sprachlichen Forschungsmethoden werden weiterhin Texte zu Texten, Aufführungen, Bildern und deren (ästhetischer) Erfahrung produziert, die nicht vorgeben, bloß schriftlich zu fixieren, was sie ja auch tatsächlich erst argumentativ explorieren und erobern.
In der Hochphase der turns in den Geisteswissenschaften, die sich mit der Hinwendung zu den materialen Grundlagen, den pragmatischen Einbettungen und dem Vollzugscharakter ihrer Gegenstände nun emphatisch als Kulturwissenschaften verstanden, hat Harald Fricke auf Fragen nach dem Methodischen außerhalb der empirischen und experimentellen Wissenschaften reagiert.11 Er hat den Vorschlag gemacht, nicht mehr von ‚Methoden‘, sondern von Argumentationsweisen zu sprechen. Damit äußert er sich zwar in erster Linie für seine eigene Disziplin, die Literatur- und Textwissenschaft, argumentiert aber letztlich für die von Dilthey eingeführte Trennung zwischen erklärender Natur- und verstehender, also im weiten Sinne hermeneutisch-interpretierender Geisteswissenschaft:12 Naturwissenschaftliches Arbeiten mache auf dem Wege des Ineinandergreifens von Experiment und Modell, von Erkenntnisinteresse, Erkenntnisweg und Forschungsergebnis, Naturgeschehen nach Möglichkeit als von menschlichem Kulturhandeln unbeeinflusst beschreib- und damit – in pragmatischen Grenzen – auch vorhersagbar. Demgegenüber sei es Ziel und Aufgabe der Geisteswissenschaft, an der Multiperspektivität allgemeinen und speziellen Weltverständnisses zu arbeiten: Komplexität nicht zu reduzieren, sondern zu transformieren. Ein im strengen Sinne methodisches Vorgehen sei entsprechend genuin naturwissenschaftlich.13
Schon mit den wissenschaftstheoretischen Überlegungen Karl Poppers und seiner falsifikationistischen Erkenntnistheorie,14 erst recht aber im Kontext aktueller Inter- respektive Transdisziplinaritätsparadigmen,15 verliert diese Differenzierung an Überzeugungskraft. Längst ist sich auch experimentelle Forschung darüber im Klaren, dass ihre Ergebnisse nicht für sich selbst sprechen, sondern interpretiert und vermittelt werden wollen; dass schon Beobachtung Naturgeschehen kulturell rahmt und modifiziert. Der Blick auf gängige quantitativ wie qualitativ-empirische sozialwissenschaftliche Arbeitsweisen lässt die überkommene Dichotomie vollends kollabieren – dass Interviews, Testungen und Statistiken wesentlich bestimmt sind durch das Erkenntnisinteresse ihrer Entwickler und zudem im Ergebnis der Interpretation bedürfen, liegt auf der Hand.16
Auch für die kulturwissenschaftliche Forschung – und so auch für die Theaterwissenschaft – macht die klassische Dichotomie in der Praxis nur bedingt Sinn. Das wird schon angesichts des Spektrums, das die Beiträge des vorliegenden Bandes eröffnen, offensichtlich: Denn in der Theaterwissenschaft, aber nicht weniger in benachbarten Fächern spielen zunehmend auch experimentelle und empirische Methoden eine nennenswerte Rolle.17 Und dass solche Methoden in einem anderen Sinne methodisch sein können, wollen und sollen, als etwa eine von phänomenologischen Leitparadigmen her strukturierte Aufführungsanalyse, liegt auf der Hand. Die Theaterwissenschaft zeichnet sich zudem dadurch aus, dass sie Methoden auf der Objektebene als Forschungsmethoden ernst zu nehmen und in diesem Sinne in einen Dialog mit ihrem Gegenstand zu treten gelernt hat.18