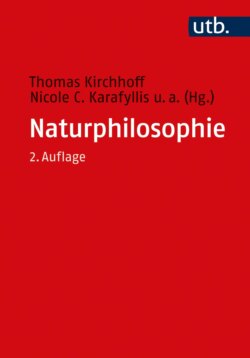Читать книгу Naturphilosophie - Группа авторов - Страница 33
3. Mittelalter: Göttliche Ordnung als Rechtsgrund
ОглавлениеWenn Gott zugleich Gesetzgeber der Naturordnung und der moralischen Ordnung ist, lässt sich zumindest theoretisch an der Vereinbarkeit von Natur und Handeln festhalten. Thomas von Aquin (1224/25–1274) hat das als Gesetzeshierarchie festgehalten: An der Spitze steht das ewige Gesetz. Dabei handelt es sich um die Idee der Totalität der Weltordnung im göttlichen Geist. Diese Vorstellung ist der normative und zugleich kausale Grund aller Ordnung in der Welt. Das ewige Gesetz wird offenbart im Naturgesetz. Mit ‚Naturgesetz‘ ist nicht der moderne Begriff eines wissenschaftlichen Gesetzes, sondern die gesetzmäßige Ordnung der Natur selbst gemeint. Und an unterster Stelle steht das menschliche Gesetz, das Recht, das Menschen sich selbst geben. Damit es nicht aus der Ordnung herausfällt, muss der Gesetzgeber sich am ewigen Gesetz und an den geoffenbarten Geboten (dem positiven göttlichen Recht) orientieren.
Der theologisch interpretierte Platonismus bietet aber noch ein zusätzliches Naturprinzip des Rechts an: Alle Naturprozesse zielen auf ein Gutes. Deshalb gilt, dass das Gute zu erstreben, das Schlechte oder Böse aber zu vermeiden ist. Dies soll die natürliche Richtschnur der Gesetzgebung sein. Sie soll auf das bonum commune, das gemeinsame Gute, gerichtet sein. In der säkularen Rechtspraxis ist dieses Prinzip das überlieferte gute alte Recht. Die Autorität des Althergebrachten beruft sich zwar nicht direkt auf die Naturordnung, behandelt aber das Überlieferte wie eine mit der Zeit verfestigte, jetzt nicht mehr folgenlos zu durchbrechende Ordnung zweiter Natur. Für die Entwicklung dieser Praktiken zu staatlichem Recht ist das naturrechtlich begründete Kirchenrecht (kanonisches Recht) lange Vorbild. Zum Beispiel wird der Grundsatz, dass Verträge einzuhalten seien (pacta sunt servanda) zuerst im Kirchenrecht formuliert. Heute regelt das staatliche Recht den Geltungsbereich kanonischen Rechts.
Im Verlauf des Mittelalters kommt es zu gravierenden Veränderungen in der Sozialstruktur. Antike Vorstellungen werden überwunden, die menschliche Arbeit wird nicht mehr nur als Strafe für die Erbsünde, sondern als eigenständige Leistung zur Orientierung in der Welt und zur Beherrschung der Natur verstanden. Damit hängt die Entwicklung von Städten zusammen, die zu Gewerbe- und Handelszentren werden. Der veränderte Bedarf bringt Veränderungen in der Landwirtschaft mit sich. Diese wirtschaftlichen Veränderungen erfordern neue Rechtsformen. Es kommt zu einer intensiven Rezeption des römischen Rechts, die ungefähr mit der Wiederentdeckung |45|des lange Zeit vergessenen Werks des Aristoteles zusammenfällt. Insbesondere die Aristotelische Konzentration auf die Erkenntnis des Einzelnen, des Erfahrungsobjekts, wirkt subversiv auf den neuplatonischen Naturbegriff des Mittelalters. Vom Einzelnen aus ist eine absolute rationale Ordnung nicht unbedingt zu erkennen. Die Willkür wird zum vorherrschenden Prinzip; auch Gottes Wille gilt bei Duns Scotus (1266–1308) oder Wilhelm von Ockham (ca. 1287–1349) nicht mehr als bloße Funktion seiner Vernunft, sondern als absolute Macht. Er kann, wenn er will, die bestehende Ordnung jederzeit durch eine andere ersetzen. Mit dieser These fällt einerseits die gesamte Ordnungsgewissheit des Mittelalters in sich zusammen; andererseits sind damit Voraussetzungen für den modernen individuellen Subjektbegriff und für die Wandelbarkeit sozialer Normen geschaffen.