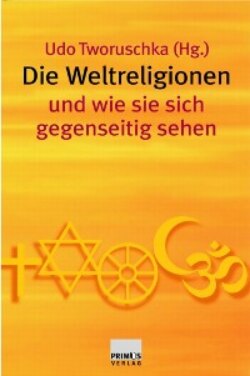Читать книгу Die Weltreligionen und wie sie sich gegenseitig sehen - Группа авторов - Страница 11
Enterbte Synagoge oder unverzichtbarer Partner? Der Blick auf das Judentum
ОглавлениеEine blinde Frau (bzw. eine Frau mit verbundenen Augen) als synagoga (Synagoge), eine sehende als ecclesia (Kirche) – dieses aus der Kunstgeschichte bekannte Motiv vermag die über Jahrhunderte herrschende Einschätzung sprechend wiederzugeben. Die neuere theologische Diskussion bedient sich dagegen zunächst der Metapher Mutter-Tochter aus dem familiären Beziehungsgefüge. Inzwischen wird die Rede von zwei Geschwistern bevorzugt, da erst dieses Bild dem Umstand Rechnung trägt, dass sowohl das heutige Judentum als auch das heutige Christentum sich einem gemeinsamen jüdischen Nährboden verdanken, den sie jeweils in unterschiedlicher Weise aufgenommen und weiterentwickelt haben. – Was hier über die katholische Seite zu sagen ist, gilt natürlich für die Zeit vor den Kirchenspaltungen für das gesamte Christentum.
Eine erste Vorbemerkung lenkt den Blick auf die historische Entstehungsreihenfolge der monotheistischen Religionen Judentum, Christentum, Islam (und evtl. auch Bahai): Aus religionsgeschichtlicher Perspektive hat sich die jeweils jüngere auf der Basis der älteren entwickelt – und damit viele von deren Vorgaben übernommen, einige modifiziert. Aus diesem Faktum folgt, dass die jeweils jüngeren Religionen in ihrem Selbstverständnis auf ihre Vorgängerinnen vielfach angewiesen sind und ihnen gegenüber ein argumentatives Legitimationsbedürfnis aufweisen, während umgekehrt für die jeweils älteren Religionen dieser Bedarf nicht in gleichem Maße besteht; sie können in ihrem Selbstverständnis durchaus ohne die späteren auskommen und diese auch als irrelevante Häresien (Ketzerei) aus ihrem Blickfeld ausgrenzen. Es ist hier nicht der Ort, diese These ausführlich zu belegen, es geht vielmehr darum, den Mechanismus als solchen zu benennen.
Eine zweite These thematisiert den Zusammenhang zwischen den vielen Konflikten im jüdisch-christlichen Verhältnis und der besonderen Nähe dieser beiden Religionen: Wie im persönlichen oder auch politischen Leben, so liegt auch in der Beziehung zwischen den Religionen das größte Konfliktpotenzial nicht zwischen möglichst weit voneinander entfernten Akteuren, sondern umgekehrt: Je näher, vertrauter man sich ist, je mehr einem mit dem anderen gemeinsam ist, umso mehr gibt es auch Stoff und Motivation für Auseinandersetzungen – mit meinen Nachbarn und Verwandten habe ich mehr Kämpfe ausgefochten als mit Herrn X aus Y, mit Frankreich hat Deutschland mehr Kriege geführt als mit China, mit dem Judentum hat das Christentum intensivere Konflikte ausgetragen als mit dem Buddhismus.
Diese letzte provokante These wird im Fall der Fragestellung zum Verhältnis von Christentum und Judentum nochmals dadurch verschärft, dass innertheologische Positionen in beiden Religionen infrage stellen, ob es sich bei Christentum und Judentum überhaupt um zwei verschiedene Religionen handelt. Natürlich ist die Frage der Trennung zwischen beiden Größen religionsphänomenologisch durchaus positiv zu beantworten – aber dennoch bleiben die Gegenargumente bestehen, und zwar interessanterweise auf beiden Seiten. Wem diese Überlegungen als überzogene Spekulationen erscheinen, dem sollte zu denken geben, dass die katholische Kirche auf struktureller Ebene ihre Beziehungen zum Judentum nicht, wie man erwarten könnte, im Päpstlichen Rat für den Interreligiösen Dialog angesiedelt hat, sondern im Bereich des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen.
Jesus und die ersten Christen
Die enge Verbindung zwischen Judentum und Christentum zeigt sich am deutlichsten in den Anfängen, auch wenn dieser Sachverhalt über weite Strecken der Kirchen- und Theologiegeschichte paradoxerweise kaum Beachtung gefunden hat: Jesus von Nazareth, die zentrale Gestalt des christlichen Glaubens, ist selbst nicht der erste Christ, sondern durch und durch Jude. Seine Mutter ist die Jüdin Miriam. Seine Heilige Schrift ist die jüdische Bibel. Seine Feste sind die jüdischen Feste. Seine Anhänger und Freunde, die späteren Säulen der Kirche, sind Juden. Über diese bloßen Fakten hinaus erscheint es als bedeutsam, dass die genannten Personen keinerlei Absicht erkennen ließen, eine neue, eigene Religion zu gründen.
Das Judentum in den neutestamentlichen Schriften
Schon in den Schriften des Neuen Testaments schlägt nach und nach die Enttäuschung durch, dass ein großer Teil der Juden das Bekenntnis zu Jesus als dem verheißenen Messias nicht teilt. Der Bruch vertieft sich, als die junge christliche Gemeinde ihre Türen auch für Interessenten aus dem Heidentum öffnet (Apg 15). Nachdem mit dem Tempel die zentrale religiöse Instanz des Judentums im Jahr 70 zerstört ist, reagieren die verschiedenen jüdischen Gruppen unterschiedlich: Identität und Fortbestand liegt für die einen in der Autorität des anwachsenden rabbinischen Schrifttums, für andere im Glauben an Jesus von Nazareth. Die Nichtbeteiligung der Judenchristen an dem letzten großen Aufstand der Juden Palästinas gegen die Römer unter der Führung von Bar Kochba (132–135, zur Zeit des Kaises Hadrian) vertieft schließlich auch die politische Seite der wachsenden Distanz. Diese Entwicklungen finden ihren Reflex in den neutestamentlichen Schriften: Das Johannesevangelium etwa verwendet durchgehend den Begriff „die Juden“ für diejenigen, die seinen Christusglauben nicht teilen – ungeachtet der Tatsache, dass neben den zentralen Gestalten des frühesten Christentums auch viele der Christgläubigen damals Juden gewesen sind. In Mt 27,25 („Sein Blut komme über uns und unsere Kinder“) findet sich die Stelle mit der wohl fatalsten Wirkungsgeschichte. Der 2. Korintherbrief (2 Kor 3,14) und der Hebräerbrief (Hebr 8,13) werden (zwar nicht unumstritten) als Zeugen für die Auffassung von einem Ende des Alten Bundes durch den Neuen ins Feld geführt. Gleichzeitig findet sich jedoch im Römerbrief, der ausdrücklichsten neutestamentlichen Bezugnahme zur Thematik (Röm 9–11), ein vielschichtiges Ringen des Paulus, der seinen Mitchristen unmissverständlich ihre eigene (bloße) Teilhabe an der bleibenden Berufung Israels ins Stammbuch schreibt.
Von der Antike ins Mittelalter
Die römische Staatsmacht beginnt etwa mit Kaiser Nero, das Christentum als eigenständige Religion wahrzunehmen, wodurch die Betroffenen (anders als das restliche Judentum) den Status der religio licita (erlaubten Religion) verlieren und staatlichen Verfolgungen ausgesetzt werden. Im inneren Verhältnis der beiden Gruppen resultiert daraus eine Verschärfung der Polemik, vor allem aufseiten der nun rechtlich schlechter gestellten Christen: Die Frage nach der richtigen Schriftinterpretation und nach der Identität des wahren Israel wird mit immer größerer Härte ausgetragen. Vorwürfe wie die Beschimpfung der Juden als „Gottesmörder“ durch Meliton von Sardes (gest. ca. 190) sind traurige Höhepunkte dieser Entwicklung.
Dramatische Auswirkungen zeigen sich freilich, als sich die politischen Rahmenbedingungen durch die Wende Kaiser Konstantins zum Christentum ab dem 4. Jahrhundert grundlegend ändern: Ab nun droht die bislang primär verbale Polemik in die Tat umzuschlagen. Theologische Formulierungen dieser Epoche spiegeln durchaus den zunehmend minderwertigen Rechtsstatus der Juden in einem Reich wider, welches das Christentum immer mehr auch für seine politische Identität in Anspruch nimmt. So kann etwa Bischof Fulgentius von Ruspe um 500 formulieren, dass „nicht nur alle Heiden, sondern auch alle Juden, alle Häretiker und Schismatiker, die außerhalb der gegenwärtigen katholischen Kirche sterben, ins ewige Feuer gehen werden …“1 Das Konzil von Florenz hat 1442 diese Auffassung mit seiner Autorität allgemein kirchlich bestätigt. Mit der Aberkennung der Heilsmöglichkeit für die Juden geht die Auffassung einher, dass die Synagoge aufgrund ihrer Verstockung zugunsten der Kirche enterbt sei. Ein beliebtes Medium, um die Überlegenheit des Christentums zu erweisen, sind öffentlich angeordnete Disputationen, für welche etwa in Spanien staatliche und kirchliche Autoritäten sowohl die Themen als auch mitunter das Ergebnis vorgeben. Zwangstaufen sowie Legenden von Hostienschändungen und Ritualmorden an christlichen Knaben durch jüdische Gemeinden ergänzen dieses Bild.
Freilich darf nicht außer Acht gelassen werden, dass es parallel zu dem Geschilderten auch freundschaftliche Beziehungen zwischen Christen und Juden gegeben hat. Auch ist darauf hinzuweisen, dass sich die höchsten Autoritäten von Staat und Kirche (Kaiser und Papst) durchaus konstruktiv für den Schutz von Juden eingesetzt haben – allerdings nicht immer mit genügend Durchschlagskraft bei Adel und Klerus, deren Übergriffe nicht immer verhindert werden konnten. Auch das grausame Gemetzel an den rheinländischen Juden im Vorfeld des ersten Kreuzzuges ist in diesem Kontext zu sehen.
Durch die Neuzeit in die Katastrophe des 20. Jahrhunderts
Da es in diesem Text vorrangig nicht um die geschichtlichen Entwicklungen geht, sondern um die theoretischen Positionen der katholischen Kirche, sind für die Neuzeit keine wesentlichen Veränderungen zu vermerken. Entwicklungen wie Rassenwahn und Endlösungsstrategien liegen jenseits direkter kirchlicher Verantwortung, auch wenn es bisweilen Versuche gibt, diese Differenzierungen zu verwischen. Bei der Diskussion um die Rolle der Kirche(n) in der Zeit des Nationalsozialismus geht es heute seriöserweise einerseits um die Frage, inwieweit die geschilderten theologischen Positionen Anteil an einem Klima hatten, in welchem solche Perversionen wie der Versuch der totalen Judenvernichtung entstehen konnten; andererseits ist zu fragen, warum es nicht die Kirche(n) als solche, sondern lediglich einzelne Christen gewesen sind, die den Mut zum Widerspruch glaubhaft gelebt haben.
Das 20. Jahrhundert hat nicht nur die Schrecken der Schoah, sondern auch eine radikale Neubesinnung der katholischen Kirche im Blick auf das Judentum gebracht. Ohne hier alle wichtigen Elemente und Stationen im Einzelnen nachzeichnen zu können, sei auf folgende Entwicklungen hingewiesen:
Der wohl bedeutendste Meilenstein liegt in der 1965 veröffentlichten „Erklärung zum Verhältnis der katholischen Kirche zu den nichtchristlichen Religionen“ (Nostra aetate) des Zweiten Vatikanischen Konzils2. In diesem Basistext wird in bahnbrechend neuer Weise über das Judentum gedacht und gesprochen. Der offene Geist dieses für die gesamte katholische Kirche verbindlichen Textes wird von vielen, aber längst nicht allen späteren lehramtlichen Äußerungen erreicht; daher wird diese Erklärung noch längere Zeit als richtungsweisender Maßstab von Bedeutung sein.
Das zweite auffällige Ereignis liegt im liturgischen Bereich: Hatte bislang die katholische Kirche in ihren Fürbitten am Karfreitag regelmäßig pro perfidis Judaeis („für die treulosen Juden“) gebetet, so wurde dieser Text 1970 folgendermaßen geändert:
Lasst uns auch beten für die Juden, zu denen Gott unser Herr zuerst gesprochen hat: Er bewahre sie in der Treue zu seinem Bund und in der Liebe zu seinem Namen, damit sie das Ziel erreichen, zu dem sein Ratschluss sie führen will.3
Welche Wegstrecken an Bewusstseinsentwicklung bis zu dieser Formulierung zurückzulegen waren, lässt sich erahnen.
Das dritte Zeichen besteht in der von Papst Johannes Paul II. veranlassten Vergebungsbitte, die er in ganz spezifischer Form am 26. März 2000 an der Westmauer in Jerusalem vorgetragen hat4. Wenn auch Kritiker in diesem Text sowie in den vorbereitenden Dokumenten zu Recht bedauern, dass im Wortlaut nicht von einer Schuld der Kirche, sondern nur von der einzelner Christen die Rede ist, so dürfen dennoch die Tragweite dieses Schrittes sowie seine überaus positive Aufnahme seitens der Adressaten nicht unterschätzt werden.
Kirchenamtliche Äußerungen sind eingebettet in die Reflexion der Theologen über die Kernfragen der thematisierten Beziehung: den Bund Gottes mit seinem Volk, Jesus als Messias und Gottessohn, seine universale Heilsbedeutung. Im Prozess dieser Besinnung und Begegnung entdeckt die Kirche neu, dass der – im Gegensatz zu der skizzierten Enterbungstheorie – niemals gekündigte Bund Gottes mit Israel für ihre eigene, christliche Identität tiefste Bedeutung hat. Sie denkt darüber nach, was es bedeutet, dass nach ihrem Bekenntnis Gott nicht nur abstrakt ein Mensch, sondern konkret ein Jude geworden ist. Jüdische Einwände gegen die Messianität und die Gottessohnschaft Jesu werden von seriöser Theologie nicht mehr triumphalistisch als objektiv defizitäre Irrmeinungen herabgewürdigt, sondern als Anfragen an die noch ausstehende Dimension der Erlösung ernst genommen. In diesem Sinne kann die gesamte Frage, wie der gegenwärtige Katholizismus das Judentum sieht, dahingehend beantwortet werden, dass das Judentum für die katholische Kirche heute nicht weniger als einen unverzichtbaren Partner darstellt.