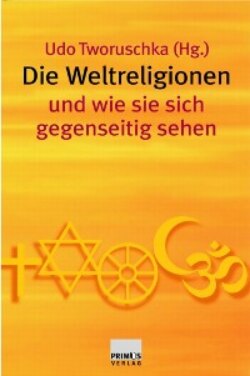Читать книгу Die Weltreligionen und wie sie sich gegenseitig sehen - Группа авторов - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vorläufer der Endzeit oder Anbeter des alleinigen Gottes? Der Blick auf den Islam
ОглавлениеDie christliche Wahrnehmung des Islams ist bis weit in das 20. Jahrhundert hinein durch Stereotype gekennzeichnet: Der Islam ist eine falsche Religion, Mohammed ein falscher Prophet und der Koran eine falsche Schrift. Angesichts des christlichen Anspruchs, die endgültige Offenbarung zu ‚besitzen‘, muss sich eine nachchristliche Religion fast notwendigerweise einer angemessenen theologischen Verarbeitung entziehen. Dies gelingt katholischerseits erst auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962–1965). Auf diese ‚Kopernikanische Wende’ ist im zweiten Abschnitt einzugehen. Der erste Abschnitt soll zunächst einen groben Überblick über die davor liegende ‚Geschichte des Blicks‘ auf den Islam geben. Den Abschluss bildet in einem dritten Abschnitt ein Blick auf nachkonziliare Entwicklungen.
Die Wahrnehmung des Islams im Mittelalter
Die ersten Versuche des lateinischen Christentums, den Islam theologisch ‚einordnen‘ zu können, sind biblisch inspiriert. Zunächst wird die scharfe Trennung zwischen dem Christentum und den „Sarazenen“ dadurch gemildert, dass man sie als Söhne Hagars, einer der beiden Frauen Abrahams, betrachtet. So sind sie etwa bei Beda Venerabilis (672–735) in das damals maßgebliche Weltbild integriert. Daneben tritt schon früh im Spanien des 9. Jahrhunderts eine apokalyptische Interpretation: die Sarazenen als Vorläufer des endzeitlichen Antichrist. Ab der Zeit der Kreuzzüge (1096) entsteht im christlichen Westen nach und nach ein konturiertes Islam-Bild, das allerdings nur in Ausnahmen der Realität nahekommt; insbesondere das volkstümliche Bild etwa vom Propheten lässt sich wie folgt auf den Punkt bringen: „Man kann ruhig über jemanden schlecht reden, dessen Bosheit alles übertrifft, was an Schlechtem geredet werden kann.“5 Mitte des 12. Jahrhunderts setzt eine zunehmend rationale Auseinandersetzung mit dem Islam ein. Der Abt von Cluny, Petrus Venerabilis (1094–1156), lässt auf eigene Kosten durch den englischen Gelehrten Robert von Ketton die erste und über Jahrhunderte maßgebliche lateinische Übersetzung des Korans anfertigen, und zwar, um durch das Aufdecken der Schwächen ihres heiligen Buches die Muslime bekehren zu können. Obwohl ihm der Islam als „Senkgrube aller Häresien“ gilt, kann er sagen: „Ich greife euch nicht, wie einige von uns es oft tun, mit Waffen an, sondern mit Worten; nicht mit Gewalt, sondern mit der Vernunft; nicht im Hass, sondern in Liebe.“6
Die rationalen, ‚wissenschaftlichen‘ Ansätze des Umgangs mit dem Islam im 12. Jahrhundert bleiben weitgehend wirkungslos. Mit dem Ziel eines friedlichen Wettstreits der Religionen inszenieren Gelehrte wie Raimundus Lullus (1232– 1316) und Nikolaus von Kues (1401–1464) im Medium der Literatur fiktive Religionsgespräche; reale Religionsgespräche in größerem Stil finden, anders als im christlichen Osten, in Westeuropa nicht statt. Der auf Mallorca geborene Raimundus Lullus entwirft in seinem Werk Vom Heiden und den drei Weisen ein philosophisches Streitgespräch zwischen den Religionen Christentum, Judentum und Islam, das zur Eintracht (concordantia) führen soll. Visionär lässt er einen der drei Weisen sagen: „Ach Gott! Welch ein hohes Gut wäre es doch, wenn wir uns […] in einem einzigen Gesetz und einem einzigen Glauben zusammenfinden könnten!“7 Nikolaus von Kues zielt über die Eintracht hinaus auf eine Einheit der Religionen. Auf einem Konzil, wie es ihm vorschwebt, gelte es die Übereinstimmung der Religionen in ihrem Wesenskern aufzuweisen. Diesem Vorhaben dient auch seine „Sichtung des Korans“ – eine Deutung des Korans vom Evangelium her, näherhin ein ‚Durchsieben‘ des Korans auf seinen biblischen Gehalt hin. In schroffem Gegensatz zu den – zumindest – verständnisorientierten Bemühungen der angeführten Gelehrten steht das Islam-Bild in Katechismen von der gegenreformatorischen Zeit an, die allerdings den Mainstream der Theologie spiegeln.
Neues Licht auf den Islam fällt im Zuge der Aufklärung und besonders dann durch die sich im 19./20. Jahrhundert entwickelnden Wissenschaften wie Religionswissenschaft, Orientalistik, Arabistik; sie ebnen den Weg zu einem adäquateren Islamverständnis und führen schließlich auch in der Kirche zu einer Revision des Jahrhunderte prägenden Bildes.
Das Zweite Vatikanische Konzil
Einen ‚Neuanfang‘ seitens der höchsten Lehrautorität der Kirche stellen die Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils dar, welches in der Dogmatischen Konstitution über die Kirche (Lumen gentium/LG) in Artikel 16 und in der Erklärung über die Beziehungen der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen (Nostra aetate/NA) in Artikel 3 explizit auf den Glauben der Muslime zu sprechen kommt.
In LG 16 heißt es:
Diejenigen endlich, die das Evangelium noch nicht empfangen haben, sind auf das Gottesvolk auf verschiedene Weise hingeordnet. […] Der Heilswille umfasst […] auch die, welche den Schöpfer anerkennen, unter ihnen besonders die Muslime, die sich zum Glauben Abrahams bekennen und mit uns den einen Gott anbeten, den barmherzigen, der die Menschen am Jüngsten Tag richten wird.
Zunächst ist hier das ‚inklusive’ Modell der Hinordnung der Religionen auf das Gottesvolk thematisiert. Am nächsten stehen die Juden, gefolgt von den Muslimen und schließlich den übrigen religiösen bzw. suchenden Menschen. Sie alle können „das ewige Heil erlangen“ – auch ohne explizites Bekenntnis zu Jesus Christus. Im Hinblick auf den Islam werden fünf wesentliche Übereinstimmungen im Glauben genannt: die Anerkennung des Schöpfers, das Bekenntnis zum Glauben Abrahams, die gemeinsame Anbetung des einen Gottes, die Barmherzigkeit Gottes sowie die Erwartung des Gerichtes am Jüngsten Tag. Nach Ansicht des Konzils sollten diese Gemeinsamkeiten unstrittig sein und als Basis dafür dienen können, was das Konzil in NA 3 wünscht:
Da es jedoch im Laufe der Geschichte zu manchen Zwistigkeiten und Feindschaften zwischen Christen und Muslimen kam, ermahnt die Heilige Synode alle, das Vergangene beiseite zu lassen, sich aufrichtig um gegenseitiges Verstehen zu bemühen und gemeinsam einzutreten für Schutz und Förderung der sozialen Gerechtigkeit, der sittlichen Güter und nicht zuletzt des Friedens und der Freiheit für alle Menschen.
Die folgenden Ausführungen aus NA 3 zeigen in ihrer recht behutsamen wie kenntnisreichen Art der Darstellung des Glaubens der Muslime, dass man um eine wertschätzende Haltung bemüht ist:
Mit Hochachtung betrachtet die Kirche auch die Muslime, die mit uns den alleinigen Gott anbeten, den lebendigen und in sich seienden, barmherzigen und allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, der zu den Menschen gesprochen hat. Sie mühen sich, auch seinen verborgenen Ratschlüssen sich mit ganzer Seele zu unterwerfen, so wie Abraham sich Gott unterworfen hat, auf den der islamische Glaube sich gerne beruft. Jesus, den sie allerdings nicht als Gott anerkennen, verehren sie doch als Propheten, und sie ehren seine jungfräuliche Mutter Maria, die sie bisweilen auch in Frömmigkeit anrufen. Überdies erwarten sie den Tag des Gerichtes, an dem Gott alle Menschen auferweckt und ihnen vergilt. Deshalb legen sie Wert auf sittliche Lebenshaltung und verehren Gott besonders durch Gebet, Almosen und Fasten.
Die gemeinsame Anbetung des einen bzw. alleinigen Gottes weist wie schon in LG 16 auf die strikt theozentrische Perspektive des Konzils hin. Eine Anspielung auf den für muslimischen Glauben hochbedeutsamen „Thronvers“ (Vers 255 der zweiten Sure) liegt vor, wo Gott als „lebendig“, „in sich seiend“ und „allmächtig“ beschrieben wird. „Der zu den Menschen gesprochen hat“ spricht vorsichtig das brisante Thema der Offenbarung an und scheint den Islam als eine Religion göttlichen Ursprungs zu charakterisieren. Dass Muslime „seinen verborgenen Ratschlüssen sich mit ganzer Seele zu unterwerfen (mühen)“ ist eine treffende Umschreibung der Wortbedeutung von Islam. Ein Nebensatz („Jesus, den sie allerdings nicht als Gott anerkennen“) thematisiert vorsichtig die zentrale Differenz. Die Verehrung Gottes „besonders durch Gebet, Almosen und Fasten“ greift drei der „fünf Säulen des Islam“ auf. Schließlich kann auch das Bemühen der Muslime um eine sittliche Lebensführung gewürdigt werden.
Kritisch betrachtet werden kann die ‚Leistungsfähigkeit‘ der Konzilstexte. Der Islam wird ausschließlich selbstreferenziell wahrgenommen: Was an ‚Eigenem‘ beim ‚anderen‘ da ist, wird gewürdigt; was ‚den Islam zum Islam macht‘, bleibt in der Darstellung ausgespart.
Ganz grundsätzlich ist zunächst einmal nicht ausdrücklich vom Islam die Rede, sondern von den Muslimen bzw. vom islamischen Glauben. Die darin liegende Abstrahierung von der Religion des Islam als sozial verfasster, von Gott zur Überwindung aller Spaltungen gestifteten Gemeinschaft (umma), die einen integralen wie universalen Letztgültigkeits- und mithin Geltungsanspruch für die ‚eigene’, das Christentum ‚überholende‘ Offenbarung reklamiert, schlägt bei mehreren Einzelthemen durch: Die Sharia, das islamische Gesetz, bleibt unerwähnt; desgleichen die Wallfahrt mit ihrem – in symbolischer Abgrenzung nicht zuletzt gegenüber den Christen gewählten – Zentrum Mekka als eindrucksvolle Manifestation der weltweiten umma sowie der zweite Teil des Glaubensbekenntnisses des Islam („… und Mohammed ist sein Prophet“); es fehlt jede Bezugnahme auf den Propheten sowie auf die fundamentale Glaubensurkunde, den Koran. Dies relativiert die oben zitierte Rede von Gott, „der zu den Menschen gesprochen hat“, dahingehend, dass die Gültigkeit der Offenbarung Gottes im Islam in Frage steht.
Nach dem Konzil
Die Aussagen des Konzils werden in päpstlichen Stellungnahmen vertieft. Schon während des Konzils wird unter Papst Paul VI. 1964 das Sekretariat für die Nichtchristen (seit 1989: Päpstlicher Rat für den interreligiösen Dialog) eingerichtet. Damit wird der offizielle Dialog institutionalisiert und die theologische Forschung forciert. Die durch das Sekretariat 1969 veröffentlichten Richtlinien für den Dialog mit Muslimen werden später in einem weiterführenden Dokument aufgegriffen und 1985 in deutscher Übersetzung zugänglich.8 Erstmals nimmt hier ein offizielles katholisches Dokument ausdrücklich zur Person Mohammeds Stellung, der als „großes literarisches, politisches und religiöses Genie“ mit „gewisse(n) prophetische(n) Besonderheiten“ (79) beschrieben wird; der Koran habe „teil am Inhalt der biblischen Botschaft des Alten, ja sogar des Neuen Testaments“ (66); insgesamt sei der Islam einer der „zahlreichen und großen Versuche einer Suche nach Gott“ und als solcher als „Vorbereitung zur geistigen Annahme des Gottes Abrahams, Mose und Jesu“ (89) zu qualifizieren. Papst Johannes Paul II. kann 1985 anlässlich der Eröffnung eines katholisch-islamischen Symposions in Rom sagen: „Euer und unser Gott ist ein und derselbe und wir sind Brüder und Schwestern im Glauben Abrahams“9; im selben Jahr spricht er vor muslimischen Repräsentanten in Belgien vom gemeinsamen Streben der Christen und Muslime, „Gottes Willen entsprechend den Aussagen unserer jeweiligen Heiligen Schriften zu erfüllen“10; wiederholt ruft dieser Papst die Muslime zum gemeinsamen Einsatz für Gerechtigkeit und Frieden sowie zum gemeinsamen Kampf gegen den Geist des Materialismus auf; inständig mahnt er zum gemeinsamen Dialog. Dass bei den wiederholt herausgestellten Gemeinsamkeiten die Unterschiede respektvoll anzuerkennen sind, bringt das abschließende Zitat aus einer Rede Johannes Pauls II. 1985 vor Zehntausenden muslimischen Jugendlichen in Casablanca/Marokko zum Ausdruck:
Ich glaube, dass wir, Christen und Muslime, mit Freude die religiösen Werte, die wir gemeinsam haben, anerkennen und Gott dafür danken sollten. […] Die Loyalität verlangt aber auch, dass wir unsere Unterschiede erkennen und respektieren […].11