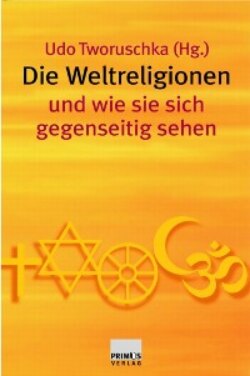Читать книгу Die Weltreligionen und wie sie sich gegenseitig sehen - Группа авторов - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Interreligiöser Dialog und wechselseitiger Blick
ОглавлениеEiner der sich herauskristallisierenden Schwerpunktbereiche der Praktischen Religionswissenschaft – neben der Lösung von durch Religion(en) (mit) bedingten Problemen, Religionsvermittlung, Religionskritik, aktiv-sozialem Erfahrungslernen – ist der interreligiöse Dialog. Statt einander die Kompetenzen an diesem von Religionswissenschaftlern oft beargwöhnten Geschäft zu bestreiten, sollten Theologen, Religionswissenschaftler und „Betroffene“ ihre unterschiedlichen Kompetenzen einbringen.
Die Begegnungsgeschichte der Religionen hat sich in unserem Jahrhundert dramatisch beschleunigt, und die Religionskarte der Welt muss an vielen Stellen neu gezeichnet werden. Mission ist nicht länger eine Einbahnstraße; denn lange schon haben die Religionen der Welt sich darangemacht, ihre Heilsangebote im Westen zu kommunizieren. Ein einschneidendes Datum ist das World Parliament of Religions (1893) in Chicago. „Dialog“ ist Signalwort für bestimmte Einstellungs- und Verhaltenstendenzen, emotional hoch besetzt, mit einem allerdings diffusen Bedeutungsfeld. In dem hier zu behandelnden Problemzusammenhang bezeichnet der Begriff wechselseitige kommunikative Prozesse auf mehreren Ebenen: interdisziplinäre Zusammenarbeit mit theologischen und nicht-theologischen Wissenschaften; die Relation von Religionswissenschaft und Religion(en); das Verhältnis der Religionen zueinander. Von bestimmten historischen Zeiten an ereignen sich Wechselbeziehungen zwischen den Religionen „in Herausforderungen und Antworten, Konvergenzen und Abhängigkeiten, Missionen und Verschmelzungen, Rezeptionen und Metamorphosen“9. Auf verschiedene Weise trägt Praktische Religionswissenschaft dazu bei, das Verhältnis der Religionen zueinander zu analysieren und ggf. zu verbessern. Zum Beispiel in der von der Religionswissenschaft weitgehend ausgeklammerten Schulbuchanalyse.10 Es ist wichtig, die gegenseitigen Einstellungen, Vorurteile und Stereotype11 wahrzunehmen. Die Religionswissenschaft kann die Entstehung und Weitergabe von durch Religionen bewirkten oder begünstigten, oft verhängnisvollen Einstellungs- und Wahrnehmungsmustern analysieren; sie kann darüber hinaus Hilfestellungen für Dialoge (auf unterschiedlichen Ebenen) leisten, indem sie allen Beteiligten ein umfassendes und differenziertes Bild der Religionen zur Verfügung stellt. Dieses Bild muss das Selbstverständnis der Religionen ernst nehmen, muss sich bemühen, das in ihnen begegnende Fremde nach Kräften vorurteilsfrei wahrzunehmen.
Die im vorliegenden Buch zitierten unterschiedlichen Quellen setzen sich aus ganz verschiedenen Textsorten zusammen und transportieren Eindrücke, Bilder, Vorstellungen, Meinungen, Urteile über andere Religionen. Dabei liegen nicht selten geschichtliche Strukturen „langer Dauer“ (longue durée) vor, die sich nur langsam oder gar nicht ändern. Aber auch von „Konjunkturen“ bestimmter Motive und Formulierungen kann gesprochen werden. Zu den im vorliegenden Band häufiger anzutreffenden Textsorten gehören: „Heilige Schriften“, Kommentarliteratur, theologische Kritiken, (fiktive) Dialoge, Widerlegungen, Apologien (Verteidigungsschriften) und Polemiken, Streitgespräche und Streitschriften, Zwangspredigten, Verwünschungen, Reiseliteratur, Briefe. Die Urteile bzw. Urteilsmuster sind nicht selten vorurteilshaft geprägt. Dabei muss genau hingeschaut werden, ob es sich dabei um echte Vorurteile handelt. Die Vorurteilsforschung unterscheidet verschiedene vom (echten) Vorurteil abzugrenzende Urteilsformen: Da gibt es Falschurteile, die auf einem leicht beweisbaren Irrtum über die andere Religion beruhen, verallgemeinernde Urteile und persönliche Werturteile. Mit Stigmatisierung bezeichnet man einen Vorgang, bei dem einer Person bzw. Gruppe eine negative, als sozialer oder kultureller Makel geltende Eigenschaft (Stigma) zugeschrieben wird.
Von einem Vorurteil spricht man erst dann, wenn ein falsches, generalisierendes, bewertendes und behauptendes Urteil als falsch bestimmt und sein Anspruch, wahr zu sein, als hinreichend widerlegt gelten kann, trotzdem aber an ihm festgehalten und es auch weiterhin mit einem Wahrheitsanspruch vertreten wird. Auf der Basis dieser Beschreibung sind zahlreiche Aussagen einer Religion A über eine Religion B tatsächlich Stigmata, Vorurteile bzw. Stereotype. Sie werden auch als emotional negativ/positiv besetzte Einstellungen bzw. Attitüden gegenüber bestimmten Handlungen, Gegenständen, Lehrmeinungen oder Mitmenschen verstanden, die sich weniger auf Erfahrungen (Informationen) als auf Generalisierungen stützen und relativ überdauernder Natur sind.12 Einstellungen bestehen aus kognitiven, emotional-affektiven und pragmatischen Komponenten. Ein Vorurteil13 erweist sich als stereotyp, wenn Personen bei ihren Urteilen über fremde Gruppen immer wieder auf bestimmten Vorstellungen und Wertungen beharren. Im Gegensatz zum Vorurteil, das sich nicht unbedingt sprachlich niederschlagen muss, sich daher auch nur in einem bestimmten Verhalten äußern kann, handelt es sich bei einem Stereotyp gewöhnlich um eine verbale Äußerungsform von Überzeugungen. Ähnlich wie das Vorurteil hat diese Überzeugung die logische Form eines Urteils, das ungerechtfertigt vereinfacht und mit einer emotional wertenden Tendenz einer Klasse von Personen Verhaltensweisen zu- oder abspricht.