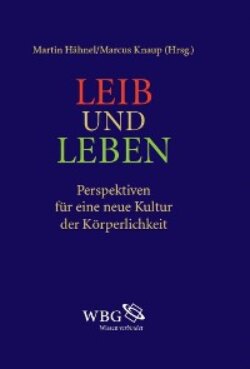Читать книгу Leib und Leben - Группа авторов - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3 Der Doppelaspekt von Körper und Leib als Grundlage des Handelns
ОглавлениеWenn alle Lebewesen, Menschen eingeschlossen, handeln müssen, um zu überleben, genügt es dann, die organischen Funktionen des Körpers ausschließlich naturwissenschaftlich zu beschreiben? Wie ist es möglich, dass sich qualifizierte Perzeptionen in zielgeleiteten körperlichen Bewegungen zum Ausdruck bringen, die die Erfüllung der Bedürfnisse ermöglichen? Die Einwirkung intentionaler Akte, von Zielen und Zwecken, Werten und Bedeutungen, auf physikalisch-chemisch zu erklärende Prozesse des Körpers ist, so wusste bereits Spinoza, nicht definiert. Ein Parallelismus, wie ihn nach Spinoza auch Leibniz konzipiert hat, ist nur denkbar, wenn es einen Seinsgrund gibt, der mechanische und zielgeleitete Prozesse ohne wechselseitige Einwirkungen miteinander korreliert. Ohne eine derartige Erklärung lassen sich zielgeleitete Aktionen nur verstehen, wenn diese physisch zum Ausdruck gebracht werden, wenn also die Physiologie des Körpers zum Träger sinnhafter, zielgeleiteter Bewegungen wird. Die Einheit seelisch-geistiger Prozesse mit körperlichen im Vollzug einer Handlung ist freilich nur denkbar, wenn das Physische nicht vollständig physikalisierbar ist.
Im Unterschied zu allen anderen materiellen Objekten kann man sich vom eigenen Körper nie vollständig distanzieren. Obwohl auch er den Gesetzen der Physik untersteht, wird bei einer Berührung nicht die physikalisch zu berechnende Kraftübertragung, sondern die Qualität der Empfindung und die mit ihr für den Lebensvollzug verbundene Bedeutung bestimmend für die Einstellung zu anderem. Unter allen Körpern, die wir kennen, erscheint nur der eigene zugleich als Teil der physischen Welt und als Medium qualifizierten Selbst- und Welterlebens.
Dass dem Menschen überhaupt beide Perspektiven zugänglich sind, beruht auf der Struktur seines Bewusstseins. Menschen erleben zwar, wie Tiere, ihre physischen Bedürfnisse, Empfindungen und Gefühle; doch anders als diese können sie sich gleichzeitig reflektierend von ihnen distanzieren. Erst dadurch entsteht die Möglichkeit, den erlebten Leib auch als Körper von außen zu betrachten und seine Funktionen wissenschaftlich zu objektivieren und zu analysieren. Alle anderen Lebewesen spüren zwar ihren Leib, aber sie nehmen ihn nicht als Körper unter einer Außenperspektive wahr.
Schon um zu überleben müssen Menschen sich, wie alle anderen Lebewesen auch, in ihrer Innerlichkeit ausdrücken und handelnd auf die Welt beziehen. Der Leib wird nicht durch äußerliche Reize und physikalische Kräfte zu einem bestimmten Ort bewegt, sondern aufgrund einer Vorstellung, dem Interesse an etwas oder der Angst vor etwas, weil also etwas als bedeutungsvoll erlebt wird. Die meisten Bewegungsabläufe sind zudem nicht angeboren, sondern müssen in zahlreichen, oft mühsamen Wiederholungen eingeübt werden, bis sie sich irgendwann quasi-automatisch und ohne bewusste Aufmerksamkeit vollziehen. Sie werden zu einer Art zweiter Natur, einem Habitus; sie sind eingekörpert und lassen sich nur durch wiederholte Erfahrungen oder bewusste Anstrengung wieder verändern. Nur deshalb kann man einen Menschen an seinem charakteristischen Gang, seiner Haltung oder seiner Art zu sprechen erkennen. Das Erleben der Innenwelt und die Bewegung des Sich-Ausdrückens vermittels des Leibes gehören untrennbar zusammen.
Darüber hinaus können Menschen ihre Stimmungen, Gefühle und Absichten auch vermittels einer historisch entwickelten und damit veränderbaren Codierung ausdrücken, durch Symbole. Ein sinnliches Medium, Farben, Töne, Laute oder Bewegungen werden zum Träger einer Bedeutung. Diese ist nur zufällig, aufgrund von Vereinbarungen oder Gewohnheiten mit dem sinnlichen Medium verbunden. Nur indem sich Zielgeleitetheit und Bedeutung vermittels des Leibes ausdrücken, sind Sprechen und Handeln möglich. Sie sind wiederum eine notwendige Bedingung des physischen Überlebens und der Kommunikation mit anderen. Vermittels des Leibes werden Gedanken, Absichten und Ideen auch für andere erkennbar. Als Leib bildet der Körper das Scharnier, an dem die Anforderungen der Umwelt und des eigenen Körpers in absichts- und bedeutungsvolle Handlungen transformiert werden. Ohne den physiologisch funktionsfähigen Körper wäre das seelisch-geistige und soziale Leben unmöglich; doch nur weil er als Leib zum Ausdruck von Innerlichkeit wird, sind zielgeleitete Aktionen ebenso wie die Kommunikation mit Anderen möglich.14
Sogar biologische Bedürfnisse wie Ernährung, Sexualität und Schutz werden nicht mehr unmittelbar ausgelebt, sondern weltweit in kulturell vermittelte Formen eingebettet. Damit unterstehen auch sie ethischen Reflexionen. Wie wenig die physiologische Befriedigung von Bedürfnissen genügt, um zu überleben, zeigt sich bereits daran, dass Menschen nicht nur psychisch, sondern auch physisch verkümmern und zugrunde gehen, wenn ein Mindestmaß an Zuwendung und Achtung fehlt. Den Menschen als rein biologisches Wesen gibt es daher nicht. Reduziert auf biologische Funktionen könnte er nicht als Mensch leben. Als Mitglied der ‚menschlichen Familie‘ sind Menschen daher schon in ihren biologischen Funktionen in einen kulturellen Kontext eingebettet. Vermittels des symbolischen Ausdrucks des Leibes sind sie als Naturwesen immer auch Teil der Kultur; diese ist ihrerseits auf die Ordnung der Natur und des Körpers angewiesen. Anthropologisch gesehen ist damit die Aufteilung des Menschen in einen funktionsfähigen biologischen Organismus und eine durch geistige Eigenschaften bestimmte Person hinfällig. In ethischer Hinsicht ist ein materialistischer Ansatz verfehlt, der davon ausgeht, dass, wie Brecht formulierte, ‚zuerst das Fressen kommt, dann die Moral‘. Aus demselben Grund kann die Umverteilung materieller Güter keine soziale Gerechtigkeit schaffen, wenn Menschen nicht die Befähigung haben, Güter zu schätzen und zu nutzen.15
Die Ordnung des Denkens und die Ordnung physiologischer Prozesse sind daher nicht streng voneinander getrennt. Sogar der genetische Code ist kein Programm, das die Entwicklung eines Lebewesens unabhängig von seinem Umfeld festlegt. Epigenetische Faktoren, zu denen biologische ebenso wie psychische und kulturelle Einflüsse gehören, beeinflussen, welche Gensequenzen an- oder abgeschaltet werden. Nicht allein die Gensequenz, sondern auch die Art und Weise ihrer Aktivierung ist mit entscheidend für die Entwicklung eines Individuums. Vermutlich werden einige Aktivierungsmuster sogar vererbt, so dass die einseitige Erklärung des menschlichen Verhaltens vom Geno- zum Phänotyp, die dem Neodarwinismus zugrunde liegt, korrigiert werden muss. Der Lebensstil insgesamt, Ernährungsgewohnheiten, Stressfaktoren, Werte, Ziele und Bedeutungen und die durch sie ausgelösten Emotionen und Entscheidungen beeinflussen nicht nur die physische Entwicklung des Individuums, sondern wohl auch die der folgenden Generationen.
Auch das Gehirn ist ein plastisches Organ, in dem zeitlebens durch neue Anforderungen und Zielsetzungen neuronale Verknüpfungen entstehen und andere abgebaut werden.16 Offensichtlich werden sogar noch neue Neuronen gebildet. Mit jedem geistigen Akt, mit jeder Absicht und jeder Vorstellung, wird immer auch der Leib mitgeprägt. Offensichtlich interagieren körperliche und seelisch-geistige Prozesse, physiologische Funktionen und erlebte Bedeutungen, so dass nicht nur der Geist, sondern auch der Leib biographisch einzigartig ist. Als erzähltes Leben ist der Leib Teil einer individuellen Biographie; umgekehrt ist Bewusstsein verkörpert; es ist inkarniert.
Die Bewegung des Sich-Ausdrückens ist freilich nur der erste, entscheidende Schritt zu einer Beziehung zu anderen. Interpretieren wir die Mimik eines Menschen, dann schließen wir nicht nachträglich und aufgrund eines Analogieschlusses vom Physischen auf seine psychische Verfassung. In der leiblichen Erscheinung manifestiert sich das seelische Erleben. Nicht die Physiologie des Körpers, sondern der Sinn des leiblichen Ausdrucks entscheidet, wie man sich zu seinem Gegenüber verhält. Dieser kann nicht physiologisch erklärt werden, sondern muss verstanden werden. Nur durch die Fähigkeit, sich vermittels des Leibes auszudrücken, können Menschen durch Gesten wie durch Worte überhaupt miteinander kommunizieren.
Auch für die Entwicklung von Kindern ist der körperliche Kontakt unverzichtbar, um ein Gefühl für sich selbst zu entwickeln. Bedeutung gewinnt die Präsenz andere Personen daher nicht erst mit dem erwachenden Selbstbewusstsein. Da sich die physische und die seelisch-geistige Entwicklung nicht voneinander trennen lassen, entwickelt sich die eigene Biographie von Anfang an in Beziehung zu anderen. Das Erste, was das Kind im Mutterleib spürt, ist, so betont Maurice Merleau-Ponty, „der Leib eines Anderen“17 mit seinen Gefühlen und seinem Verhalten. Doch erst wenn ein Kind im Alter von ein bis zwei Jahren beginnt, sich bewusst als unterschieden zu begreifen, ist mit der ‚Urdistanz‘18 auch die Voraussetzung für bewusste Begegnungen entstanden. Von ihrer körperlichen wie geistigen Verfasstheit sind Menschen daher auf interpersonale Beziehungen und damit auch in diesem Sinne auf leib-geistige Selbstüberschreitung angelegt. Dass es den Anderen gibt, weiß man nicht erst durch einen Analogieschluss vom eigenen Körper auf ein in äußerlicher Hinsicht ähnlich aussehendes Wesen. Es ist genau umgekehrt: Schon von sich weiß man nur aufgrund der Beziehung zu ihnen. In ihrer Unterschiedenheit sind Ich und Du von Anfang an aufeinander bezogen.19 Nicht die rein äußerliche, empirische Wahrnehmung des Anderen und dessen Objektivierung, sondern Selbsttranszendenz in Verbindung mit Empathiefähigkeit sind die Grundlage der biographischen Identität. Wie alle anderen Formen seelisch-geistiger Aktivitäten benötigt freilich auch die Möglichkeit, die Welt aus der Perspektive anderer zu sehen, sich in sie hineinzuversetzen, sie zu verstehen, sich mit ihnen zu freuen und zu leiden, eine physiologische Grundlage: die Spiegelneuronen. Dennoch ist die Fähigkeit zu Einfühlung und Mitgefühl nicht einfach vorhanden, sondern muss durch Prozesse der Interaktion, durch Beobachtung und Nachahmung, entwickelt werden.