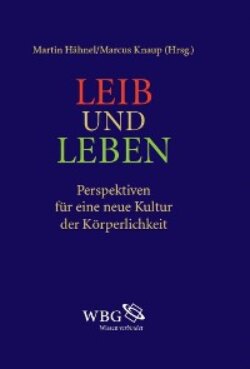Читать книгу Leib und Leben - Группа авторов - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Weil wir alle keine Engel sind –
Leib, Leben und Sinnlichkeit des Menschen 1 Leib-ER-leben
Оглавление„Die Leiblichkeit […] ist uns aufgegeben.
Sie gehört zu uns, seit wir die Bühne unseres Dramas betreten haben.
Ihren Sinn in diesem Drama gilt es zu verstehen.“1
Sie und ich sind keine Engel, also Individuen rein geistiger Natur. Anders als diese oder auch Gott, über den uns die biblischen Autoren sagen, er sei reiner Geist, haben wir nämlich einen Leib, dank dessen wir für uns selbst und für andere erreichbar sind. Alles, was wir tun, ist leiblich bedingt: ob wir essen, sprechen, Aufsätze schreiben, wandern oder Sex haben. Wir sind leiblich-strukturierte Wesen und kein Haufen Neuronen oder Gespenster.
Unser Leib ist nicht ein totes Etwas. Er ist lebendig. Wenn Sie z.B. einen langen Spaziergang hinter sich haben und erschöpft sind, wenn Sie ein Glas köstlichen Rotburgunder trinken, Freude oder Leid verspüren, können Sie dies leiblich erleben, ihren Leib spüren. Oder denken Sie mal daran, dass Sie von einem plötzlichen Regenschauer überrascht werden und Ihre eigene Ausgesetztheit in dieser Situation spüren: Ihre Kleidung ist durchnässt, Ihnen ist es kalt. Sie machen die Erfahrung, sich in einer bestimmten Weise selbst gegeben zu sein. Anders gesagt: Sie merken ganz deutlich, betroffen von dieser Situation zu sein und dass das Ganze Sie angeht. Sie können erleben, dass Ihr Leib zu Ihnen gehört und Sie zu Ihrem Leib.
Dank meines Leibes kann ich berühren und berührt werden, mich bewegen und auf etwas hinbewegen. Die PC-Tastatur auf meinem Schreibtisch kann ich abtasten: ihre Höhe, Länge und Breite. Sie ist undurchdringlich, leistet mir Widerstand. Dort, wo sich auf meinem Schreibtisch die Tastatur befindet, kann nicht gleichzeitig meine Hand sein: wohl auf ihr, unter und neben ihr. Ich kann die Tastatur berühren und spüren, während diese nicht spüren kann, auch wenn ich sie berühre und spüre. Im Berühren der Tastatur spüre ich mich als berührend. Ich erlebe nicht nur die Wärme des Computers, einen leichten Fett- und Staubflimmer, der sich auf die Tasten gelegt hat. Ich spüre dabei mich selbst, ich spüre mich in meiner Leiblichkeit. Bewege ich nun die andere Hand auch zur Tastatur und lege sie dann direkt auf die erste, dort bereits platzierte, dann spüre ich mich als spürend und als gespürt. Den Schreibtisch, auf dem meine PC-Tastatur platziert ist, kann ich umschreiten und so verschiedene Perspektiven einnehmen. Mein Leib gibt mir meinen „point of view“ bereits vor. Die PC-Tastatur bediene ich, um z.B. einen Text zu schreiben. Meinen Leib bediene ich nicht: Er gehört zu mir. Frische und Mattigkeit, zwei Beispiele, die wir alle wohl ganz gut kennen, sind auf den ganzen Leib bezogen. Nicht nur auf meine Hand, mein Bein oder mein Hirn.2 Wenn ich Hunger oder Durst habe oder mir dieses Buch auf den kleinen Zeh fällt und ich einen Schmerz erlebe, erlebe ich dies als meine Empfindung.
Wir können unser Lebendigsein am eigenen Leib spüren: So ist es uns beispielsweise möglich, unser „Leben in die Hand zu nehmen“, etwas zu planen und dann in die Tat umzusetzen. Ebenso können wir immer wieder feststellen, dass der Radius unserer Möglichkeiten mal größer und mal kleiner ist. Wir können vieles, aber nicht alles. Leiblichkeit und Lebendigkeit bedeuten so gesehen, Grenzen zu haben. Also gehört es zu unserer Leiblichkeit und Lebendigkeit, dass wir endliche Wesen sind. Wird der Leib „vernachlässigt oder falsch behandelt, so zeigen sich Störungen der leiblichen Funktionen, und es besteht zum mindesten die Gefahr, daß in der Folge auch das innere Leben gestört wird“. Der Leib, so Stein weiter, drängt sich mir befremdlich in den Vordergrund, „wenn etwas an ihm nicht in Ordnung ist. Dann besteht die Gefahr, dass er das Subjekt in sich hineinzieht“3.
Ende 2011 sorgte die Nachricht, die von einer französischen Firma angebotenen Implantate zur Brustvergrößerung seien von minderer Qualität, würden vergleichsweise schnell platzen und möglicherweise krank machende Stoffe absondern, auch in zahlreichen deutschen Haushalten für Besorgnis. Man darf mit Sicherheit vermuten, dass keineswegs alle der etwa 300.000 betroffenen Frauen ein derartiges Implantat nach einer Krebsoperation bekommen haben. Laut der Deutschen Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgen wurden 2011 in Deutschland eine halbe Million Schönheitsoperationen durchgeführt. Das sind doppelt so viele wie noch im Jahr 2006. Es wird gemacht und getan, Schmerzen auf sich genommen und vor allem viel Geld ausgegeben (im Jahr 2011 allein 800 Millionen Euro für Schönheitsoperationen4), um einen gestylten Superbody zu bekommen. Das betrifft Frauen wie Männer: „Der schöne Mann“ – lautete der Titel eines von 50 Studenten der Hochschule für Künste Bremen erarbeiteten Magazins, das im Januar 2012, pünktlich zur Berliner Fashion Week, erschienen ist. Inszeniert wird der Männerkörper, und auch ein schlanker, faltenfreier Jesus, der die Frage zu stellen scheint, wer der Schönste im ganzen Land ist, darf da nicht fehlen. Knapp 17 Prozent der Patienten, die sich heutzutage wegen einer Schönheitsoperation unters Messer legen, sind Männer. Bei der Gruppe der unter Dreißigjährigen sind es knapp 20 Prozent. Allein die Fitnessbranche konnte im Jahr 2011 vier Milliarden Euro Einnahmen verbuchen. Gernot Böhme macht einen Grundzug unserer Zeit darin aus, „Gegebenes in Gemachtes zu transformieren“5. Gerade dadurch werde unser Leib tendenziell zum Verschwinden gebracht. Der Körper wird zum quasi religiösen Kultgegenstand, zum vergegenständlichten Statussymbol und Projekt, der mit dem lebendig-dynamischen Leib nicht mehr allzu viel zu tun hat. Das, was ihn besonders (und auch liebenswert) macht, soll übertüncht, ausgebessert bzw. ganz abgeschnitten werden.
Wir wurden alle einmal geboren und müssen alle einmal diese Welt verlassen. Das, was lebendig ist, entsteht und vergeht. Ohne unseren Leib könnten wir gar nicht leben. Es ist aber auch nicht möglich, schneller zu joggen, als das Licht durch das All rauscht, oder (ohne künstliche Hilfsmittel) tiefer zu tauchen als ein Wal. Und wenn wir schon beim Thema Joggen sind: Stellen Sie sich vor, eine längere Zeit ein Fußballfeld zu umrunden. Ich nehme an, dass Ihnen das Atmen nun schwerfällt. Sie japsen nach Luft. In Ihrer Brust merken Sie, wie sich Spannung und Schwellung abwechseln. Ja, Sie können in dieser Situation ganz deutlich spüren, dass Ihr Leib ein bedürftiger ist und dass er in eine Umwelt eingebettet ist, mit der er (allein schon durch Luftaufnahme und Stoffwechsel) im ständigen Austausch steht. Eine ähnliche Erfahrung macht Leopold Bloom, eine Figur aus dem Roman Ulysses von J. Joyce, der während seines Toilettengangs liest:
„In Ruhe las er, seinen Drang noch unterdrückend, die erste Spalte und begann, schon nachgebend, doch mit Widerstreben noch, die zweite. Auf ihrer Mitte angelangt, gab er seinen letzten Widerstand auf und erlaubte seinen Eingeweiden, sich zu erleichtern, ganz so gemächlich, wie er las, und immer noch geduldig lesend, die leichte Verstopfung von gestern ganz verschwunden. Hoffentlich ists nicht zu groß, geht sonst mit den Hämorrhoiden wieder los. Nein, grade richtig. So. Ah! Bei Hartleibigkeit eine Tablette Cascara sagrada. Könnte alles im Leben so. Es bewegte oder berührte ihn nicht weiter, aber es war etwas Flottes und Sauberes. Drucken jetzt praktisch alles. Sauregurkenzeit. Er las weiter, gelassen über seinem eigenen aufsteigenden Geruch sitzend. Bestimmt eine saubere Sache. Matcham denkt noch oft an den Meisterstreich, durch welchen er die lachende Hexe gewann, die nunmehr. Fängt moralisch an und hört auch so auf. Hand in Hand. Gar nicht schlecht. Er überflog noch einmal, was er gelesen hatte, und während er ruhig sein Wasser abfließen fühlte, beneidete er freundlich Mr. Beaufoy, der das geschrieben und drei Pfund dreizehnsechs Honorar dafür bekommen hatte.“6
In diesem Textauszug wird sehr schön deutlich, dass beim Lesen unser ganzer Leib beteiligt ist. Wie Bloom sich bewegt und dann wieder still sitzt, seinen Drang unterdrückt und schließlich nachgibt, die Zeitung in seinen Händen hält und die Augen über die Druckerschwärze gleiten lässt, während er sich wundert, was alles gedruckt wird, ist miteinander verwoben. Bloom schmökert in der Zeitung: nicht ein Organ von ihm, sein Leib oder auch seine Seele. Er erlebt sich im Wechselspiel von Spannung und Schwellung.
Durch unsere leiblichen Erlebnisse haben wir einen Zugang zur Wirklichkeit. Mein Leib unterscheidet sich in seinem Lebensvollzug, seinem Spüren, seinen Bewegungen und Regungen von der erwähnten PC-Tastatur. Jene kann ich verlegen und suchen. Meinen Leib muss ich nicht suchen. Er ist mir unmittelbar gegeben. Kraft der unmittelbaren Zeugenschaft unseres Leibes, so Hans Jonas, können wir benennen, was kein körperloser Zuschauer zu sagen imstande wäre: „der Punkt des Lebens selber: dass es nämlich selbst-zentrierte Individualität ist, für sich seiend und in Gegenstellung gegen alle übrige Welt, mit einer wesentlichen Grenze zwischen Innen und Außen.“7
Aber wir erleben eben nicht nur unseren Leib. Unser Leib kann auch das ausdrücken, was in uns vorgeht: Das Spektrum reicht von A wie Angst bis Z wie Zorn. Im Alltag verlassen wir uns darauf, dass Blicke, Gesten und Bewegungen sinnvoll sind, eine Bedeutung haben, etwas zum Ausdruck bringen. Blicke können sprechen, sich auf das Gegenüber legen oder dieses „ausziehen“, ohne dass dabei irgendein Respekt gewahrt bliebe. Wenn sich z.B. ein junger Mann und eine junge Frau kennen lernen, können sie mit ihren Blicken flirten. Blicke können erotisch sein, aber z.B. auch voll von Eifersucht. Der Blick eines Menschen ist Ausdruck der Lebensvollzüge, des lebendigen Leibes, und daher nicht mit hochwertigen Hilfsmitteln zu vermessen. Er ist unteilbar – was ich von der PC-Tastatur und anderen Körpern nicht sagen kann. Dass mich zum Beispiel im Blick des Anderen „die Liebe auf den ersten (oder zweiten?) Blick“ trifft und ich mich von diesem Blick angesprochen und getragen weiß, kann auch mit den besten naturwissenschaftlichen Methoden nicht ausgesagt werden. Wenn wir Emmanuel Lévinas Glauben schenken wollen, dann liegt die „beste Art, dem Anderen zu begegnen, […] darin, nicht einmal seine Augenfarbe zu bemerken. Wenn man auf die Augenfarbe achtet, ist man nicht in einer sozialen Beziehung zum Anderen“, denn, so Lévinas weiter, „das, was das Spezifische des Antlitzes ausmacht, ist das, was sich nicht darauf reduzieren lässt.“8 Und an anderer Stelle schreibt er: „Phänomenologisch ist die Seele […] das, was sich in dem nicht verdinglichten Angesicht, im Ausdruck zeigt.“9
Hat es eine Person „erwischt“, ist sie verliebt, ist der Leib daran alles andere als unbeteiligt und ein stummer Zeuge: Das Aussehen und die Stimmlage des Anderen, der Blick und ebenso der (Achsel-)Geruch als Pheromon spielen eine nicht unwichtige und keineswegs immer bewusste Rolle. Das Verliebtsein trifft mich vom Anderen her. Durch die Anmut des Anderen, den Blick, die leibliche Gestalt und Haltung erlebe ich mich selbst als leibliches Wesen. Am Leib des Anderen kann ich etwas über den eigenen Leib erfahren. Im Volksmund ist von „Schmetterlingen im Bauch“ die Rede. Das heißt wohl, sich im Angesicht des Anderen selbst lustvoll spüren zu können. Wir können uns in andere einfühlen und müssen nicht erst angestrengt darüber nachdenken, ob unser Gegenüber auch tatsächlich ein Mensch ist oder nicht. Der leibliche Ausdruck hilft uns diesbezüglich weiter und verrät etwas über diesen Menschen. In der Begegnung mit einem anderen Menschen ist sein leiblicher Ausdruck von ganz entscheidender Bedeutung und nicht seine Knochendichte, seine Leberwerte oder die Größe seines Gehirns. Der leibliche Ausdruck des Menschen eröffnet uns die Möglichkeit, einander zu begegnen und anzunehmen. Das leiblich strukturierte Subjekt und nicht das Gehirn hat eine Wirklichkeit.
Vermittels meines Leibes kann ich mentale Lebensäußerungen (bewusst oder unbewusst) zum Ausdruck bringen: in meinen Bewegungen, in meiner Mimik und Gestik. Aber auch im gesprochenen Wort. Wenn ich spreche, geschieht dies durch meinen Leib, was einen interessanten Vergleich nahelegt: Ein Wort hat eine notwendige materiale Voraussetzung. Im Wort können wir Sinn entdecken. So ist es auch beim Leib. Auch hier treffen wir auf Sinn: das, was ihn zusammenhält, ausmacht. Kurz: das Seelische.10 Unsere Geistbegabtheit kann sich im Leib ausdrücken. Ein mittelalterlicher Denker wie Thomas von Aquin hat dafür auch eine Begründung: „Anima forma corporis“11, sagt er. Leib und Geistseele sind laut seiner Auskunft bei uns zu einer vollständigen, einzelnen Natur miteinander verbunden. „Suppositum rationale“ nennt er das. Der Mensch ist weder reiner Geist (wie Gott und die Engel) noch bloße Materie, sondern durchseelter Leib, Person.12
Unsere physischen Prozesse sind wichtig und notwendig für unser Lebendigsein. Sie sind aber nicht hinreichend dafür. Organische Vollzüge können heute sehr gut untersucht, kontrolliert und technisch gesteuert werden. Leiblichkeit und Lebendigkeit bekommt man dadurch aber noch nicht in den Griff. „Was den Leib von einem bloßen Körper unterscheidet, ist, dass es ein beseelter Körper ist. Wo Leib ist, da ist auch Seele. Und umgekehrt: Wo Seele ist, da ist auch Leib. Ein Stoffding ohne Seele ist nur Körper, nicht lebendiger Leib. Ein Geistwesen ohne körperlichen Leib ist reiner Geist, nicht Seele.“13 Das Seelische durchdringt den Leib und wird in ihm gesehen. Unsere Seele versteckt sich gerade nicht in irgendwelchen Neuronennetzen – wo sie eingefangen werden könnte –, sondern drückt sich in der gesamten Leibesgestalt aus. Leib und Seele gehören so zusammen, wie Ausdruck und Ausgedrücktes zusammengehören: „[D]as eine ist nicht bloß Äußeres, sondern beseeltes Äußeres, das andere nicht bloß Inneres, sondern sichtbar zu Tage tretendes Inneres.“14 Jeder Mensch ist eine leib-seelische Einheit, eine lebendige Ganzheit. Im Alltag gehen wir ganz selbstverständlich davon aus. Oder haben Sie sich schon einmal mit einem Freund oder einer Freundin verabredet und versprochen, bei der Gelegenheit mal Ihren Leib mitzubringen?15