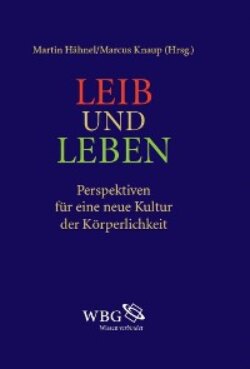Читать книгу Leib und Leben - Группа авторов - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Anmerkungen
Оглавление1 Tischner (2010), 97.
2 Vgl. Schmitz (1985), 79; Schmitz (1995), 117ff.; Stein (2004a), 122f.
3 Stein (1962), 176; vgl. Stein (2004a), 89. Bill Clegg gibt in seinem Buch Portrait of an Addict as a Young Man einen ebenso schonungslosen wie literarisch tiefgründigen Einblick in das Leben eines jungen, erfolgreichen Mannes, dessen Leben sich nur noch um die Droge „Crack“ dreht. Es ist seine eigene Geschichte, eine Geschichte der Selbstzerstörung von Leib und Leben. Direkt zu Beginn des Buches beschreibt er die durch Drogenmissbrauch hervorgerufene Unkontrollierbarkeit des Leibes: „Mark ist voll drauf und blafft nie gehörte Weisheiten von der Kante seines schwarzen Vinylsofas. Er fuhrwerkt herum wie ein dreifach beschleunigter Gehörlosendolmetscher – die Hände flattern, die Schultern und die Arme zucken. Die Beine sind auch in Aktion, werden unter seinem langen, dürren Gestell aber nur in regelmäßigen Abständen anders übereinandergeschlagen. Nur das Beinekreuzen läuft bei Mark einigermaßen geordnet ab. Der Rest ist eine Orgie von plötzlichen Bewegungen und Krämpfen, wie bei einer Marionette, die einem brutalen Puppenspieler ausgeliefert ist. Seine Augen sind, wie meine auch, mattschwarze Murmeln.“ (Clegg 2010, 9) Die Selbstbewegung funktioniert nur noch eingeschränkt. Hände, Arme und Schultern „flattern“. Er „funktioniert“ wie eine fremdbewegte Marionette: Gelenke, Hände und Gliedmaßen scheinen „nicht von Leben erfüllt“ (ebd., 12) zu sein, an Schnüren zu hängen wie „die „Puppenspielversion eines Goldgräbers […], der seine Wanne fieberhaft nach Goldstäubchen absucht.“ (Ebd., 12) Der Blick ist getrübt, zeigt die zunehmende Zerstörung von Leib und Leben: „Er sieht aus wie über sechzig – graues Gesicht, Runzeln, vorstehende Knochen –, ist angeblich aber Anfang vierzig.“ (Ebd., 11) Der Glanz in seinen Augen ist verloren gegangen. Wie das Geld seinen Taschen entschwindet, so „das letzte bisschen Farbe aus den Augen, das Leben aus dem Körper.“ (Ebd., 17) Durch den Drogenkonsum scheint der Leib unablässig wie unter Strom zu stehen. (Vgl. ebd., 25) Im wahrsten Sinne des Wortes zwingt ihn die Droge in die Knie: „Crackrauchen zwingt mich immer in die Knie, so dass ich manchmal stundenlang auf Teppichböden, Läufern, Linoleum oder Fliesen herumrutsche, Katzenhaare, Fusseln und Dreck genauestens durchsiebe und wie ein Irrer den Boden nach Bröseln [Crackstückchen, M. K.] abtaste.“ (Ebd., 38)
4 Vgl. Ahr (2012), 17.
5 Böhme (2003), 75.
6 Joyce (1975), 97.
7 Jonas (1997), 149.
8 Lévinas (1996a), 64f.
9 Lévinas (1996b), 21.
10 Vgl. auch Merleau-Ponty (1966), 217.
11 Thomas von Aquin: De veritate q 13 a 4 c.
12 Unter „Seele“ versteht er die substantielle, einzige und totale Form des Leibes. Sie ist (wie er im Anschluss an Aristoteles sagt) sowohl das Prinzip des vegetativen Lebens wie auch höherer mentaler Lebensäußerungen des Menschen.
13 Stein (2006), 313.
14 Stein (2004b), 122.
15 Vgl. Whitehead (2001), 149.
16 Jonas (1997), 169.
17 Aus diesem „Freiheitskeim“ sind in der langen Entwicklungsgeschichte schließlich höher stehende Formen von Freiheit erwachsen. Es kennzeichnet den Menschen als animal rationale, die eigenen Handlungsziele hinterfragen und gegebenenfalls auch verabschieden zu können, was mal besser und mal schlechter gelingen mag. Eine wichtige Voraussetzung dafür stellt die Entwicklung seines Gehirns, das ja ein Teil seines Leibes ist, dar.
18 Jonas (1992), 19.
19 Haugeland (1985), 2.
20 Vgl. hierzu: Scheutz (2003), 13–32, bes. 22.
21 Kather (2003), 25.
22 Gierer (1998), 99. Verwiesen sei auch auf Lenzen (1997), 35–46, bes. 45f.
23 Libet (2005), 264.
24 Ebd., 264.
25 Searle (2006), 57.
26 Vgl. Searle (2001).
27 Husserl (1984), 71.
28 Vgl. hierzu: Hell (2000), 144; Damasio (2005); LeDoux (1996).
29 Fuchs (2008), 140.
30 Dieser Aspekt wird von Gerhard Roth gar nicht berücksichtigt. Er hat den Gesamtorganismus,die Dimension der Leiblichkeit, leider nicht im Blick. Er fragt nur, wo und wie z.B. im Gehirn Gefühle entstehen. (Vgl. Roth (2001), 5–10) In seinem Buch Persönlichkeit, Entscheidung und Verhalten betont Roth im vierten Kapitel, dass „die Persönlichkeit im Gehirn und im weiteren Sinne im peripheren Nervensystem verankert“ sei (Roth (2009), 88). Im sechsten Kapitel fragt er, wo im Gehirn Vernunft (ebd., 138–141) und wo Gefühle (ebd., 141–166) sitzen. Man könne, so Roth, „den orbitofrontalen Cortex als ‚Sitz‘ von Moral, Ethik und Gewissen ansehen“ (ebd., 140). Eine freie, geistige Person, die Gefühle hat, sich aus diesen oder jenen Gründen für etwas entscheidet und sich nach moralischen Maßstäben ausrichtet, benötigt Roth nicht, da im Zuge seiner Verkürzung des Menschen auf das Gehirn dieses diese Rolle übernehmen muss.
31 Cruse (2004), 223–228.
32 Ebd., 223f.
33 Ebd., 224.
34 Vgl. Levine (2001), 79–105.
35 Vgl. hierzu Kutschera (2011), 234–244.
36 Damasio (2006), 387.
37 Rager (2003), 49; vgl. Fuchs (2006), 3–14, bes. 3, 9, 13.
38 Fuchs (2008), 134; vgl. auch Damasio (2006), 387.
39 Fuchs (2006), 3; vgl. auch Fuchs (2011), 145–164.
40 Fuchs (2008), 9.
41 Tischner (2010), 130.
42 Die mit der Leiblichkeit gegebenen Bewegungsvermögen und Lebensvollzüge des Menschen entfalten sich in der lebendigen Beziehung mit anderen Menschen. Im Wiegenalter können wir noch nicht laufen, wandern, springen. Das müssen wir erst alles lernen. Ganz langsam und mit viel, viel Anstrengung. Allein könnten wir dies wohl nicht. Hierfür sind das Beispiel von und der Umgang mit Anderen unerlässlich.
43 Marion (2011), 19.
44 Ebd., 22.
45 Es gibt heutzutage eine Reihe von Techniken, die auf eine krasse Loslösung von leiblicher Hingabe und Zeugung von Nachkommen abheben. Etwas anderes soll an die Stelle des leiblichen Liebesaktes treten. Diese vermeintlichen „Fortschritte“ sind m. E. Ausdruck einer sehr verkürzten Sicht vom Menschen, einer Einstellung, welche die Leiblichkeit abschreibt und den Menschen dadurch in den Griff zu bekommen versucht, dass außerhalb des Leibes von Mann und Frau Handlungen von Dritten durchgeführt werden, deren intellektuelle und technische Kompetenzen über das Wohl und Werden eines Menschen bestimmen und die ‚Gabe‘ des Lebens zu einem Machwerk der Technik herabwürdigen.
46 Kein Geringerer als Johannes Paul II. beschreibt, was dies für den Mann bedeutet: „Der Mann wird nicht nur durch sie, die sich ihm als Person und Frau schenkt, bereichert, sondern auch durch seine eigene Selbsthingabe. Das Sich-Schenken von Seiten des Mannes als Antwort auf die Hingabe der Frau ist für ihn selbst eine Bereicherung; denn hierin äußert und bekundet sich gleichsam das spezifische Wesen seiner Männlichkeit, das durch die Wirklichkeit des Leibes und des Geschlechts die innerste Tiefe des ‚Besitzes seiner selbst‘ erreicht, dank der er sowohl zur Selbsthingabe als auch zum Empfang der Hingabe des anderen fähig ist. Der Mann nimmt also nicht nur das Geschenk an,sondern wird zugleich von der Frau als Geschenk aufgenommen, wobei das innere geistige Wesen seiner Männlichkeit zusammen mit der ganzen Wahrheit seines Leibes und Geschlechts offenbar wird. Durch diese Annahme und Aufnahme des Geschenks seiner eigenen Männlichkeit bereichert er sich selbst. In der Folge wird diese Annahme, in welcher der Mann sich durch die ‚aufrichtige Hingabe seiner selbst‘ wiederfindet, in ihm zur Quelle einer neuen und noch tieferen Bereicherung der Frau durch ihn. Der Austausch ist wechselseitig, und darin offenbaren sich und wachsen die wechselseitigen Wirkungen der aufrichtigen Hingabe und der Selbstfindung.“ Johannes Paul II. (1985), 142. Zu diesem Thema siehe auch: Gahlings (2006).
47 Der nackte Leib ist eben auch in besonderer Weise verletzlich, zeigt die Verwundbarkeit und Endlichkeit der Person. Denken wir nur an die Bilder der bekleideten amerikanischen Soldaten vor einem Berg nackter Leiber misshandelter Gefangener im Gefängnis von Abu Ghraib.
48 Der pornographische Blick auf den nackten Leib verkürzt die Person auf ihre Sexualität. Die personal-geistige Liebes- und Hingabefähigkeit gibt es hiernach nicht. In den allermeisten Fällen ist es wohl der Leib der Frau, der zu einem entblößten Körper-Objekt der Begierde gemacht wird. „Der Körper einer Frau im zentralen Teil eines Pornomagazins: Sie spreizt ihre Schenkel und starrt in die Kamera. Mit ihrer Zunge leckt sie sich die Lippen. Ihre Augen sehen nirgendwohin. Sie ist nicht menschlich. Mit ihren Händen zieht sie ihre Schamlippen auseinander, so wie man(n) es mit den Lippen eines Pferdes tun würde, das auf einer Auktion angeboten wird. Sie zeigt, was sie zu bieten hat. Sie ist dekoriert und hübsch zurechtgemacht. Sie trägt weiße Socken, mit weißen Perlen verzierte Spaghetti-Schuhe. Ihre Haare sind in unnatürlichem Blond gefärbt. Sie ist ganz in weiß dekoriert. In ihrem Anblick sind alle Zeichen von Abwesenheit lesbar. Ihre ‚Weißheit‘ öffnet einen leeren Raum im Geist. Sie ist ein ‚Blondchen‘. Abgesehen von aller Dekoration, ist sie nackt. Sie bietet sich der Kamera dar vor dem Hintergrund von blauem Satin. Jetzt öffnet sie ihre Lippen,dann hebt sie ihren Po der Kamera entgegen …“ Griffin (1981), 36.
49 Fuchs (2000), 18f.
50 Tischner (2010), 121.
51 Hierzu: Virilio (1996); Fuchs (1997), 182–203; Roessler (2006); Wendel (2008), 335–345.
52 Stein (1962), 176.