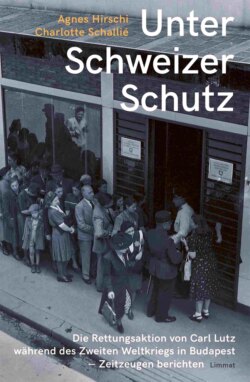Читать книгу Unter Schweizer Schutz - Группа авторов - Страница 7
Oral History – Gespräche mit Geretteten und Zeitzeugen
ОглавлениеDie in diesem Buch vorliegenden Berichte bzw. Zeugnisse von Holocaust-Überlebenden und Zeitzeugen sind über einen Zeitraum von 25 Jahren (1995–2020) in Israel, Ungarn, der Schweiz, Grossbritannien, Kanada und den Vereinigten Staaten erfasst und gesammelt worden. Den Begriff «Zeugnis» verwenden wir dabei nicht in seiner juristischen Bedeutung, sondern fassen ihn, um den multiplen methodologischen Ansätzen gerecht zu werden, in weitem Sinn als «Weitergabe von Informationen, für die sowohl ein innerer, unbeugsamer Druck sie mitzuteilen besteht als auch eine äussere Bereitschaft und ein Verlangen, diese zu empfangen»19.
Nachfolgend steckt François Wisard, Leiter des Historischen Dienstes beim EDA, den historischen Zeitrahmen ab, der die Rettungsmassnahmen von Carl Lutz in den Kontext anderer Rettungseinsätze durch Diplomaten und das Internationale Rote Kreuz in Budapest während des Kriegs stellt. Wisards Überlegungen zu den höchst komplizierten Rettungsmissionen unter Schweizer Leitung führen uns zum ersten Kapitel, das Zeugnisse ehemaliger Mitglieder von vier zionistischen Jugendbewegungen vorstellt: Bne Akiva, Hanoar Hazioni, Haschomer Hazair und Hechaluz. In diesem Kapitel ist auch der Zeugenbericht eines Nichtjuden enthalten, Paul Fabry. Fabry, der zum militärischen Widerstand gehörte, stellte eine Truppe zusammen, die vorgeblich mit der Bewachung des Glashauses beauftragt war. Während die falsche Militäreinheit vortäuschte, die Insassen des Glashauses gefangen zu halten, schützten er und seine Soldaten in Wirklichkeit die jüdischen Bewohner vor Angriffen und Verhaftungen durch die Pfeilkreuzler. Sein Bericht erinnert uns daran, wie viele individuelle Widerstandsaktionen zu den von der Schweiz geführten Rettungsmissionen beigetragen haben: «Es gab keinen einzigen geretteten Juden, ohne dass nicht Dutzende andere daran beteiligt waren. Da war derjenige, der ihn ins Haus hereinliess, derjenige, der ihn zum Taxi brachte, derjenige, der ihm ein bisschen Kleingeld oder etwas zu essen gab, derjenige, der mit gefälschten Bescheinigungen von einem Ort zum andern rannte, derjenige, der den Telefonanruf machte, um ihm zu sagen, er soll fliehen. Es war eine Kette von Ereignissen, und eine einzige Sekunde konnte von Bedeutung sein. Wo konnte in dieser Sekunde jemand helfen? War jemand da, der einem zu Hilfe kam? War jemand da, der einem dieses Papier gab? Niemand konnte allein tausende Verfolgte retten. Und das trifft auch für Lutz zu. Lutz war ein Held, aber er brauchte Hunderte andere, die ihm halfen.»
Im zweiten Kapitel werden Lebensgeschichten nachgezeichnet, die auf Interviews mit Überlebenden und deren Nachkommen beruhen. Diese Porträts von Geretteten – die Gespräche, auf denen sie basieren, wurden mit einer Ausnahme alle von Agnes Hirschi geführt – sind weitgehend in der dritten Person gehalten um hervorzuheben, dass diese mündlich erfragten Lebensgeschichten durch die Augen der GesprächspartnerInnen reflektiert werden. Diesem gemeinschaftlichen Ansatz zwischen Interviewern und Befragten liegt die Überzeugung zugrunde, dass die Erinnerungen der Zeugen nicht in einem abstrakten Vakuum existieren, sondern in einem dialogischen Rahmen gegenseitig konstituiert und vermittelt werden.20
Das dritte Kapitel enthält Zeitzeugengespräche, die von Noga Yarmar, Charlotte Schallié, Daniel von Aarburg und Daniel Teichman geführt wurden.20 Ein Grossteil der Gespräche sind «narrative Interviews», die auf Video aufgezeichnet wurden. Dies bedeutet konkret, dass wir zu Beginn des Gesprächs Leitfragen stellten, danach den Redefluss aber nicht mehr unterbrochen haben. Wenn noch zusätzliche Erklärungen vonnöten waren, haben wir diese gestellt, nachdem die Zeitzeugen ihre Lebensgeschichten zu Ende erzählt hatten. Im Rahmen seines Filmprojektes «Carl Lutz – Der vergessene Held» hat Daniel von Aarburg biografische Interviews geführt, das heisst, er hat sowohl Leitfragen als auch offene Fragen gestellt. Daniel Teichmans Beitrag gibt ein persönliches Gespräch zwischen Vater und Sohn wieder.
Carl Lutz in seinem Büro, Bregenz, Österreich 1960
Wir befragten Überlebende, die im Jahr 1944 noch im Kleinkindalter waren; andere Überlebende, die uns ihre Erinnerungen anvertrauten, waren damals bereits erwachsen und an der Rettungsmission mitbeteiligt. Angesichts dieser grossen Altersspanne variieren die Erinnerungen stark: Einige reflektieren die Wahrnehmung eines Kindes, andere werden aus der Erwachsenenperspektive geschildert und dabei in Zusammenhänge eingebettet, die stark von nachfolgenden Ereignissen und «Folgeerfahrungen»21 geprägt sind.
Während der Gespräche mit den Zeitzeugen achteten wir darauf, aufmerksame und engagierte Zuhörerinnen zu sein und uns so wenig wie möglich einzumischen, um den Erinnerungsprozess zu respektieren, der sich oft als «Bewusstseinsstrom» vollzog. Wir orientierten uns an den vom USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education entwickelten Leitfäden und den vom United States Holocaust Memorial Museum vorgeschlagenen Richtlinien für Interviews. Sämtliche Überlebende, die persönlich befragt wurden, zeigten ein dringendes Bedürfnis, Zeugnis abzulegen – und brachten dies oft schon bei der ersten, telefonischen Kontaktaufnahme deutlich zum Ausdruck. Wenn das Erinnern aufgrund des fortgeschrittenen Alters der Überlebenden schwieriger war, baten wir ihre Ehepartner und Kinder, beim Gespräch zu vermitteln. In solchen Situationen wurde das Format an die individuellen Bedürfnisse und Umstände angepasst, und es entwickelte sich ein gemeinschaftliches Erinnern von Überlebenden und ihren Familienmitgliedern.22
Das vierte Kapitel enthält schriftliche Selbstzeugnisse, die von Überlebenden oder deren Nachkommen verfasst und zum Teil durch Interviews ergänzt wurden. Sowohl in den mündlichen wie auch in den schriftlichen Selbstzeugnissen erinnern sich einige Überlebende lebhaft und detailliert an die Ereignisse von 1944 und 1945, während andere die Erinnerung mit philosophischen und historischen Reflexionen verweben, die auf jahrelangen Recherchen und der Beschäftigung mit der Vergangenheit beruhen.
Im fünften Kapitel versammeln wir Hommagen und Briefe an Carl Lutz, die Agnes Hirschi – Journalistin, Holocaust-Überlebende und Stieftochter von Carl Lutz – über viele Jahre hinweg von Überlebenden erhalten hat.
Die Transkripte der Gespräche, die auf Deutsch, Hebräisch, Ungarisch und Englisch geführt wurden, sind für die Buchausgabe bearbeitet und gekürzt worden. Die schwierige Aufgabe, einen mündlichen Bericht in ein schriftliches Dokument zu übertragen, erforderte weitere gemeinsame Anstrengungen von Überlebenden, InterviewerInnen, ÜbersetzerInnen, RedakteurInnen und LektorInnen. Obwohl die Erinnerungsprozesse zyklischen und sich wiederholenden Mustern folgen, haben wir uns bei allen Berichten und Zeugnissen für eine lineare Erzählstruktur entschieden. Um ein teambasiertes Modell der Zusammenarbeit umsetzen zu können, haben wir alle einen Ansatz gewählt, der dem komplexen Zusammenspiel von Inhalt, Erinnerungsprozess und Formgebung grosse Aufmerksamkeit schenkt.
Die Arbeit unserer MitherausgeberInnen (Daniel Teichman, Noga Yarmar, Dahlia Beck, Daniel von Aarburg) war ein integraler Bestandteil dieses Projekts. Aus diesem Grund haben wir am Schluss einen Anhang mit ihren Anmerkungen hinzugefügt, damit die Art unseres gemeinsamen Vorgehens so transparent wie möglich wird.
Juli 2020