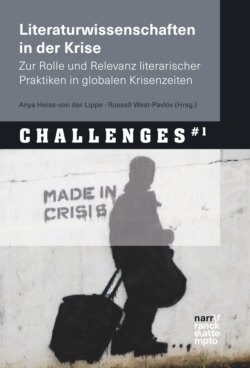Читать книгу Literaturwissenschaften in der Krise - Группа авторов - Страница 13
2 Literatur, Wahrheit, Menschsein
ОглавлениеJohn K. Noyes (übersetzt von Lukas Müsel)
Die Literatur ist ein Laboratorium, das die Idee eines gemeinsamen Menschseins entwickeln und in Beziehung zu Vielfalt und Differenz setzen soll. In beiden Fällen handelt es sich um nicht ganz klar umrissene, veränderbare Konzepte. ›Menschsein‹ ist eine Abstraktion, die auf unterschiedlichste Art und Weise erreicht werden kann (meistens dadurch, dass jegliche Vielfalt negiert wird); Vielfalt selbst ist eine scheinbar unendliche Spezifizierung bestimmter Erscheinungen. Die Dialektik von Gleichheit und Unterschiedlichkeit, die das literarische Labor antreibt, wohnt der literarischen Form strukturell inne. Die lyrische Stimme ist gänzlich erfüllt vom Reiz des Klanges, der beständig zwischen einem Bereich innerhalb der Bildlichkeit und einem Ort jenseits ihrer Grenzen hin und her pendelt. Die dramatische Aufführung funktioniert über ein Momentum der Identifikation, durch das spezifische Gesten und Äußerungen der Schauspieler erst Bedeutung erlangen. Der Roman, in seiner klassischen Form, lebt von den Spannungen zwischen verschiedenen universalen narrativen Strukturen (wie beispielsweise dem allwissenden Erzähler) und den Stimmen oder berichteten Gedanken der individuellen Figuren. All diese narratologischen und poetischen Mittel erlauben es uns, von einer ästhetischen Erscheinung zu sprechen, die sich durch die fundamentale Unsicherheit eines gemeinsamen Menschseins in der Moderne auszeichnet. Vielleicht entstand und besteht Literatur aufgrund genau dieser Ungewissheit.
Im Westen sind ›gemeinsame Menschlichkeit‹ und ›Vielfalt‹ Konzepte, die sich – wie auch immer sie verstanden werden mögen – durch die langzeitige Parallelentwicklung von säkularem Weltbürgertum und christlicher Mythologie entwickelten. Das heutige Problem von Menschlichkeit und Vielfalt entstand aus einer kürzeren (aber dennoch jahrhundertelangen) Geschichte, die zunächst von Europa und später von den Vereinigten Staaten dominiert wurde – eine Geschichte der Säkularisierung, der Technologie und der Expansion des Kapitals. Literatur wie wir sie heute verstehen – mit all ihren Wachstumsschüben, Verzögerungen; mit ihrer Selbstbezüglichkeit, ihren Kontextualisierungen und historischen Schwachpunkten – entwickelte sich parallel zu dieser langen Geschichte. Da das Konzept eines gemeinsamen Menschseins zunehmend in den Einflussbereich der Weltwirtschaft und der Finanzialisierung des Lebens rückte, gerieten Konzeptualisierungsversuche von Gleichheit und Ungleichheit in Widerstreit mit der Homogenisierung des Lebens, die dieses globale System hervorruft. Die immer wieder hart geführten Kämpfe um die Relevanz und das Fortbestehen der Literatur (und die institutionellen Strukturen, die sie unterhält) sind in sich selbst Ausdruck eines formalen Auswegs; einer Flucht vor dem, was wechselweise das verwaltete Leben, die Systematisierung des Lebens, die Instrumentalisierung des Lebens, etc. genannt worden ist. Dass die Formen einer solchen Flucht vielleicht mit einem fortwährenden Wettrennen um nicht börsenfähige Innovationen einhergehen, ist nicht überraschend; genauso wenig ist es überraschend, dass dies ein Rennen ist, dessen Sieger nur rundenweise bestimmt werden können – denn der Wettbewerb selbst kann nicht gewonnen werden.
Aus diesem Blickwinkel gesehen, verbindet die offizielle Institution der Literatur und ihre institutionalisierte Analyse eine interessante Beziehung. Während Beobachtung, Interpretation und Kommentar methodologische Grundpfeiler einer Vielzahl an Disziplinen sind (sowohl in den Geisteswissenschaften wie auch in den Naturwissenschaften), ist die sture Verweigerung, Erkenntnis als finanzfähig zu erweisen, genau das, was die ›eigentliche Literaturwissenschaft‹ bestens beschreibt. Ich sage ›eigentliche Literaturwissenschaft‹, weil es durchaus auch einige institutionelle Formen der Literaturanalyse gibt, die so hart wie möglich darum kämpfen, ihren eigenen Wert auf eben der Skala der Naturwissenschaftler zu messen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Förderwürdigkeit der ›Digital Humanities‹. Die ›eigentliche Literaturwissenschaft‹ ist, sollte sie mit den Naturwissenschaften verglichen werden, eine Art Grundlagenforschung. Sie schlägt Modelle und Methoden vor, deren Ergebnisse ungewiss, unvorhersagbar und in den meisten Fällen finanziell wertlos sind. Die institutionalisierten Modelle und Mechanismen, die der Literaturanalyse geldwirtschaftlichen oder (eher) finanziellen Wert zuweisen, werden immer ausgeklügelter – und die Lebensdauer dieser Disziplin ist immer mehr abhängig von der Ausgeklügeltheit dieser Modelle und Mechanismen. Es mag sein, dass die Anzahl an Studierenden gering ist und es gemessen daran verhältnismäßig viele Dozenten gibt. Wenn es aber irgendetwas an dieser Struktur, an dem Status oder dem Betrieb literaturwissenschaftlicher Institute gibt, was die Wahrnehmung der gesamten Institution in den Augen ihrer Geldgeber oder bezahlender Studierender verbessert, wird das natürlich den finanziellen Wert des Literaturunterrichts fundamental verändern. Wenn auf eine ähnliche Weise Verlage und Verwalter den Wert von zuvor nicht marktfähigen theoretischen und thematischen Trends sehen, verändert sich die interne Konfiguration literarischer Spezialisierung (siehe zum Beispiel das Wachstum der Postcolonial Studies); auch wenn im Vergleich zu den Naturwissenschaften – und ungeachtet der zunehmenden Verschmelzung nationaler literaturwissenschaftlicher Seminare zu literaturwissenschaftlichen Seminaren, Fakultäten für Europastudien und dergleichen mehr – die fachliche Struktur von literaturwissenschaftlichen Fakultäten bemerkenswert schwer zu ändern ist. Es lohnt sich jedoch, über die in einem solchen Prozess entstehende Dynamik der Differenzierung nachzudenken. Wie sollte Literatur im Vergleich zu anderen ›Diskursen der Wahrheit‹ platziert werden, die scheinbar mit mehr Berechtigung in Hochschulen eingebettet sind, da die Wahrheiten, mit denen sie sich beschäftigen, offenbar eine offensichtlichere, effektivere und profitablere Beziehung zur Welt als ganzer haben?
Um uns einer Antwort auf diese Frage zu nähern, müssen wir schauen, was mit der Wahrheit über die vergangenen Jahrhunderte geschehen ist. Es gab eine Zeit – und so lang ist das noch gar nicht her – zu der es schien als wäre der Streit über die Wahrheit gewonnen: als europäische Akademiker sie den Händen der Kirche entrissen – und das obwohl ihre Philosophie noch nicht die Kontrolle über die Theologie erlangt hatte. Während dieses Kampfes dachte man einige Zeit, dass die Frage ›Was ist menschlich?‹ gleichermaßen von der Philosophie und von der Theologie beantwortet werden könne. Diese Zeit ist vorbei; die Kirche verlor die erste Runde des Kampfes und die Philosophie verlor die zweite Runde. Doch für die Philosophie, so erinnert uns Adorno zu Beginn der Negativen Dialektik (1966), erwies sich der Verlust der Wahrheit als großer Gewinn, da er ihr das Überleben sicherte. Adorno vertritt die Ansicht, dass die Philosophie noch immer von großer Bedeutung ist; gerade weil sie ihren großen Versprechungen nicht nachkommen konnte, die Gesamtheit des Lebens zu begreifen. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass diese Verteidigung die Philosophie wieder zurück zu der konstitutiven Rolle führt, die Adorno (und Kant vor ihm) gehofft hatten, ihr darin zusprechen zu können, dass sie die Welt zu einem besseren Ort macht. Stattdessen scheint die Philosophie in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden, als wäre sie ›fake news‹. Jeder kann Philosophie betreiben, wenn er einen Verlag zum Publizieren findet. Und in der akademischen Welt wurde der feste Griff, mit dem sie die Wahrheit zu umklammern schien von der Technologie gelöst: von der Berechenbarkeit und Modellierbarkeit einer Welt, die nach den Modellen und Berechnungen der jeweiligen Wissenschaft überhaupt erst zustande kommen kann. Infolgedessen wendet sich die Philosophie auf sich selbst; wie ein schmollendes Kind erzählt sie sich selbst Geschichten über die Spielzeuge, mit denen sie nicht spielen darf. Was ist also der Sinn von Philosophie, die wieder und wieder die Geschichte ihres Versagens erzählt, die Gesamtheit des Lebens zu erfassen? Und was hat das mit Literatur zu tun? Diese Frage kann am besten mit zwei Behauptungen angegangen werden:
1 Es ist richtig zu sagen, dass die Welt, in der wir leben, durch die Technik, die in den letzten paar Jahrhunderten entwickelt wurde, geprägt ist. Aber es ist genauso richtig zu sagen, dass dieser Strukturierungsprozess erst durch die Geschichten über die Natur und den Menschen ermöglicht wird, die wir uns kollektiv und individuell, bewusst und unbewusst, erzählen. Literatur ist der Diskurs dessen, was man vielleicht das historische oder das politische Unbewusste des wissenschaftlich modellierten Menschen nennen könnte: die Geschichten, die versuchen den Menschen als Ganzes zu verstehen und die all die Handlungen, Erscheinungen und Gedanken erforschen, bei denen der Mensch an seine Grenzen stößt.
2 In den unterschiedlichen Disziplinen leben wir mit unterschiedlichen Vergangenheiten. Aus der Perspektive der Philosophie ist die Vergangenheit nicht auf die gleiche Weise Vergangenheit, wie sie es für die Geschichte der Naturwissenschaft oder der Technologie ist. Technologie macht vergangene Träume wahr. Sie tut dies dadurch, dass sie vergangene Einsichten in sich aufnimmt, um dadurch zu verbessern was zweckmäßig ist und um zu verwerfen, was nicht länger nützlich ist. Literatur funktioniert anders – sie hinterfragt die Idee von Fortschritt als unverkennbares Kennzeichen menschlicher Geschichte. Sie tut dies dadurch, dass sie eine im Fortschrittsdenken der Technologie nicht mehr relevante Vergangenheit neu belebt. Sie tut dies durch Strategien der Darstellung, die historische Zeit negieren, zum Beispiel dadurch, dass die Zukunft beschrieben wird, als wäre sie schon da, oder die Vergangenheit, als wäre sie noch nicht vergangen; dadurch, dass sie Stimmen hervorruft, die weder vergangen noch zukünftig sind, sondern einer ständigen Gegenwart innewohnen. Die so außer Kraft gesetzte wissenschaftliche Zeit ist ein kritisches Momentum – sowohl im positiven als auch im negativen Sinne des Wortes. Es nähert sich den Naturwissenschaften mit einer gewissen Abneigung – aber es zieht den diskursiv angelegten wissenschaftlichen Wahrheitsbehauptungen gleichzeitig die Maske vom Gesicht und zeigt durch die in der Literatur aufgerufenen alternativen Realitäten, dass wissenschaftliche Zeit nicht die einzige Form von Zeitlichkeit ist.
Wenn Literatur das Unbewusste des wissenschaftlich modellierten Menschen ist, dann ist es möglich, über die Verwirklichung und Verdrängung ihrer Träume durch die Wissenschaft und die Technologie zu sprechen. Seit Ikarus hat der Mensch davon geträumt zu fliegen. Wir sind mittlerweile seit ungefähr 100 Jahren in der Lage das zu tun – und wir werden immer besser darin. Vögel können uns nicht mehr das Wasser reichen. Wir können uns selbst darin beglückwünschen und behaupten, dass wir einen beinahe vorzeitlichen Traum wahrgemacht haben. Aber damit nicht genug – inwiefern beeinflusst die Realisierung dieses Traums andere Träume? Fliegen wäre unmöglich ohne revolutionäre Erfindungen und Weiterentwicklungen von Materialien wie beispielsweise Metall und Plastik. Welche sozialen, politischen und ideellen Umstände haben diese Revolutionen ermöglicht? Was haben wir gewonnen und verloren, wenn wir die technologischen Fortschrittsträume mit den Momenten vergleichen, in denen dieser Fortschritt tatsächlich Wirklichkeit wird? Und wie befördert die Verwirklichung dieser Träume die Produktion anderer Träume, die wiederrum realisiert werden wollen? Telekommunikation ist ein weiteres Beispiel – was bedeutet die Verwirklichung des Sechzigerjahre-Traums, mit einem Abbild des Gesichts einer anderen Person auf der entgegengesetzten Seite des Globus sprechen zu können? Zwei Dinge werden offenbar, wenn wir versuchen diese Fragen zu beantworten:
Erstens erinnert die Literatur die Wissenschaften und die Technologien daran, dass wir beide nicht fragen können, wenn wir wissen wollen, ob die Erfindungen, die sie hervorgebracht haben, die Vergangenheit verbessert haben. Die Gewinne und die Verluste können nicht einfach nur in der Technologie aufgewogen werden. In der konzeptuellen Sprache der Technologie – und ich wage zu behaupten, dass das ein Axiom der Technologie ist – gibt es eine Art darwinistischer Ausgrenzung ineffektiver Veränderungen, so dass Veränderung immer positiv ist. Sobald ein Traum wahr geworden ist, kann damit abgeschlossen werden. Die Literatur dagegen wälzt sich weiterhin jede Nacht schlaflos im Bett; wollüstig in ihren feuchten Träumen oder gequält in ihren Alpträumen.
Zweitens können die Gewinne und Verluste nicht auf der Skala einer gemeinsamen Menschheit abgemessen werden, da die wissenschaftliche oder technologische Idee eines solchen universalen Menschseins davon abhängt, die Differenzen, die durch Wissenschaft oder Technologie herbeigeführt wurden, zu verwischen. Die Menschheit, die von wissenschaftlichem oder technologischem Fortschritt profitiert, ist nicht die gleiche, die von der Literatur abstrahiert werden kann. Die literarische Menschheit negiert die individuelle Stimme, die individuelle Geste, während die wissenschaftliche Menschheit die Geographie der Produktion negiert. Die Menschheit sieht für den Besitzer eines IPhones 7 bedeutend anders aus als für die Person, die in der Demokratischen Republik Kongo unter der strengen Kontrolle bewaffneter Aufseher mit nackten Händen Coltan abbaut.
Genau dieser Kampf zwischen dem wissenschaftlich geformten Menschen und dem literarischen Menschen trifft den Kern der europäischen Aufklärung. Intellektuelle Aufklärer hatten den Traum, dass alle Menschen Wohlstand und Fortschritt in einem gerechten Weltsystem teilen, in dem alle Individuen ihr gesamtes Potential frei entfalten können. Die Literatur unterstützte die Überzeugung einer solchen Gleichheit indem sie die gemeinsame Menschheit als das Fundament aller menschlichen Vielfalt zeigte. Sie meinte das wirklich ernst! Während wir die technologischen Träume der Vergangenheit überaus erfolgreich verwirklichen konnten, haben wir abgrundtief darin versagt, diesen Traum von Gleichheit zu realisieren. Warum? Es war nicht unvermeidlich, dass wir das eine schaffen und das andere nicht. Dafür gibt es, so glaube ich, drei Gründe:
1 Die Aufklärung knüpfte die Frage nach Menschlichkeit unabdingbar an die Säkularisierung der Wahrheit. Das ermöglichte der Philosophie, ihre holistischen Perspektive auf die Menschheit zu verwerfen. Die Säkularisierung der Wahrheit bedeutete, dass der Mensch zunehmend weniger durch die Augen Gottes gesehen wurde und stattdessen mehr und mehr durch Modelle, die eine solche göttliche Einsicht ersetzten. Der Blick Gottes wurde nicht nur getrübt, sondern seine Augen zerfielen in tausende kleiner Augen, wie die Facettenaugen der Insekten, aber ohne das Nervensystem, das es ihnen ermöglicht hätte, ein einheitliches Bild zu kreieren oder einen Reiz zu senden, der einheitliche Handlungen hervorruft.
2 Die Modernisierungen in den sozialen, politischen und ökonomischen Bereichen bewirkten einen solch rapiden Umbruch, dass Fragen der Gleichheit von der Unfähigkeit politischer Systeme, Änderungen in anderen Bereichen zu koordinieren, unterminiert wurden.
3 Die entstehende Weltwirtschaft zwang Philosophen dazu, jegliche Fragen bezüglich Menschheit in den Kontext kultureller Differenz zu setzen und Austauschpraktiken jeglicher Form zu homogenisieren. Die Homogenisierung des Handels verbreitete Theorien darüber, wie der Handelsverkehr kulturelle Ungleichheiten ausgleichen und damit den Menschen als das Wesen hervorbringen könnte, dessen Wünsche und Bedürfnisse überall gleich sind.
Wenn wissenschaftliche Wahrheitsdiskurse beständig in der teleologischen Produktion von den Wahrheiten gefangen sind, die sie selbst formen, und die Philosophie immer einen Schritt hinter dem zurück ist, was die Wissenschaft kreiert hat, was ist dann mit der Literatur? Bei jedem Schritt schaute die Literatur überrascht, fasziniert und bestürzt zu, wie der Versuch den Menschen zu verstehen nach und nach in den Händen zerrann. Eine Geschichte der Literatur, die diesen Prozess verfolgt und die kontinuierliche Destabilisierung des Menschen als das, was aus ihm geworden ist, festhält, muss erst noch geschrieben werden
Literatur hebt den teleologischen Pakt wissenschaftlicher Wissensdiskurse mit der Technologie auf, indem sie mit der Philosophie kommuniziert. Wenn Philosophie mit der Literatur spricht, nennt man das Theorie; den Metadiskurs über literarische Texte. Es gibt einen Grund dafür warum dieser Dialog in Deutschland Literaturwissenschaft genannt wird. Gleich der Wissenschaft legt sie ein Wahrheitsgelübde ab – aber ungleich der Wissenschaft ergeht sich dieses Gelübde nicht in technologischen Veränderungen der Welt. Stattdessen hält sie die Wahrheit auf Distanz; destabilisiert sie durch die inhärenten Spannungen zwischen der Allgemeingültigkeit ihrer einen menschlichen Stimme und der Partikularität ihrer vielen menschlichen Stimmen. Man kann sich Literatur nicht ohne diese Destabilisierung der Wahrheit vorstellen.
Bei Literatur und Literaturwissenschaft aktiviert die Frage nach einer gemeinsamen Menschlichkeit und menschlicher Vielfalt einen wechselseitigen Dialog zwischen Philosophie und Ästhetik (die Lehre der Ausdrucksform). Die philosophische Frage ›was ist menschlich?‹ kann nicht adäquat beantwortet werden – nicht nur, weil die Antwort bereits de facto in den technologischen Veränderungen des Menschen und der Welt vorliegt, sondern auch weil es sowohl eine allgemeingültige wie auch eine partikulare Antwort gibt, die sich (zumindest teilweise) gegenseitig ausschließen. Eine solche Ausschließung befördert die ästhetische Experimentierfreude mit Ausdrucksformen des Menschen und ihrem Spiel mit den Grenzen menschlicher Erscheinung – oder mit der Partikularität menschlicher Erscheinung. Dieses Spiel mit Grenzen und Partikularitäten ist jedoch noch solange nicht gänzlich entfaltet, bis es in einen analytischen Metadiskurs mündet. Ästhetische Repräsentationen von Menschlichkeit, von Unmenschlichkeit und menschlicher Differenz und Vielfalt müssen notwendig offen bleiben, damit sie analysiert werden können um so zurück auf die Theorie, auf den Metadiskurs, auf die Philosophie zu verweisen. Und so schließt sich der Kreis.
Sowohl Literatur und Metadiskurs wie auch Ästhetik und Philosophie sind eng verbunden mit Diskursen und Institutionen, die auf Verhandlung und Interpretation basieren. Diese Interaktion generiert und unterhält mein Forschungsfeld. Die Bezeichnung meines Jobs ist zwar ›Literaturprofessor‹, aber ich untersuche eben diese sich gegenseitig konstituierende Beziehung, in der die Literatur der Philosophie Bilder bereitstellt, um Licht und Form in die unklaren, schattigen Konzepte zu bringen, wenn die philosophische Sprache die Welt nicht länger erklären kann; und die Philosophie stellt der Kunst im Gegenzug eine analytische Sprache bereit, um ihre Bilder zu konzeptualisieren, um zu sagen, was die Kunst unfähig war zu äußern. Die Romantiker nannten das Poiesis. Wir mühen uns seit einiger Zeit ab, den institutionellen Raum und Rahmen zu finden, in den diese Beziehung wirklich gehört. Manchmal nennt man ihn Vergleichende Literaturwissenschaften, manchmal Literaturtheorie, Literaturwissenschaft, oder einfach nur Theorie. Bemerkenswerterweise hat dieses zentrale Forschungsfeld an Universitäten größtenteils noch immer kein Obdach gefunden.