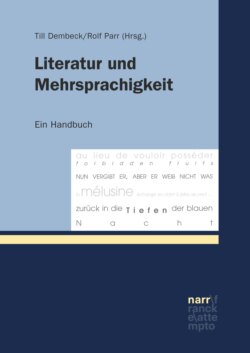Читать книгу Literatur und Mehrsprachigkeit - Группа авторов - Страница 44
3. Sprachkontakt: Pidgins und Kreolsprachen
ОглавлениеHeinz Sieburg
Pidgins (etymologisch vermutlich im chinesischen Sprachraum von engl. business abgeleitet) sind ›Behelfs- oder Kontaktsprachen‹, die in (mündlichen) interkulturellen Kommunikationssituationen entstehen, wenn die Sprache des jeweiligen Gegenübers unbekannt ist und zwischen den Sprachen deutliche typologische Unterschiede bestehen. (Intentional und funktional ergeben sich damit gewisse Überschneidungen zu den Plansprachen; vgl. II.4.) In der Regel werden Pidgins auf Konstellationen während der Kolonialzeit (15.–19. Jahrhundert) bezogen, namentlich auf das Aufeinandertreffen von europäischen Sprachen (insbesondere Portugiesisch, Spanisch, Englisch, Französisch, Niederländisch) mit Sprachen aus anderen Weltteilen (z.B. Afrika, Karibik, Pazifik). Aufgrund des kolonialen Bezugsrahmens von Eroberung und Unterdrückung ist das Verhältnis der beteiligten Personengruppen wie auch das der betroffenen Sprachen als asymmetrisch zu charakterisieren. Strukturell finden sich in Pidgins meist hybride Kombinationen aus lexikalischen Elementen der dominanten Sprache (Superstrat) mit grammatisch-syntaktischen Elementen der einheimischen Sprache (Substrat). Funktional sind Pidginsprachen (zunächst) weitgehend auf das für die Arbeits- und Handelsabläufe Notwendige beschränkt.
Den bereits stabileren (eigentlichen) Pidgins gehen die in der frühesten Kontaktphase entstandenen, noch sehr unfesten und idiolektal geprägten Protoformen (Jargons) voraus. Pidgins können als eine (funktional stark eingeschränkte und grammatisch simplifizierte) Zweitsprache neben den jeweiligen Muttersprachen (oder Fremdsprachen) der Beteiligten über Generationen weiterbestehen – und sich auch weiterentwickeln. Unter Umständen (Beeinträchtigung der primären Sprachgemeinschaft, Unerreichbarkeit der europäischen Prestigesprachen) entwickeln sich Pidgins im Zuge der Generationenfolge allerdings ihrerseits zu Muttersprachen, die dann Kreolsprachen genannt werden. In Relation zu den Pidgins sind Kreols deutlich elaborierter, verfügen über ein den Basissprachen vergleichbares Ausdruckspotential, sind aber strukturell einfacher gebaut. Für Fälle zunehmender Annäherung an die Prestigevarietäten hat sich der Begriff Dekreolisierung etabliert.
Sowohl Pidgins als auch Kreols (etymologisch möglicherweise aus span. criollo ›einheimisch, eingeboren‹ abgeleitet) bilden den Gegenstandsbereich der Kreolistik, als deren Begründer der Romanist und Indogermanist Hugo SchuchardtSchuchardt, Hugo (1842–1927) gilt und die insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg vor dem Hintergrund der zunehmenden Unabhängigkeit der Kolonialgebiete (wieder) ein verstärktes wissenschaftliches Interesse fand. Dies gilt vor allem auch für die sich in der US-amerikanischen Linguistik etablierenden – weniger sprachhistorisch als synchron orientierten – Pidgin and Creole Studies. Deren gesellschaftspolitische Relevanz zeigte sich etwa bezogen auf die Frage, ob das Black English als Kreol und damit als gleichberechtigte eigenständige (und identitätsstärkende) Sprache anzusehen sei: »If American Negro English is indeed a creole […] the social and political implications will be great indeed« (Dell HymesHymes, Dell zit. nach BachmannBachmann, Iris, Die Sprachwerdung des Kreolischen, 165).
Für die allgemeine Linguistik ist die Kreolistik vor allem vor dem Hintergrund sprachwandel- und spracherwerbstheoretischer Fragestellungen interessant. Gerade der mit dem muttersprachlichen Erstspracherwerb der ersten Generation verbundene Entwicklungsschub von einem restringierten pidginsprachlichen Input seitens der Eltern zu einer grammatisch und funktional erweiterten Kreolsprache bei den Lernern führte zu produktiven neuen Ansätzen: Stark diskutiert wurde und wird in diesem Zusammenhang die Theorie Derek BickertonsBickerton, Derek, der die systematischen Veränderungen im Kreolisierungsprozess als Funktion eines genetisch verankerten, spezifisch menschlichen ›Bioprogramms‹ (»the one crucial clue to the history of our species«) erklärt (Bickerton, Roots of language, 255). Dieses Programm, so Bickerton, ist im normalen Spracherwerbsprozess durch die jeweils vorgegebene Zielsprache (weitgehend) überlagert, kann sich also nur in der spezifischen Pidgin-/Kreol-Situation voll entfalten, ist aber nichtsdestotrotz notwendige Voraussetzung zur Aneignung jedweder Kultursprache: »Without such a program, the simplest of cultural languages would presumably be quite unlearnable« (ebd.Bickerton, Derek, 255). Die Erforschung der Kreolisierung als fundamentales Sprachwandelphänomen hat neben der individuellen (bzw. universalistischen) Komponente auch die Sprachgemeinschaft als Ganzes und die in ihr ablaufenden vielschichtigen Veränderungs- und Erweiterungsprozesse zu beachten, wobei die Einflüsse der Substrat- und Superstratsprachen zu berücksichtigen bleiben. Jedenfalls gilt nach HellingerHellinger, Marlis (Englisch-orientierte Pidgin- und Kreolsprachen, 114): »Wir erhalten kein adäquates Bild sprachlicher Vorgänge, wenn Kreolisierung überwiegend als kindlicher Spracherwerb unter extremen Bedingungen gesehen, die Rolle erwachsener Sprecher aber vernachlässigt wird.«
Innerhalb der Kreolistik stark diskutiert ist neben der Frage der Kreolisierung die der mono- bzw. polygenetischen Entwicklung. Die monogenetische Hypothese stützt sich auf die Beobachtung einer (bei aller lexikalischen Differenz) auffälligen strukturellen Nähe geografisch weit auseinanderliegender Pidgin- und Kreolvarietäten, vernachlässigt dabei aber potentielle eigendynamische Entwicklungen. Auf Keith WhinnomWhinnom, Keith basiert die (heute mehrheitlich verworfene) Auffassung, wonach als gemeinsamer Ursprung aller europäisch basierten Pidgin- und Kreolsprachen die historische Lingua Franca (auch Sabir), eine – italienisch basierte – mittelalterliche Kontaktvarietät zwischen Sprachen des europäischen und orientalischen Raumes, anzusetzen sei. Dass eine solche Varietät existierte, ist unstrittig, auch wenn schriftliche Belege aus dem Mittelalter nur ganz vereinzelt überliefert sind.
Immerhin hatte diese ›Vermittlungssprache‹ ein Nachleben in der Literatur des 16. und 17. Jahrhunderts (z.B. bei GoldoniGoldoni, Carlo, Lope de VegaLope de Vega, Félix, CalderónCalderón de la Barca, Pedro) und diente hier zur Erzeugung von historisch-sozialer Authentizität, Komik oder der Markierung sozialer Inferiorität. In MolièreMolières Ballett-Komödie Le bourgeois gentilhomme (Der Bürger als Edelmann) von 1671 findet sich als Beleg (aus HellingerHellinger, Marlis, Englisch-orientierte Pidgin- und Kreolsprachen, 57):
Se ti sabir, Ti respondir;
se non sabir, tazir, tazir.
Mi star Mufti; Ti qui star qui?
Non intendir: tazir, tazir.
(Wenn Du weißt, dann antworte; wenn Du nicht weißt, dann schweige, schweige. Ich bin Mufti; Du, wer bist Du? (Du) verstehst nicht; sei still, sei still.)
Nach Angaben von HellingerHellinger, Marlis (ebd., 2) ist von ca. 130 bisher bekannten Pidgins bzw. Kreols auszugehen, wobei die Abgrenzung untereinander und gegenüber anderen Varietäten mitunter schwierig ist. Neben den weit überwiegend europäisch basierten Formen existieren andere ohne europäischen Einfluss (z.B. Ewondo Populaire, eine bantubasierte Kontaktsprache in Ost-Kamerun, oder Sango in der Zentralafrikanischen Republik). Die Sprecherzahlen differieren sehr stark. Größere Sprachgemeinschaften mit Sprecherzahlen jenseits der Millionengrenze bestehen etwa für das Jamaican Creol oder Tok Pisin (vor allem in Papua-Neuguinea). In einigen Fällen sind die Sprachen vom akuten Sprachtod bedroht (etwa Unserdeutsch).
Bei aller Variabilität der einzelnen Varietäten lassen sich doch bestimmte linguistische Merkmale benennen, die, wenn auch in unterschiedlichen graduellen Ausprägungen, für Pidgins und Kreols als charakteristisch angesehen werden können. Dazu zählen syntaktische Reduktionen, Einschränkungen im Tempus- und Modussystem, der Verzicht auf Flexionsendungen, Wortschatz-Reduktionen, auf lexikalischer Ebene Häufung analytischer Wortumschreibungen und die Tendenz zur Metaphorik (glas bilong lukluk ›Spiegel‹; fellow belong make open bottle ›Korkenzieher‹; vgl. BauerBauer, Anton, »Pidgin- und Kreolsprachen«, 348).
Das Prestige von Pidgin- und Kreolsprachen wird im Allgemeinen als gering eingeschätzt, und das sowohl außer- wie innerhalb der jeweiligen Sprachgemeinschaft. (So wird ›Pidginisierung‹ in alltagssprachlicher Verwendung häufig mit Sprachverfall gleichgesetzt.) Andererseits lassen sich Beispiele aufzeigen, in denen ein deutlicher Prestigezuwachs eingetreten ist. Dies gilt zumal dann, wenn im Zuge der Dekolonialisierung sprachpolitische Entscheidungen zu einer Aufwertung und administrativen Etablierung bestimmter Pidgins oder Kreols führten. Besonders in Ländern, die aufgrund der oft komplexen Bevölkerungszusammensetzung keine einheitliche einheimische Sprache ausgebildet hatten, wurden bisweilen die etablierten Pidgin- oder Kreolvarietäten (neben der Kolonisatorensprache) zu Staats- oder Verwaltungssprachen erhoben. Beispiel hierfür ist Papua-Neuguinea, das 1975 (von Australien) unabhängig wurde und auf dessen Gebiet allein rund 740 Papua-Sprachen (Fischer Weltalmanach 2016, 354) zu verzeichnen sind. Neben Englisch sind das Kreol Hiri Motu und Tok Pisin offizielle Staatssprache. Vor allem das Englisch-basierte Tok Pisin erfuhr mit der Erhebung zur offiziellen Landessprache einen enormen Prestigegewinn – und entwickelte sich etwa zur praktisch einzigen Parlamentssprache. Tok Pisin (oder Papua-Neuguinea Pidgin) ist mit 3 bis 5 Millionen Sprechern die größte Landessprache. Da die Varietät sowohl (mehrheitlich) als Zweit-, von etwa 500000 Sprechern aber auch als Muttersprache verwendet wird (VelupillaiVelupillai, Viveka, Pidgins, Creoles and Mixed Languages, 37), wird sie als Zwischenstufe zwischen Pidgin und Kreol beschrieben. Radiosendungen auf Tok Pisin oder die Entwicklung eines auch schriftsprachlichen Registers belegen die Vitalität dieser Varietät. Als Anschauungsbeispiel für Tok Pisin nachfolgend Artikel 1 der Erklärung der allgemeinen Menschenrechte:
Yumi olgeta mama karim umi long stap fri na wankain long wei yumi lukim i gutpela na strepela tru. Uumi olgeta igat ting ting bilong wanem samting I rait na rong na mipela olgeta I mas mekim gutpela pasin long ol narapela long tingting bilong brata susa. (http://www.omniglot.com/writing/tokpisin.htm [Stand: 2.8.2016])
(Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. – http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/ger.pdf [Stand: 2.8.2016]).
Der Expandierung einzelner Pidgin- und Kreolsprachen steht das Aussterben anderer gegenüber. Zu diesen zählt Unserdeutsch (oder Rabaul Creole German), das ebenfalls von Papua-Neuguinea (Bismarck-Archipel) stammt und die einzige deutschbasierte Kreolsprache darstellt, entstanden während der kurzen Phase deutscher Kolonialherrschaft (1884–1914). Untypisch ist – unter kreolistischer Perspektive deshalb umso interessanter – auch ihr Entstehen durch Kinder (Mischlingskinder des Herz-Jesu-Missionsinternats in Vanapope). Unserdeutsch wird heute nur noch von wenigen älteren Sprechern beherrscht. Erste (und bislang einzige) größere Untersuchung zu dieser Varietät ist die maschinenschriftliche Master Thesis von Craig Alan VolkerVolker, Craig Alan (»An Introduction to Rabaul Creole German (Unserdeutsch)«). Daraus auch die folgenden Beispiele: Wenn er kommt, i wird fragen er. (39) Du kann geht, wenn du arbeiten gut. (49) Also drei ich wird aufpicken (›abholen‹) (52). Das aktuelle Forschungsinteresse an Unserdeutsch zeigt ein gleichnamiges Augsburger DFG-Projekt (Förderzeitraum 2015–2018; vgl. MaintzMaintz, Péter/KönigKönig, Werner/VolkerVolker, Craig Alan, »Unserdeutsch (Rabaul Creole German)«).
Innerhalb der Linguistik findet sich der Begriff Pidgin auch in anderen Zusammenhängen. So wurden beispielsweise in der Bundesrepublik (angeregt durch Michael ClyneClyne, Michael, »Zum Pidgin-Deutsch der Gastarbeiter«) Untersuchungen zum Gastarbeiterdeutsch mit Begriffen wie Arbeiter-Pidgin oder Pidgin-Deutsch verbunden. Untersuchungsziel waren Verlauf und Ausprägungen des ungesteuerten Spracherwerbs bei erwachsenen Arbeitsimmigranten. Ebenso spielte eine Rolle, inwiefern das ›Pidgin-Deutsch der Migranten‹ durch das ›Pseudo-Pidgin (Foreigner Talk) der Einheimischen‹, einer von deutschsprachigen Muttersprachlern gegenüber Migranten verwendeten, stark reduzierten Sprachform, beeinflusst ist.