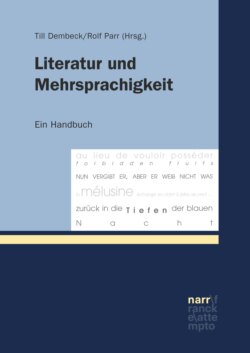Читать книгу Literatur und Mehrsprachigkeit - Группа авторов - Страница 56
a) Pragmalinguistische Grundlagen: Von der Ein- zur Mehrsprachigkeitsforschung
ОглавлениеDie Pragmalinguistik, die im deutschsprachigen Raum um 1970 entwickelt wurde und sich seitdem als eine der bedeutendsten Teildisziplinen der Sprachwissenschaft etablieren konnte, nimmt vielfältig Bezug auf die analytische Sprachphilosophie WittgensteinWittgenstein, Ludwigs, AustinAustin, John L.s und SearleSearle, John R.s, auf die dreistellige Semiotik (PeircePeirce, Charles Sanders, MorrisMorris, Charles W., BühlerBühler, Karl u.a.) sowie auf Konzepte des Konstruktivismus, vor allem in seinen interaktionistischen Varianten. Der sprachphilosophische linguistic turn fand zudem breite Rezeption in den Kulturwissenschaften. Sprachpragmatische Basisannahmen sind damit für ethnologische ebenso wie postkoloniale Dimensionen der Kulturforschung zentral geworden.
Auch wenn pragmatische Grundannahmen in den Kulturwissenschaften häufig mit Themen der kulturellen Vielfalt und Mehrsprachigkeit verbunden sind, waren philosophische und linguistische Untersuchungen des Sprachgebrauchs doch meist auf die Untersuchung von Einzelsprachen fokussiert. Vor dem Hintergrund des z.B. in der Sprechakttheorie anzutreffenden impliziten rational-universalistischen Substrats und der ordinary language philosophy konzentrierten sich konkrete linguistische Analysen vielfach auf Beispiele aus dem anglo-amerikanischen Sprachraum. Die germanistische Linguistik beschränkte sich in ihren pragmalinguistischen Ausprägungen primär auf das Deutsche als Gegenstand entsprechender Forschungsansätze.
Die Ausweitung des Blicks auf pragmatische Dimensionen von Mehrsprachigkeit erfolgte zögerlich (vgl. hierzu Ten ThijeTen Thije, Jan D., »Eine Pragmatik der Mehrsprachigkeit«), in jüngerer Zeit aber mit allmählich zunehmender Dynamik. Hervorzuheben sind hier u.a. folgende Richtungen:
Die Kontrastive Pragmatik, die u.a. im Bereich des Faches Deutsch als Fremdsprache Aufmerksamkeit findet; im Ausgang hiervon können sämtliche Ebenen und Ansätze linguistischer Pragmatik in der Regel mit Bezug auf zwei Sprachen kontrastiv untersucht werden. Im engeren Sinn literaturwissenschaftlich relevante Felder kontrastiver Pragmatik betreffen z.B. die Untersuchung von literarischen Textsorten als kulturelle Entitäten, die auch sprach- und kulturanalytische Herangehensweisen verlangen sowie die Berücksichtigung von durch Sprach- und Kulturkontakt mitbedingten hybriden Textformen (vgl. FixFix, Ulla, »Was heißt Texte kulturell verstehen?«, 260, 267). Vergleichende Analysen konkreter Sprachgebrauchsvielfalt konnten zeigen, wie mit dem Einsatz von Mehrsprachigkeit im Drama die Inszenierung von »doppelbödigen Kommunikationssituationen« potenziert werden kann und zugleich an bekannte Formen von Sprachimages wie dem Französischen als Salonsprache und dem Englischen als Geschäftssprache anknüpfen kann (vgl. WeissmannWeissmann, Dirk, »Mehrsprachigkeit auf dem Theater«, 79f. und 88).
Ansätze einer Kulturwissenschaftlichen Pragmatik, die insbesondere von Soziologen wie Joachim RennRenn, Joachim (»Perspektiven einer sprachpragmatischen Kulturtheorie«) forciert wird; hier werden z.B. Sprechakte im Hinblick auf das mit ihrer Verwendung verbundene implizite Wissen fokussiert. Der diesem Konzept inhärente Grundgedanke, dass Kultur »zuerst eine kollektive, besonders: sprachliche Praxis« ist, verweist auf die besondere Sprach- und Kultursensibilität, die mit der Mehrsprachigkeitspragmatik in der Regel verbunden ist (vgl. RennRenn, Joachim, »Perspektiven einer sprachpragmatischen Kulturtheorie«, 430). Die jüngere Forschung beschäftigt sich z.B. mit Samuel BeckettBeckett, Samuels Bemühen, Figuren zu erzeugen, »die das Mehrsprachigkeitsproblem ›erleben‹, womit er eine Authentifizierung des Problems erreicht« (MannweilerMannweiler, Caroline, »BeckettsBeckett, Samuel Mehrsprachigkeit«, 62).
Arbeiten im Bereich des jüngeren Forschungsfeldes Interkultureller Linguistik, das mit den Initiativen von Peter RasterRaster, Peter (Perspektiven einer interkulturellen Linguistik) und Csaba FöldesFöldes, Csaba (Interkulturelle Linguistik im Aufbruch) eng verbunden ist; hier wird neben Analysen verschiedenster Einzelsprachen und kontrastiven Untersuchungen auch angeregt, die linguistischen Instrumente selbst interkulturell zu betrachten, d.h., u.a. auch andere als europäisch-anglo-amerikanische Theorien und Forschungsansätze zu berücksichtigen. Im Rahmen dieser Forschungsrichtung werden u.a. Modelle »der interkulturellen Identität« entworfen, die »nur durch eine Interaktion zweier oder mehrerer Sprach- und Kommunikationskulturen entsteht«, um die literarische Inszenierung der Erfahrungen von Sprachkontakten methodisch fundiert zu beschreiben (vgl. PugliesePugliese, Rossella, »Interkulturalität als Identität«, 219).
Ansätze im Bereich der Translationswissenschaft, die einerseits linguistische Forschungsrichtungen vielfach markant abkoppeln, andererseits seit geraumer Zeit mit kulturwissenschaftlichen Fundierungen pragmatische Akzente setzen (VermeerVermeer, Hans J., Literarische Übersetzung als Versuch interkultureller Kommunikation; KußmaulKußmaul, Paul, Kreatives Übersetzen). Diese Ansätze sind in der Regel dadurch gekennzeichnet, dass »Position und Wirkung von Übersetzern, Übersetzungsprozessen und übersetzter Literatur in der Zielkultur« die ästhetischen Bedingungen des Übersetzens mitbestimmen (vgl. PagniPagni, Andrea, »Lateinamerika als Übersetzungsraum«, 162).
Die bereits seit Beginn der 1990er Jahre etablierte Literary Pragmatics, die mit Roger D. SellSell, Roger D. u.a. verbunden ist; dies ist eine Richtung, in der versucht wird, die insbesondere in der germanistischen Forschung verbreitete Lücke zwischen Literaturwissenschaft und Linguistik durch den Einsatz linguistischer Instrumente in literaturwissenschaftlichen Analysen zu überwinden. Die spezifische Anschlussfähigkeit des Ansatzes im Hinblick auf Fragen literarischer Mehrsprachigkeit ergibt sich aus der Grundannahme, derzufolge »the writing and reading of literary texts as interactive communication process« zu betrachten ist, der soziokulturelle Kontexte impliziert (vgl. Sell,Sell, Roger D. Literary Pragmatics, xiv).
Dass die Anwendung linguistischer Instrumente auf literarische Texte, etwa auf literarisch fingierte Dialoge im Drama oder in erzählenden Texten, grundsätzlich methodisch begründet werden kann, wurde bereits vor Jahrzehnten mit starken Argumenten diskutiert (vgl. z.B. UngeheuerUngeheuer, Gerold, »Gesprächsanalyse an literarischen Texten«; Hess-LüttichHess-Lüttich, Ernest W.B., Soziale Interaktion und literarischer Dialog). Dabei bewährt sich in pragmalinguistischen Untersuchungen von Mehrsprachigkeit und insbesondere literarischer Mehrsprachigkeit in Abhängigkeit von den jeweiligen Fragestellungen und Forschungsfragen der Einsatz möglichst vielfältiger Ansätze und methodischer Vorgehensweisen wie z.B. im Ausgang von Sprechakttheorie, konversationellen Implikaturen und Gesprächsanalyse.