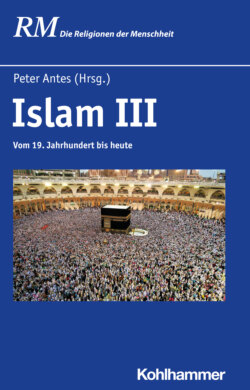Читать книгу Islam III - Группа авторов - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 Richtungsvielfalt in der innerislamischen Diskussion
ОглавлениеDie einzelnen Thematiken der drei Schwerpunkte haben gezeigt, wie vielgestaltig der Islam ist. Neben traditionellen Unterschieden zwischen den sunnitischen Rechtsschulen und den zur Schia zählenden Traditionen gibt es regional wie international eine Fülle anderer Auslegungsrichtungen, die zum Erscheinungsbild des Islam in der Moderne gehören. Jede Vorstellung vom Islam als homogenem Block muss daher aufgegeben werden. Es ist an der Zeit, die klassischen Stereotypen vom Islam als einer reformunfähigen, frauenfeindlichen und durch Autoritäten im Ausland gesteuerten Religion ad acta zu legen und stattdessen die vielfältigen Prozesse der Erneuerung in der innerislamischen Diskussion zur Kenntnis zu nehmen. Das soll nicht heißen, dass es die reformunwilligen Muslime oder die, die mit Gewalt für die Einführung der Scharia eintreten, nicht gäbe, aber sie sind bei weitem nicht repräsentativ für alle Muslime, deren Palette von den Extremisten über die Traditionalisten und Fundamentalisten bis zu den Reformfreudigen und Liberalen, den Kulturmuslimen und sogar in Deutschland bis zu den Ex-Muslimen reicht. Die öffentliche Debatte über den Islam in Westeuropa nimmt dagegen nur die konservativsten und aggressivsten unter ihnen zur Kenntnis. Sie gleicht daher der Debatte derer, die im 19. Jahrhundert in mehrheitlich protestantischen Ländern ähnliche Debatten über den Katholizismus geführt haben.1 Erinnert sei in diesem Zusammenhang aus noch früherer Zeit an das berühmte Diktum Friedrichs d. Gr. in Preußen, der bekanntlich schrieb:
... alle Religionen Seindt gleich und guht wan nuhr die leüte so sie profesiren Erliche leüte seindt und wen Türken und Heiden kähmen und wollten das Land Pöpliren, so wollen wier sie Mosqueen und Kirchen bauen. (Alle Religionen sind gleich und gut, wenn nur die Leute, die sie ausüben, ehrliche Leute sind, und wenn Türken und Heiden kämen, so wollen wir ihnen Moscheen und Kirchen bauen.)
»Dabei ging es dem König weder um die Muslime noch um die Heiden. Anlass zu seiner Antwort am Rand des Immediat-Berichts des General-Direktoriums vom 15.6.1740 war die Frage, ob es erlaubt sei, einem Katholiken das Bürgerrecht in Frankfurt [an der Oder] zu verleihen.«2
Die Parallele zu heutigen Debatten mit Blick auf die Integration von Muslimen in unsere Gesellschaft springt ins Auge. Wenn Integration nicht totale Assimilation meint, dann ist mit Aladin El-Mafaalani festzustellen, dass Integration nicht zu weniger, sondern zu mehr Problemen im gesellschaftlichen Aushandlungsprozess führt. Um dies verständlich zu machen, wählt er folgendes Beispiel:
Die erste Generation der Einwanderer ist noch bescheiden und fleißig, beansprucht nicht volle Zugehörigkeit und Teilhabe. [...] Sie sitzen überwiegend am Boden oder am Katzentisch, während die Einheimischen am Tisch sitzen.3
Die ersten Nachkommen beginnen, sich an den Tisch zu setzen. In der zweiten Generation gelingt Integration zunehmend. Die Migrantenkinder sprechen deutsch, haben nie in einer anderen Heimat als Deutschland gelebt und sehen sich schon als Teil des Ganzen. Egal wie wir Integration definieren, hier findet sie statt. Und deshalb steigt das Konfliktpotenzial. Denn mehr Menschen sitzen jetzt am Tisch, wollen einen schönen Platz und wollen ein Stück vom Kuchen. Es geht hier also um Teilhabe an Positionen und Ressourcen.
In der dritten Generation geht die Reise noch mal weiter. Die Enkel der Migranten möchten nicht nur am Tisch sitzen und ein Stück vom servierten Kuchen bekommen. Sie wollen mitbestellen. Sie wollen mitentscheiden, welcher Kuchen auf den Tisch kommt. Und sie wollen die alten Tischregeln, die sich entwickelt und etabliert haben, bevor sie dabei waren, mitgestalten. Das Konfliktpotenzial steigert sich weiter, denn nun geht es um die Rezeptur und die Ordnung der offenen Tischgesellschaft.4
Während in der Vergangenheit in der klassischen Gesellschaft die Ordnung in der Gesellschaft »von oben« (Gott, Götter, Weltordnung, Himmel) vorgegeben und durch den König durchgesetzt wurde, ist die gesellschaftliche Ordnung in modernen Gesellschaften das Ergebnis eines Aushandlungsprozesses, folglich nie ein für allemal festgelegt sondern immer wieder neu auszuhandeln. Damit fallen alle göttlichen Wahrheiten unter intersubjektive Heilsvorstellungen, die der Staat sich nicht zu eigen machen darf. Er muss sie alle für sich bestehen lassen, weshalb er Toleranz üben muss und nur noch das von Menschen gemachte Recht durchsetzen kann.5
Damit sind gesellschaftliche Aushandlungsprozesse notwendig und Konflikte vorprogrammiert; sie sind aber zugleich das Movens für die Entwicklung einer Gesellschaft:
Die Konflikte selbst sind es, die liberale Gesellschaften zusammenhalten. Die Vielheit in der Bevölkerung wird durch Aushandlungen und Streit zu einer Einheit. [...]
Welche sozialen Innovationen oder sozialen Fortschritte wurden nicht durch Konflikte erstritten und erkämpft? Der Sozialstaat, die Demokratie, die Geschlechtergerechtigkeit, die sexuelle Befreiung, die Menschenrechte – alles, was heute wie selbstverständlich im Grundgesetz steht, ist das Ergebnis von Konflikten und ihrer – irgendwann – konstruktiven Bewältigung.6
Ziel allen Bemühens muss die Teilhabe sein:
Ein Kennzeichen offener Einwanderungsgesellschaften ist es, dass alle, die wollen, zum Wir gehören können. Nicht Migration macht die offene Gesellschaft aus, auch in Russland und Saudi-Arabien findet beträchtliche Migration statt, sondern Integration und Teilhabe.7
Daraus folgt für die Zukunft:
Die offene Gesellschaft ermöglicht die Diskussion. Aber sie allein gibt noch keinen Sinn, kein Ziel und auch keinen Kompass vor. Sie ist die Arena, nicht das Spiel. In ihr kann über die Vergangenheit, die Gegenwart und ganz besonders intensiv über die Zukunft gestritten werden. Dabei sollte die Leitidee sein: Lieber mit etwas Neuem scheitern, als die schreckliche Vergangenheit zu wiederholen. Denn: Alles ist heute besser als früher, außer einem: die Zukunft. Und an der Zukunft kann man jetzt noch was ändern.8
Wer sich dem Ideal der Integration als Teilhabe im beschriebenen Sinne verweigert, muss sich dem Recht der Gesellschaft beugen. Dies ist das Erziehungsideal aller Schulgesetze in Deutschland und wird von der überwiegenden Mehrheit der Muslime in unserem Lande geteilt. Dass diesbezüglich noch Nachholbedarf in vielen Ländern mit islamischer Bevölkerungsmehrheit besteht, hängt sicher auch damit zusammen, dass die dortigen Gesellschaften bei weitem nicht so weltanschaulich und religiös plural zusammengesetzt sind, wie dies für West-, Mittel- und Nordeuropa gilt, sodass dort noch im klassischen Sinne das Recht als »von oben« (Gott) angeordnet und durch die gesellschaftlich führenden Instanzen verordnet werden kann.
Michael Blume hat allerdings darauf hingewiesen, dass es sowohl in den Ländern mit islamischer Bevölkerungsmehrheit als auch in der Diaspora eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Muslimen gibt, die damit schon längst nicht mehr übereinstimmen, sondern für sich den stillen Rückzug angetreten haben.9 Sie protestieren nicht gegen das bestehende traditionelle System in Ländern mit islamischer Bevölkerungsmehrheit noch äußern sie sich kritisch zu Islamforderungen von Islam-Verbänden in der Diaspora, sondern halten sich aus allem heraus, weshalb es unmöglich ist, ihren Prozentsatz regional wie international konkret zu bestimmen.