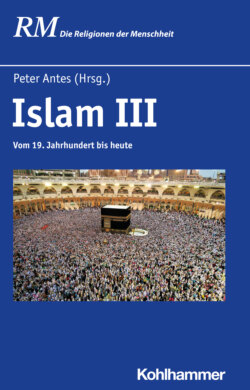Читать книгу Islam III - Группа авторов - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 Einleitung
ОглавлениеDie letzten 200 Jahre haben die Welt mehr verändert als alle Jahrhunderte zuvor seit der neolithischen Revolution, mit der die Landwirtschaft in der Menschheitsgeschichte Einzug gehalten hatte. Das gilt auch für den Nahen Osten. Die Forschung der letzten Jahrzehnte betont dabei immer wieder, dass es keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen Modernisierungsprozessen im Vorderen Orient und in Westeuropa gegeben habe. Die Modernisierung der Welt seit dem 19. Jahrhundert sei vielmehr ein vielfach ineinander verflochtener Prozess gewesen, an dem sowohl Westeuropa als auch alle anderen Gesellschaften der Welt ihren Anteil gehabt hätten.1 Eine derartige Sichtweise mag ihre Berechtigung haben. Sie berücksichtigt jedoch nicht ausreichend, dass in allen außereuropäischen Gesellschaften mit Ausnahme der europäischen Siedlungskolonien in Nordamerika und Ozeanien diese Prozesse im Regelfall in Abhängigkeit vom europäischen Zentrum des modernen Weltsystems ihren Anfang genommen haben. Sie wurden zudem über lange Jahrzehnte auch zu einem nicht unerheblichen Maß von diesem europäischen Zentrum und später seinem nordamerikanischen Nachfolger dominiert und gesteuert.
Doch nicht allein diese Abhängigkeit vom europäischen Zentrum ist prägend für Modernisierungsprozesse in muslimischen Gesellschaften geworden. Es ist genauso der Umstand, dass jeder Schritt der Modernisierung dort immer nur als ein Nachholen dessen erschien, was in Westeuropa oder in Nordamerika, später auch in Ostasien, bereits erreicht war. Muslimische Gesellschaften, die über Jahrhunderte zu den reichsten und mächtigsten der Welt gehört hatten, waren nunmehr und sind bis heute Teil dessen, was man Dritte Welt nennt. Dies hat viele Verwerfungen ausgelöst.
Wir haben es in der muslimischen Welt mit einer Variante jener multiple modernities zu tun, von denen der Soziologe S. N. Eisenstadt spricht. Dieses Konzept geht davon aus, dass Modernisierung zwar überall auf der Welt stattgefunden, sich aber außerhalb des westeuropäisch-nordamerikanischen Kernraums nach anderen, jeweils eigenen Entwicklungsgesetzen vollzogen habe. Für Eisenstadt ist die Vielfältigkeit der Moderne insbesondere ein Ergebnis des Fortlebens lokaler kultureller Traditionen, die in unterschiedlicher Weise in das ursprünglich europäische Projekt der Moderne eingebaut wurden.2 Die Entstehung vielfältiger Modernen ist aber genauso ein Produkt des eben erwähnten Umstandes, dass Modernen außerhalb von Westeuropa und Nordamerika exogen und im Regelfall nachholend entwickelt wurden. Zudem liefen Prozesse der Modernisierung, die in Westeuropa ineinandergriffen, in der muslimischen Welt unabhängig voneinander und zeitversetzt ab. So hat eine Verstädterung ohne damit einhergehende starke Industrialisierung stattgefunden. Dies hat Auswirkungen auf weitere soziale Prozesse, etwa von Individualisierung, und auf das Funktionieren politischer Systeme.
Ein typisches Beispiel eines solchen Modernisierungsprozesses, der in der muslimischen Welt zwar in gleicher Weise, aber doch langsamer verlief als im Westen, ist der demographische Wandel. Vormoderne Gesellschaften waren durch eine hohe Geburtenrate und eine ebenso hohe Sterberate geprägt, Bevölkerungswachstum fand nur schleppend statt. Obwohl Frauen viele Kinder bekamen, sorgte eine hohe Kindersterblichkeit dafür, dass nur wenige dieser Nachkommen sich ihrerseits fortpflanzten. Ein weiteres Hemmnis stellten sich regelmäßig wiederholende Katastrophen wie Hungersnöte und Seuchen dar, die dafür sorgten, dass einmal erzielte Bevölkerungsgewinne oftmals rasch wieder dahinschwanden.
In Westeuropa waren Hungersnöte ab der Mitte des 19. Jahrhunderts dank technischer Fortschritte in der Landwirtschaft und der Möglichkeit des Imports aus Überschussgebieten wie den USA eine meist kriegsbedingte Ausnahme. Mit gewisser Verzögerung wurde dies auch in der muslimischen Welt im 20. Jahrhundert zum Normalfall, wobei neben dem technischen Fortschritt auch hier in den letzten Jahrzehnten der Import von Lebensmitteln eine zunehmend größere Rolle spielte. Der medizinische Fortschritt, insbesondere im Bereich der Hygiene, sorgte ab dem Ende des 19. Jahrhunderts und dann vor allem ab dem Zweiten Weltkrieg auch in der muslimischen Welt dafür, dass in einem nächsten Entwicklungsschritt die Kindersterblichkeit zurückging und sehr viel mehr Kinder als zuvor ins fortpflanzungsfähige Alter kamen. In gleichem Maße nahm auch die Lebenserwartung der Erwachsenen zu.
Der Abfall der Sterberate geht überall auf der Welt mit einer zunächst nach wie vor hohen Geburtenrate einher. Die Folge ist ein rapides Bevölkerungswachstum. Dieses rapide Bevölkerungswachstum nimmt schließlich langsam ab, weil die Menschen insbesondere in den Städten und da, wo sie über Zugang zu Bildungseinrichtungen verfügen, dazu neigen, weniger Kinder zu bekommen. In Westeuropa setzte dieser Prozess bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein und mündete schließlich in einem Zustand, in dem die Bevölkerung, sieht man von Wanderungszugewinnen ab, angesichts niedriger Geburtenraten sogar zu schrumpfen begann. In der muslimischen Welt können wir mit einer gewissen zeitlichen Verschiebung die gleiche Entwicklung beobachten. Der Höhepunkt des Bevölkerungswachstums lag in den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts. Danach nahm die Zahl der Geburten merklich ab. Die Bevölkerung wächst allerdings weiterhin, da viele junge Frauen im gebärfähigen Alter sind. Insbesondere seit den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts können wir aber auch in vielen Ländern des Vorderen Orients, wie etwa in Tunesien und Iran, beobachten, dass die Zahl der Geburten pro Frau kaum mehr über der Reproduktionsrate liegt, vor allem in der Stadt. Die Abnahme der Geburtenrate ist in der muslimischen Welt insbesondere in solchen Ländern zu beobachten, in denen der Bildungsgrad der Frauen besonders hoch ist. Andernorts vollzieht sich der Prozess langsamer. Die Richtung ist allerdings überall die gleiche.3
Sowohl in Westeuropa als auch in der muslimischen Welt sind Phasen besonders starken Bevölkerungswachstums geprägt durch eine hohe Auswanderungsneigung. Diese hat damit zu tun, dass die Möglichkeiten, Arbeit zu finden, für die nunmehr starke junge Generation insbesondere auf dem Lande nicht ausreichen. Junge Menschen ziehen folglich in die Stadt oder versuchen in anderen Staaten oder gar auf anderen Kontinenten ihr Glück. Die Existenz von europäisch beherrschten oder geprägten Einwanderungsländern insbesondere in Nordamerika hat dies für Europäer des 19. Jahrhunderts deutlich vereinfacht.
Den Menschen in der muslimischen Welt stellte sich die Situation in der ersten Phase des rapiden Bevölkerungswachstums bis zum Beginn der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts ganz ähnlich dar wie jenen in Europa einige Jahrzehnte zuvor. Viele zogen zunächst in die Städte. Während der Zeiten der Hochkonjunktur in Westeuropa nach dem Zweiten Weltkrieg waren zudem viele westeuropäische Länder bereit, Arbeitskräfte aus den ehemaligen Kolonien und generell aus den Ländern der Dritten Welt aufzunehmen, und haben diese aktiv angeworben. Auch der Öl-Boom in den Golfstaaten hat dafür gesorgt, dass viele Menschen aus Ländern mit hohem Bevölkerungswachstum, aber geringen wirtschaftlichen Entwicklungsstandes am Golf Arbeit finden konnten. Auswanderung ist in den letzten Jahrzehnten politisch zunehmend problematisch geworden. Die Ölstaaten bevorzugen Arbeitskräfte aus Süd- und Südostasien, die weniger Forderungen nach Gleichberechtigung stellen als arabische Arbeiter. In Westeuropa hat die schwierige wirtschaftliche Lage ab den 1970er Jahren und eine Zunahme ausländerfeindlicher, insbesondere auch islamfeindlicher Ressentiments in den letzten Jahrzehnten ebenfalls dazu geführt, dass die Einwanderung von Menschen vor allem aus der Dritten Welt kritisch gesehen wird. Hier wie dort haben diese Widerstände aber nicht zu einem Ende der Einwanderungsprozesse geführt. Diese dauern fort, solange die Ungleichheit der ökonomischen Lebenschancen anhält. Da es nunmehr in allen Einwanderländern starke Diaspora-Gemeinschaften aus den Herkunftsländern gibt und die Verkehrs- und Kommunikationsbedingungen sich seit den 60er Jahren deutlich verbessert haben, ist Auswanderung trotz des eben Gesagten in mancher Hinsicht sogar einfacher geworden.
Im Zusammenhang mit dem demografischen Übergang zur Moderne steht der Prozess der Verstädterung, der bereits angesprochen wurde. In vormodernen Agrargesellschaften überall auf der Welt lebte die große Mehrheit der Menschen auf dem Lande. Im Zuge der Modernisierung fand ein tiefgreifender Wandel statt, so dass schließlich überall auf der Welt die städtische Bevölkerung die Mehrheit darstellte. Das gilt auch im Nahen Osten. Ähnlich wie der demografische Übergang zur Moderne vollzog sich der Verstädterungsprozess in der islamischen Welt deutlich später als in Westeuropa. Erst in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg nahm die Entwicklung hier richtig Fahrt auf. Anders als in Westeuropa war sie nicht begleitet von einer raschen Industrialisierung. Obwohl viele Städte schnell an Bevölkerung gewannen, führte die fehlende Industrialisierung dazu, dass ein entsprechender Wandel der Wirtschafts- und Sozialstruktur nicht stattfand und vielfach (eine wichtige Ausnahme stellen die Türkei und die muslimischen Länder Südostasiens dar) bis heute ausgeblieben ist. Fabriken bieten nur wenigen Menschen Arbeit. Der Erwerb des Lebensunterhalts ist für die neuen Stadtbewohner schwierig. Soziale Netzwerke auf der Basis von Religion oder Herkunft spielen so für das Überleben der neuen städtischen Bevölkerung nach wie vor eine sehr große Rolle. Ohne Verwandte und andere Kontakte ist kein soziales Fortkommen möglich; Lebensrisiken wie Krankheit und Alter sind nicht zu bewältigen. Die durch die moderne Industriegesellschaft und mehr noch den Sozialstaat ermöglichten Prozesse der Individualisierung haben somit in der islamischen Welt ein deutlich schwierigeres Umfeld.4
Wenn so auch viele der Strukturen der vormodernen Gesellschaft in den Großstädten des Vorderen Orients nach wie vor lebendig sind, hat sich dennoch viel gewandelt. In der Vormoderne haben Frauen der Unterschichten auf dem Lande wie in der Stadt immer gearbeitet. Frauen der Mittel- und Oberschicht insbesondere in den Städten waren dagegen im Regelfall den größten Teil ihres Lebens im Hause. Ab den 1920er Jahren wandelte sich dies, zunächst langsam, dann ab den 50er Jahren immer schneller. Die Frauen der Mittel- und Oberschicht hatten Anteil an der Bildungsexpansion, die die Länder der muslimischen Welt nach Ende der Kolonialepoche kennzeichnete, und suchten mehr und mehr ihren Platz auch im Berufsleben. Damit gerieten traditionelle Modelle von Geschlechtertrennung, wie sie islamische Gesellschaften überall auf der Welt kennzeichnen, ins Wanken. Zunehmende westlich geprägte Bildung junger Frauen und Männer führte zudem dazu, dass sie für sich mehr und mehr moderne Formen von Familienleben wählten, die nicht auf der Verbindung zweier Familienverbände, sondern auf individueller Liebe und Partnerschaft beruhen. Nichtsdestoweniger haben sich traditionelle Muster von Familie in der muslimischen Welt stärker erhalten als im Westen. Auch ist die Integration der Frauen in den Arbeitsmarkt nach wie vor weniger fortgeschritten als in Westeuropa und vielen anderen außereuropäischen Kulturen. Dies gilt, obwohl das Bildungsniveau von Frauen und Mädchen in muslimischen Gesellschaften weltweit sich zunehmend an das der Männer angleicht, ja dieses sogar übertrifft. Diese Bildungsfortschritte vollziehen sich auf dem Lande und in den Unterschichten allerdings meist langsamer. Die vormodernen muslimischen Normen der Geschlechtertrennung im öffentlichen Raum, die in den Städten im Laufe der ersten 70 Jahre des 20. Jahrhunderts zunehmend ins Wanken geraten waren, werden in den letzten Jahrzehnten wieder verstärkt eingefordert. In der Praxis ist die Mischung der Geschlechter allerdings im städtischen Alltag heute fortgeschrittener denn je, ohne dass damit für die meisten Menschen eine Liberalisierung der Normen des Sexuallebens einhergegangen wäre. Diese Normen sind dabei oft einfach traditionell, werden von den Betroffenen aber im Regelfall mal mit, mal ohne Bezug auf Vorschriften des Gelehrtenislams religiös begründet.
Ein anderer Modernisierungsprozess, der für Westeuropa in den vergangenen 200 Jahren prägend war, ist die durchgreifende Säkularisierung aller gesellschaftlichen Bereiche. Organisierte und kollektive religiöse Praxis spielen heute für die meisten Menschen in Westeuropa keine entscheidende Rolle mehr. Die religiöse Zugehörigkeit ist nur noch in den seltensten Fällen ein zentraler Marker von Identität. Dieser Säkularisierungsprozess hat sich in Europa nicht ohne Kämpfe vollzogen. Diese waren insbesondere in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg meist zentral für die politische Positionierung einer Person. Erst die Auseinandersetzung um Sozialismus (und zeitweilig Faschismus) hat die Frage nach der öffentlichen Rolle der Religion als zentralen Faktor im europäischen politischen Tageskampf an Bedeutung verlieren lassen. Nach einem zeitweiligen Aufschwung des Einflusses der Religion unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg spielt sie heute für die meisten Menschen nur noch bei der Bereitstellung von rites de passage (Taufe, Heirat, Beerdigung) eine Rolle. Die Berufung auf konkrete religiöse Normen im Kontext politischer Forderungen ist dagegen selten und stößt vielfach auf Unverständnis. Mit diesem Rückgang der Bedeutung traditioneller religiöser Strukturen geht nicht für alle eine Entzauberung der Welt (d. h. insbesondere eine Vernaturwissenschaftlichung des Weltbildes) einher. Der Glaube an Esoterik bleibt aber in Westeuropa in der Regel ein individuelles, kaum kollektiv identitätsstiftendes Phänomen.
In der muslimischen Welt hat sich dieser Säkularisierungsprozess nicht in gleicher Weise vollzogen. Dass Religion in muslimischen Gesellschaften weltweit heute eine größere Rolle spielt als in Westeuropa, hat sicher zu einem guten Teil mit der eben beschriebenen Bedeutung sozialer Netzwerke in Gesellschaften der Dritten Welt zu tun. Andere Faktoren kommen aber hinzu. Kritik an Religion war und ist in muslimischen Ländern im Regelfall exogener Natur. Insbesondere in der Periode des Imperialismus und Postimperialismus war die Religion für viele Menschen einer der wenigen Ankerpunkte, der ihr eigenes Selbstbewusstsein heben konnte. Man lebte in einer Welt, die sich nicht nach den Regeln der eigenen, sondern nach denjenigen fremder Gesellschaften rapide wandelte. In den neuen Eliten fanden und finden sich immer wieder einzelne, die sich moderne westliche Konzepte von Religionskritik zu eigen machen. Für die meisten Menschen war das keine gangbare Strategie. Da die Religion auch mit den Werten von Familie und anderer Formen sozialer Gemeinschaft identifiziert wurde und wird, bot sie oft den einzigen sozialen und ideellen Halt.5 Man mochte zwar weniger mächtig als die Europäer sein, man war ihnen aber auf moralischer Ebene dank der wahren Religion überlegen.
Es wäre freilich falsch, die besondere Bedeutung von Religion für nahöstliche Gesellschaften als dem Islam inhärent anzusehen. Zum einen hat Religion in den 50er und 60er Jahren, als man berechtigterweise die Hoffnung hegen konnte, dass es den Nationalstaaten des Vorderen Orients gelingen würde, einen Modernisierungsprozess in Gang zu setzen, der die Bedürfnisse der Menschen befriedigt, eine vergleichsweise geringere Rolle gespielt als in unserer Gegenwart. Zum anderen ist auffällig, dass auch in den USA trotz der dort in vielerlei Hinsicht sehr viel weiter fortgeschrittenen Modernisierungsprozesse Religion nach wie vor eine sehr viel größere Rolle spielt als in Westeuropa. Der Bedeutungsverlust der Religionen in Westeuropa erscheint so als ein ganz eigenes Phänomen, das unter Umständen erklärungsbedürftiger ist als die immer noch große Bedeutung von Religion in muslimischen Gesellschaften. Im Vorderen Orient ist diese zudem sowohl für Muslime wie für Christen und in den letzten Jahrzehnten zunehmend auch für die jüdische Bevölkerung Israels zu konstatieren.6
Ein weiterer Modernisierungsprozess, der die muslimischen Gesellschaften in den letzten zwei Jahrhunderten geprägt hat, ist der Übergang von vormoderner, oft imperialer Staatlichkeit zu modernen Formen politischer Ordnung, die sich insbesondere im Nationalstaat manifestieren. Die heutigen Nationalstaaten gehen dabei nur in manchen Fällen auf vor dem 19. Jahrhundert bestehende politische Einheiten zurück (i. B. Ägypten, Marokko, Tunesien, in gewisser Weise auch Iran). Im Regelfall waren es die europäischen Imperialisten, die die Grundlage für die Entstehung moderner, sich antiimperialistisch gerierender Nationalstaaten im Vorderen Orient und in der übrigen muslimischen Welt gelegt haben. Es sind die Grenzen, die die imperialistischen Machthaber aus Europa gezogen haben, die heute als die natürlichen Grenzen politischer Ordnung erscheinen. Versuche, über diese nationalstaatliche Ordnung hinaus supranationale Ordnungen zu etablieren, insbesondere die Arabische Liga, dürfen als gescheitert betrachtet werden.
Die auf die Kolonialzeit zurückgehenden Staaten stellen so für die Menschen der muslimischen Welt in den meisten gesellschaftlichen Kontexten die zentralen Ordnungsfaktoren dar. Über ein immerhin zu konstatierendes Mindestmaß hinaus sind sie häufig nicht in der Lage, die Ausbildung und Gesundheitsversorgung oder auch das Vorhandensein einer grundlegenden Infrastruktur auf ihrem Territorium sicherzustellen. Sie sind allerdings in aller Regel, und das seit vielen Jahrzehnten, sehr wohl fähig, Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten und damit die Fortdauer der Herrschaft der jeweils bestehenden politischen Eliten zu ermöglichen. Nichtsdestoweniger übertreffen die Leistungen des modernen vorderorientalischen Staates in Bezug auf die Daseinsvorsorge für seine Bewohner die Möglichkeiten vormoderner imperialer und nicht-imperialer Staatlichkeit in der islamischen Welt bei weitem. Das Gleiche gilt in noch stärkerem Maße für die Fähigkeit moderner Staaten der Region, ihre Bürger politisch zu kontrollieren und in ihren Alltag, ja sogar in intimste Bereiche ihres Privatlebens vorzudringen.
Der folgende Überblick wird zunächst die Geschichte des Vorderen Orients in vier Etappen näher ins Auge fassen: erst die Phase der beginnenden Reform bis 1870, dann die Epoche der imperialistischen Durchdringung von 1870 bis nach dem Ersten Weltkrieg, weiter die Phase nationalistischer Ideologien und der auf Nationalstaaten beruhenden antiimperialistischen Befreiungsideologien und endlich die Zeit ab 1970. Diese ist von der Enttäuschung gegenüber nationalistischen Ideologien und über die nicht eingelösten Modernisierungsversprechen der vorderorientalischen Nationalstaaten geprägt. In dieser Phase erscheint ein stark politisiertes Verständnis von Islam als dominante Ideologie. Gleichzeitig ist fast überall die Stabilität autoritärer politischer Systeme durch klientelistische Strukturen und in vielen Staaten auch durch Renteneinnahmen, die von den Mächtigen an die Bevölkerung verteilt werden können, gewährleistet. Diese erstaunlich stabilen Strukturen sind im späten 20. und frühen 21. Jahrhundert zunehmend in Frage gestellt worden, insbesondere von Seiten der gut ausgebildeten städtischen Bevölkerung. Ideologisch konnten die Oppositionellen dabei durch den politischen Islam, im frühen 21. Jahrhundert dann auch erneut durch westliche Modelle von Demokratie geleitet werden. Die Revolutionen nach 2010 haben diese politischen Systeme teils nur an der Oberfläche berührt, teils aber auch zum völligen Zusammenbruch staatlicher Ordnung geführt.
Im Anschluss an diese Überblicksdarstellung vorderorientalischer Geschichte werden kontrastierend dazu die Verhältnisse sowohl auf dem indischen Subkontinent als auch in Südostasien dargestellt. Ein großer Teil dessen, was über den Vorderen Orient zu sagen ist, gilt freilich auch hier.