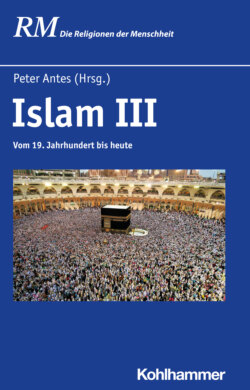Читать книгу Islam III - Группа авторов - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4 Die Zeit des Nationalismus von ca. 1925 bis 1970
ОглавлениеDie wirtschaftlich dominanten Großgrundbesitzereliten, die sich im 18. und 19. Jahrhundert herausgebildet hatten, mussten in den beiden einzigen nach dem Ersten Weltkrieg unabhängigen Ländern, Türkei und Iran, die politische Macht westlich gebildeten Militärs und Bürokraten überlassen. In beiden Ländern kam es nach 1920 zu einem deutlichen Bruch mit der vormodernen Epoche. Mustafa Kemal und Reza Schah sowie ihr Umfeld setzten alles daran, ihre Staaten nach westlichem, d. h. dem aus der Sicht der damaligen Zeit einzig modernen Vorbild, umzugestalten. Dabei sollte in beiden Fällen eine eigene Identität bewahrt werden, die weniger auf der Religion als auf einer nationalen, für manche sogar ethnisch-biologischen Eigenheit der Türken und Iraner beruhen sollte. Diese Maßnahmen standen ganz in der Tradition der weitgehend unkritischen Bewunderung für alles, was als europäisch galt, wie sie bereits im späten 19. Jahrhundert insbesondere im Osmanischen Reich weitverbreitet war.15
Die neuen Herrscher regierten ohne viel Rücksicht auf die Meinung des Volkes. Ja, die Türkei Mustafa Kemals wies in Teilen auch totalitäre Züge auf (Einparteiensystem, aktive staatliche Maßnahmen zur Formung der Bevölkerung bis in jedes Dorf). Einige seiner Vertrauten sympathisierten offen mit dem Faschismus Mussolinis, andere waren sozialistischen Ideen zugetan. Für Mustafa Kemal aber war, anders als in den Diktaturen des damaligen Europa, die totalitäre Unterwerfung der Gesellschaft nicht das Endziel. Vorbild in politischer Hinsicht blieben für ihn vielmehr die demokratischen Staaten, insbesondere Frankreich. Allerdings meinten er und seine Mitstreiter, dass die türkische Bevölkerung für ein demokratisches System noch nicht reif sei, sondern erst durch staatliche Erziehung in die Lage versetzt werden müsse, über ihr Schicksal mitzubestimmen. Insofern unterschieden sich die Ansichten der Kemalisten über die Menschen im Vorderen Orient nicht wesentlich von denen der britischen und französischen Kolonialherren. In Iran folgte das Regime des Schahs im Wesentlichen dem türkischen Vorbild, wobei die Probleme der Rückständigkeit, wie wir sahen, sich hier noch stärker stellten und Infrastrukturmaßnahmen, die in Anatolien in osmanischer Zeit umgesetzt worden waren (insbesondere der Ausbau der Verkehrswege), hier erst jetzt in Angriff genommen wurden.
Mit Nachdruck und, wo es nötig erschien, auch mit Blutvergießen, aber ohne die Exzesse der zeitgenössischen totalitären Diktaturen Europas wurde nun das staatliche Gewaltmonopol durchgesetzt, wurden Nomaden sesshaft gemacht und die infrastrukturellen Voraussetzungen für flächendeckende Schulbildung und wirtschaftliche Einbindung peripherer Provinzen geschaffen. Dabei war weniger als in der Zeit davor die Integration in den Weltmarkt das Ziel, sondern vielmehr die Schaffung einer in den Händen der einheimischen Muslime liegenden, möglichst autarken nationalen Wirtschaft. Ohne staatliche Eingriffe war das undenkbar. Doch derartige staatliche Eingriffe in Wirtschaft und Gesellschaft, auch die Idee der Autarkie, waren nach dem Ersten Weltkrieg weltweit diskutierte, wenn nicht akzeptierte Modelle. Sie wurden später auch in anderen Ländern der muslimischen Welt vorgenommen.
Die staatliche Planung der Wirtschaft blieb in der Türkei auch nach dem Ende der kemalistischen Einparteienherrschaft auf der Tagesordnung. Dieses Ende kam in dem Moment, da nach dem Zweiten Weltkrieg das amerikanische Modell sich in den Augen vieler als das erfolgreichste Gesellschaftsmodell erwiesen hatte und amerikanischer Schutz im Angesicht der bedrohlichen Nachbarschaft einer expansiven Sowjetunion eine Anpassung an amerikanische Normen gelegen sein ließ. Die Türkei vollzog nach 1945 als einziges muslimisches Land der Region den Übergang zur pluralistischen Demokratie, einer Demokratie allerdings, die ab 1960 zunehmend unter der Kuratel des Militärs stand. Klientelistische Politik, ineffiziente Formen staatlicher Wirtschaftslenkung und gewaltbereite Gruppen am rechten und linken Rand des politischen Spektrums sorgten für Instabilität. Allein der Geldzufluss durch die sogenannten Gastarbeiterüberweisungen aus Europa hielten das Land bis Ende der 70er Jahre über Wasser.
In Iran kam es nach dem Zweiten Weltkrieg nicht dauerhaft zu einer derartigen politischen Öffnung. Der Versuch des linksnationalistischen Ministerpräsidenten Mossadegh, sich durch Nationalisierung der Ölindustrie von der Unterwerfung unter Großbritannien symbolisch und praktisch zu lösen, scheiterte. Im Westen hielt man Mossadegh wie Nasser für einen potentiellen Verbündeten Moskaus. Westliche Geheimdienste organisierten einen Putsch, und der sowohl im Militär wie bei vielen Geistlichen unbeliebte Mossadegh wurde gestürzt. Die Macht Muhammad Rezas, des Sohns des ersten Pahlavi-Schahs, der 1941 von den Briten als Nachfolger seines deutschfreundlichen Vaters eingesetzt worden war, war vorerst gesichert. Dieser Putsch ist in der iranischen Geschichtserinnerung ein einschneidendes Ereignis. Tatsächlich hat der Schah in den Folgejahren, allerdings immer im außenpolitischen Windschatten der USA, einen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kurs verfolgt, der von dem linksnationalistischer Regime anderswo in der Region (etwa dem nasseristischen Ägypten) und im Zweifel auch von dem Mossadeghs gar nicht so weit entfernt war: Er verstaatlichte endgültig die Ölindustrie, führte eine moderate Landreform durch, bemühte sich um Ausweitung des Bildungswesens und verfolgte eine Politik nationaler Größe, die allerdings ganz auf seine Person zugeschnitten war.
In der arabischen Welt stellte die Zwischenkriegszeit, anders als in der Türkei und Iran, in sozialer und kultureller Hinsicht nicht in gleicher Weise einen Bruch dar. Unter der Oberhoheit von Briten und Franzosen wurde die Infrastruktur weiter ausgebaut, das Bildungsniveau der Bevölkerung nahm zu, doch geschah beides, gerade auch im Vergleich zur kemalistischen Türkei, relativ zögerlich. Die wirkliche Neuerung war, dass die Großgrundbesitzereliten ihre Herrschaft nun nicht mehr im Rahmen des Osmanischen Reiches, sondern in dem neuer politischer Einheiten ausübten. Diese politischen Einheiten bestehen in Form der modernen arabischen Nationalstaaten bis heute. Auch setzte sich der Prozess der Entstehung neuer Bildungsschichten fort, die langsam Anschluss an die Elite gewannen.
Im Verlauf des Zweiten Weltkriegs verstärkte sich zunächst noch einmal die imperiale Kontrolle über den Vorderen Orient und die islamische Welt. Die Maghreb-Länder, Westafrika und Britisch-Indien waren wie im Ersten Weltkrieg Rekrutierungsplätze für die Armeen der Franzosen und Briten. Tatsächlicher oder vermeintlicher Widerstand gegen die Einbeziehung der Kolonien und halbkolonialen Staaten in die alliierte Kriegführung wurde in Ägypten, Irak, Iran und Indien mit Gewalt gebrochen. Doch am Ende des Krieges stand der endgültige Zusammenbruch des imperialistischen Weltsystems. Dank der – wenn auch langsamen – Ausweitung der Schulbildung, die zu einer Politisierung der städtischen Jugend geführt hatte, wurde die Forderung nach Unabhängigkeit von immer breiteren sozialen Gruppen unterstützt. Die neuen Weltmächte, die USA und die UdSSR, lehnten das Prinzip kolonialer Herrschaft ohnedies ab. Die Kolonialmächte hatten nunmehr weder die militärische und wirtschaftliche Kraft noch die Idee der eigenen natürlichen Überlegenheit, die seinerzeit die Errichtung der Kolonialsysteme begleitet hatten. Eine Fortführung hätte, um moralisch gerechtfertigt werden zu können, jetzt zudem anders als zuvor eine aktive, mit finanziellen Lasten für die Kolonialmächte verbundene Entwicklungspolitik erfordert. Zu einem solchen Imperialismus, der mit großen Kosten verbunden gewesen wäre, waren die Westeuropäer nicht bereit. Innerhalb weniger Jahre nach Kriegsende wurden so fast alle europäischen Kolonien unabhängig. In der muslimischen Welt kam es in diesem Zusammenhang nur in Algerien und Niederländisch-Indien (Indonesien) zu langwierigen und blutigen Kriegen. Dies erklärte sich, wie wir sahen, im algerischen Fall mit der Rolle der Siedler, im indonesischen mit der großen Bedeutung der Kolonie für das nach dem Zweiten Weltkrieg angeschlagene niederländische Selbstbewusstsein.
So scheiterte das älteste europäische Siedlungsprojekt im Vorderen Orient Anfang der 1960er Jahre. Ein anderes derartiges Projekt, das unter für die Siedler zunächst viel widrigeren Umständen begonnen worden war, konnte dagegen aus der Sicht seiner Protagonisten erfolgreich abgeschlossen werden: die zionistische Besiedlung Palästinas. Die Überlebenden der Shoah suchten nach dem Zweiten Weltkrieg in großer Zahl nach Palästina einzuwandern. Sie daran zu hindern erschien angesichts des Geschehenen moralisch problematischer als zuvor. Die zionistische Staatsgründung wurde nach dem Zweiten Weltkrieg nicht allein von den Westmächten unterstützt, die angesichts der deutschen Verbrechen, gegen die sie nichts unternommen hatten, in einer schwierigen Lage waren. Zustimmung kam auch von der Sowjetunion, deren Führung im Zionismus ein fortschrittliches Element in einem aus ihrer Sicht feudal-reaktionären nahöstlichen Umfeld sah. Es waren jedoch nicht allein diese Unterstützung, sondern auch die Organisationskraft und der Kampfgeist der israelischen Truppen, die es ihnen ermöglichten, die verbündeten arabischen Nachbarstaaten zu besiegen und die Grenzen des neuen Staates jenseits des im UN-Teilungsplan für Palästina Vorgesehenen zu verschieben. Ein großer Teil der palästinensischen Bevölkerung war während des Krieges aus dem Gebiet des entstehenden Israel geflohen oder vertrieben worden. Eine Rückkehr wurde ihnen von israelischer Seite nicht gestattet. Sie lebten in der Folge als selbstbewusste palästinensische Diaspora unter nicht immer einfachen Bedingungen in den Nachbarstaaten und zunehmend auch anderswo auf der Welt. Diese Diaspora kann seitdem auf die verbal artikulierte, aber nicht immer von Taten begleitete Solidarität der muslimischen Welt zählen. Die aus ihrer Sicht vom Westen (mit)verantwortete nakba, die »Katastrophe« der palästinensischen Vertreibung, ist für Muslime weltweit seitdem ein zentraler Baustein in ihrer Wahrnehmung einer vom Westen zu Lasten der Muslime beherrschten Weltordnung. Weniger im Bewusstsein der muslimischen Welt ist der Umstand, dass in der Folge der israelischen Staatsgründung der Druck auf die jahrtausendealten jüdischen Gemeinden des Vorderen Orients, etwa in Form von Pogromen, so weit wuchs, dass sie innerhalb weniger Jahre fast gänzlich auswanderten. Nicht wenige haben in Israel eine neue Heimat gefunden und waren dort lange Zeit Opfer von Diskriminierung von Seiten der dominanten europäischen Einwanderer.
Das Desaster der nakba, insbesondere das klägliche Scheitern der arabischen Armeen, delegitimierte die Machtstellung der bis dahin herrschenden Großgrundbesitzereliten und mit ihr die Dominanz der von diesen getragenen liberalen politischen Ordnungsvorstellungen in der arabischen Welt. In den Folgejahren gelangten in vielen Ländern über Militärputsche Offiziere zur Macht, die aus den Mittelschichten stammten. Sie fühlten sich zu einer grundlegenden Umgestaltung ihrer jeweiligen Länder im Interesse der einfachen Volksmassen berufen. Für Mustafa Kemal war eine Türkei wie das Frankreich der Dritten Republik Ziel all seiner Bemühungen. Die revolutionären Offiziere der arabischen Welt nach dem Zweiten Weltkrieg orientierten sich nicht mehr am westeuropäischen Modell. Für sie lag die Zukunft in einem vage definierten Sozialismus, z. T. suchten sie das Bündnis mit der Sowjetunion. Unter den Bedingungen des Kalten Krieges waren die Westmächte nicht mehr unverzichtbar, wenn man Hilfe bei der Modernisierung des Landes oder zur Aufrüstung der Armee benötigte.
Diese modernisierenden Militärregime gingen zunächst recht erfolgreich daran, mit großen symbolischen Gesten die Unabhängigkeit von den ehemaligen Kolonialmächten deutlich zu machen. Dazu gehörte nicht zuletzt die Verstaatlichung des Suezkanals in Ägypten, die mit sowjetischer und amerikanischer Unterstützung auch gegen den militärischen Widerstand Großbritanniens und Frankreichs durchgesetzt werden konnte. Auch gelang es, den Bildungssektor massiv auszuweiten und endlich den allgemeinen Schulbesuch weitgehend durchzusetzen. Vorsichtige Landreformen schwächten die alten Eliten und schufen eine neue ländliche Mittelschicht. Auf Dauer weniger glücklich waren die Versuche, auf dem Wege staatlicher Steuerung eine importsubstituierende und auf Autarkie ausgerichtete Industrialisierungspolitik zu unternehmen. Die Ergebnisse waren oft nicht effizient und rissen immer größere Löcher in die staatlichen Haushalte. Die Bevölkerungsexplosion führte schließlich zu wenig gesteuerter Verstädterung. Den Absolventen der neu geschaffenen Bildungseinrichtungen konnten zunehmend keine adäquaten Beschäftigungsmöglichkeiten mehr geboten werden. Auf diese Weise geriet das revolutionäre Modell in die Krise. Wie 1948 die Krise der monarchischen Regime durch die nakba wurde diese Krise durch ein Ereignis manifest: den Sechs-Tage-Krieg von 1967. Die revolutionären Regime der arabischen Welt, allen voran das Ägypten Nassers, erwiesen sich trotz aller Rhetorik als militärisch genauso inkompetent wie ihre Vorgänger. Israel besiegte in kürzester Zeit alle seine arabischen Nachbarn und besetzte dabei das Jordan-Westufer mit Jerusalem, die syrischen Golanhöhen und den Sinai. Am Eindruck des Scheiterns der modernisierenden Militärregime und ihrer Ideologie des panarabischen Nationalismus vermochte auch der etwas erfolgreicher verlaufende Jom-Kippur-Krieg von 1973 nichts zu ändern.