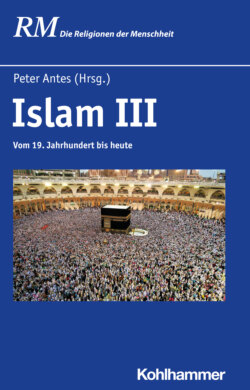Читать книгу Islam III - Группа авторов - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 Der Vordere Orient von 1800 bis 1870
ОглавлениеViele Jahrhunderte lang waren die muslimischen Gesellschaften den europäischen militärisch überlegen gewesen. Das Blatt wendete sich im späten 17. und frühen 18. Jahrhundert, zunächst unmerklich, dann immer deutlicher. In den sogenannten Türkenkriegen gelang es den Österreichern und ihren Verbündeten, später auch Russland, die osmanische Vorherrschaft auf dem Balkan und im Bereich des Schwarzen Meeres mehr und mehr ins Wanken zu bringen. Die Briten verstanden es ab der Mitte des 18. Jahrhunderts, ihre Herrschaft über Bengalen auf immer weitere Teile des indischen Subkontinents auszuweiten und lokale Fürsten zu ihren Klienten zu machen. War dies alles für muslimische Herrscher bereits beunruhigend, so mussten die Entwicklungen während der französischen Revolutionskriege den Verantwortlichen im Vorderen Orient endgültig die Augen für die Notwendigkeit eines tiefgreifenden Wandels im militärischen Bereich öffnen. Ein französisches Expeditionskorps unter Napoleon Bonaparte eroberte im Jahr 1798 Ägypten und unterwarf den ägyptisch-syrischen Raum für einige Jahre französischer Herrschaft. Der osmanische Sultan wie die ägyptischen Provinztruppen standen den Ereignissen weitgehend hilflos gegenüber.
Bereits ab der Mitte des 18. Jahrhunderts hatten die Osmanen versucht, sich mit Hilfe ausländischer, insbesondere französischer, aber auch ungarischer Offiziere militärtechnisch auf den neuesten Stand zu bringen. Sultan Selim III. (reg. 1789–1807) hatte nach seiner Thronbesteigung in Korrespondenz mit dem französischen König gestanden und es unternommen, eine neue, nach europäischem Muster ausgebildete Truppe aufzustellen. Dieser Versuch der militärischen Modernisierung stieß jedoch auf den Widerstand der traditionellen Kräfte innerhalb der Armee, insbesondere der wichtigsten Infanterieeinheiten, der Janitscharen. Deren Aufstand gegen den Sultan im Jahr 1807 führte zu seiner Absetzung und schließlich zu seiner Ermordung im folgenden Jahr. Der Versuch tiefgreifender militärischer Veränderungen im Zentrum des Osmanischen Reiches konnte somit zunächst als gescheitert angesehen werden.
Es war nicht das Zentrum, sondern die ägyptische Provinz des Osmanischen Reiches, von der nach Abzug der Franzosen die Erneuerung im vorderorientalischen Militär ausging. Ein vom Balkan entsandter Gouverneur, Mehmet Ali Pascha, versuchte, die traditionelle militärische Elite Ägyptens, die Mamluken-Armee, die seit dem Mittelalter das Land unter osmanischer Oberherrschaft verwaltet und ausgebeutet hatte, zu beseitigen. Die Führer der Mamluken wurden hingerichtet, und Mehmet Ali Pascha begann, eine neue, zunächst aus sudanesischen Sklaven rekrutierte Truppe aufzustellen. Als dies an der hohen Sterblichkeit der neuen Sklavensoldaten scheiterte, entschied Mehmet Ali sich für Wege der Rekrutierung, wie es sie im muslimischen Vorderen Orient seit den ersten Jahrhunderten des Islams nicht mehr gegeben hatte: Er führte eine allgemeine Wehrpflicht ein, der insbesondere auch die ägyptischen Bauern unterworfen wurden. Dass die ägyptischen Bauern an ihrer Rekrutierung keine große Freude hatten und sich dieser, soweit es ging, zu entziehen suchten, tat dabei nichts zur Sache. Für die Ausrüstung seiner Truppen gründete Mehmet Ali Fabriken, in denen zum Teil sogar Dampfmaschinen eingesetzt wurden. Er entsandte Ausbildungsmissionen nach Europa, mit deren Hilfe Angehörige der politischen und militärischen Elite in modernen europäischen Wissenschaften ausgebildet werden sollten, vor allem soweit sie für das Militär von Bedeutung waren. Auf diese Weise gelang es Mehmet Ali, eine Armee aufzustellen, die deutlich stärker war als die Truppen der osmanischen Zentralregierung, als deren Gouverneur er über Ägypten herrschte. Ab dem zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts waren die Ägypter so für einige Zeit die stärkste Militärmacht im Nahen Osten. Sie unterwarfen 1818 im Namen des Sultans die rebellischen Wahhabiten auf der arabischen Halbinsel. Sie kämpften in den 1820er Jahren im Auftrag des Sultans gegen die griechischen Aufständischen auf der Peloponnes und wandten sich schließlich ab den 1830er Jahren gegen die Zentralregierung selbst. Die erfolgreich vorrückenden ägyptischen Truppen bedrohten sogar die Hauptstadt Istanbul. Allein dem Eingreifen der Briten und Russen war es zu verdanken, dass das Osmanische Reich diese schwere Krise unbeschadet überstand. Keine der beiden Mächte wollte ein potentiell gefährliches Ägypten an die Stelle des geschwächten Osmanischen Reiches treten sehen. Mehmet Ali wurde mit der erblichen Würde eines Gouverneurs über Ägypten betraut, musste aber weitergehende Herrschaftsansprüche aufgeben. Gleichzeitig erzwangen die Briten die Öffnung des ägyptischen Marktes für britische Importe. In der Forschung ist strittig, ob damit ein eigenständiger ägyptischer Weg zur Industrialisierung zunichtegemacht worden ist.
Um die für seine neuartige Armee notwendigen Ressourcen zu gewinnen, hatte Mehmet Ali nämlich nicht allein den Steuerdruck auf die Landbevölkerung erhöht. Er bemühte sich gleichzeitig um eine erhöhte landwirtschaftliche Produktivität. Dies und die bereits erwähnten Fabriken haben unzweifelhaft eine gewisse wirtschaftliche Dynamik in Gang gesetzt. Anders als in den sich industrialisierenden Regionen Europas geschah dies hier aber durch den Einsatz außerökonomischen Zwangs: Nicht für ihren Lebensunterhalt arbeiteten die Bauern in den Fabriken, sie wurden staatlicherseits dazu verpflichtet. Der im Vergleich zu Westeuropa geringere Bildungsstand der Bevölkerung tat ein Übriges, der Verwendung von komplexeren Maschinen Grenzen zu setzen. Insofern unterschieden sich die Versuche, in Ägypten staatlicherseits eine wirtschaftliche Modernisierung im Interesse der Armee zu organisieren, von vorneherein deutlich vom britischen Modell. Nach der Marktöffnung waren die Produkte der ägyptischen Fabriken trotz der Transportkosten der Importeure genauso wenig konkurrenzfähig wie die ägyptischen Truppen gegen das europäische Militär.
Die Modernisierungsbemühungen Mehmet Alis wurden trotz aller Probleme von seinen Nachfolgern fortgesetzt. Ägypten wurde so im späten 19. Jahrhundert zum fortschrittlichsten Land des Vorderen Orients. Das galt insbesondere für die Infrastruktur, für die Weltläufigkeit der Elite und die Öffnung zum Weltmarkt, für den man insbesondere Baumwolle lieferte. Die Autonomie Ägyptens darf dabei nicht mit der Entstehung eines ägyptischen Nationalstaats gleichgesetzt werden. Die führenden Kreise des Landes, insbesondere die Umgebung des Gouverneurs, stammten häufig vom Balkan und verstanden sich als Osmanen. Arabischsprachige Ägypter (außerhalb der islamischen Gelehrtenschaft) konnten sich erst im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts Gehör verschaffen.7
Dass der Sultan in Istanbul gegen seinen übermächtigen ägyptischen Gouverneur schließlich die Europäer zur Hilfe hatte rufen müssen, lag an der Schwäche der osmanischen Zentralregierung. Die bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts vorgenommenen Militärreformen waren entweder nicht weit genug gegangen oder – wie wir sahen – am Widerstand militärischer Interessengruppen gescheitert. In Ostanatolien, den arabischen Provinzen, aber auch auf dem Balkan, der wirtschaftlich wie politisch bedeutendsten Region des Reiches, war die Kontrolle des Sultans über weite Regionen recht eingeschränkt. Lokale Kleinfürsten bestimmten das Bild. Eine Reihe von diesen machte dem Aufstand gegen Selim III. ein Ende und setzte nach dessen Ermordung durch die Aufständischen einen neuen Sultan, Mahmud II. (reg. 1808–1839), ein. Angesichts der Umstände des Todes seines Cousins und Vorgängers Selim war dieser jedoch zunächst sehr vorsichtig, wenn es darum ging, die Erneuerung des Militärs und des Staatsapparates voranzutreiben. Er war bemüht, keine der wichtigen Interessengruppen in der Hauptstadt vor den Kopf zu stoßen. Zunächst suchte er daher noch mit Hilfe der alten Truppen die Kontrolle über den Balkan wiederzugewinnen. Erst Mitte der 20er Jahre nahm er die Modernisierungsbestrebungen wieder auf. Wie in Ägypten begannen die Militärreformen mit der gewaltsamen Ausschaltung von potentiell renitenten Teilen der bisherigen Armee. Im sogenannten »Heilsamen Vorfall« des Jahres 1826 wurde die Janitscharen-Truppe ausgeschaltet. Ihre Angehörigen in der Hauptstadt wie in der Provinz wurden, soweit sie nicht in die neue Armee integriert wurden, verfolgt und umgebracht. Eine moderne, nach europäischen Maßstäben ausgerüstete und trainierte Truppe sollte an ihre Stelle treten. Diese war zwar zunächst nicht stark genug, Mehmet Ali und seine ägyptischen Soldaten in die Schranken zu verweisen, sie war aber sehr wohl in der Lage, sowohl auf dem Balkan als auch in Anatolien und, nach der erwähnten Unterwerfung Mehmet Alis, in den ostarabischen Provinzen Syrien und Irak der osmanischen Zentralregierung wieder zu Autorität zu verhelfen. Die Epoche der Dezentralisierung, die das Osmanische Reich seit dem 17. Jahrhundert geprägt hatte, ging zu Ende.
Der hier im osmanischen Kontext beobachtete Prozess von Dezentralisierung im 17. und 18. Jahrhundert und Rückkehr der Zentralmacht im 19. Jahrhundert ereignete sich in ähnlicher, aber deutlich abgeschwächter Weise in Iran. Hier kam es im 18. Jahrhundert zum Zerfall des safawidischen Reiches unter wiederholten Angriffen nomadischer Gruppen. Dies geschah sowohl von der Peripherie her als auch aus dem Zentrum des Reiches selbst heraus. Erst ganz am Ende des 18. Jahrhunderts verstand es eine dieser nomadischen Gruppen, der Stammesverband der Kadscharen, das iranische Territorium wieder zu einen und eine neue, bis zum Jahr 1925 herrschende Dynastie zu begründen. Diese hatte ihr Zentrum nicht mehr wie die Safawiden im Südwesten des Landes, sondern in Teheran. Die Herrschaft der Kadscharen erstreckte sich zwar über das gesamte Territorium des heutigen Iran und einige Randgebiete im Norden und Osten. Die Kadscharen waren jedoch deutlich weniger als die Osmanen im 19. Jahrhundert in der Lage, das ganze Land einheitlichen Regeln zu unterwerfen. In den Provinzstädten residierten lokale Angehörige der Herrscherfamilie und herrschten im Bündnis mit lokalen Eliten. Kontakte zur Hauptstadt blieben, auch wegen der bis weit ins 20. Jahrhundert schwierigen Verkehrsbedingungen, eher selten.
Im Vergleich zu den Nachbarn im Osten erschien das Staatswesen der Osmanen im 19. Jahrhunert als ein Hort der Modernität. Nachdem die Militärreformen die Autorität des Zentrums wiederhergestellt hatten, begannen in den 1830er Jahren tiefgreifende Reformen, die man »Reorganisationsmaßnahmen«, osmanisch-türkisch tanzimat, nannte. In einem sultanischen Erlass, der nicht zufällig auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzungen mit Mehmet Ali erging, wurde allen Untertanen Sicherheit von Leben und Eigentum zugestanden. Gleichzeitig wurde grundsätzlich die Gleichberechtigung der Nichtmuslime mit den Muslimen gewährt. Dieser Erlass war nicht allein im Interesse der Nichtmuslime, das den Europäern besonders am Herzen lag. Er diente mit der erstgenannten Bestimmung mehr noch den Interessen der weit überwiegend muslimischen Angehörigen der Bürokratie. Bis dahin war es für den Sultan möglich und gängige Praxis gewesen, missliebig gewordene Bürokraten nicht nur abzusetzen, sondern auch hinzurichten und ihr Vermögen einzuziehen. Nunmehr waren Leib und Leben der führenden Männer des Staates geschützt.
Die Jahrzehnte zwischen 1840 und 1880 stellen den Höhepunkt bürokratischer Herrschaft im späten Osmanischen Reich dar. Die hohen Bürokraten, frei von Furcht und dank ihrer im diplomatischen Dienst und durch Lektüre erworbenen Kenntnisse europäischer Verhältnisse unverzichtbar, trieben die Reformen im gesamten Reich voran. Zu diesen Reformen gehörte insbesondere die Einführung einer allgemeinen Wehrpflicht nach ägyptischem Vorbild. Diese wurde allerdings nur gegenüber den Muslimen wirklich durchgesetzt. Die Christen wurden des Prinzips der Gleichberechtigung ungeachtet gegen Zahlung einer Ersatzsteuer von der Wehrpflicht ausgenommen. Man bemühte sich auch um Reformen im Steuerwesen. Diese waren für jede Modernisierung des Staates, die ja ohne eine Verbreiterung der Finanzbasis nicht möglich war, zentral. Die Steuerlast der osmanischen Untertanen war bislang geringer als die etwa der Briten gewesen. Die Eintreibung der Gelder oblag im Osmanischen Reich privaten Pächtern, die dem Staat gegenüber in Vorleistung traten und dafür das Recht der Steuererhebung erhielten. Dieses System der Steuerpacht sollte nun abgeschafft werden. Die bürokratischen Mechanismen für die Einrichtung einer umfassenden zentralisierten Steuereinnahme waren aber im Reich nicht vorhanden. Insofern wurde allen Absichtserklärungen zum Trotz auch in den folgenden Jahrzehnten ein großer Teil der Steuern weiter auf dem Wege der Steuerpacht eingenommen. Die Steuerpächter waren im Regelfall Angehörige der Großgrundbesitzerelite, die sich seit dem 18. Jahrhundert im Osmanischen Reich herausgebildet hatte. Zwar war im Prinzip aller Grund und Boden Eigentum des Sultans. In der Realität allerdings war es einigen reichen Bauern, Angehörigen der militärischen Eliten, Geldverleihern und ähnlichen Personen gelungen, in den Besitz von Grund und Boden zu kommen, indem sie Bauern Geld oder Saatgut vorstreckten. Diese agrarische Elite profitierte besonders von den Reformen und den neuen ökonomischen Bedingungen des 19. Jahrhunderts. Dies gilt in zweierlei Hinsicht: zum einen insofern, als durch das osmanische Landgesetz des Jahres 1858 der bis dahin rein informelle Grundbesitz nunmehr in reguläres Eigentum überführt wurde. Die meisten Bauern waren zu uninformiert oder, da sie Steuerforderungen in der Folge fürchteten, auch nicht interessiert daran, ihr Eigentum beim Katasteramt registrieren zu lassen. Sie waren insofern ganz froh, wenn der Steuerpächter, ein hoher Beamter oder ein Stammesoberhaupt ihnen diese Aufgabe abnahm und ihr Land in seinem Namen registrierte. Die neuen Großgrundbesitzer profitierten aber nicht alleine in rechtlicher Hinsicht von den Reformen. Sie profitierten auch insofern, als sich gleichzeitig eine Öffnung des Osmanischen Reiches gegenüber dem Weltmarkt vollzog. Dies gilt nicht zuletzt für Baumwolle, die sich dank der Industriellen Revolution in Großbritannien im 19. Jahrhundert einer ungeheuren Konjunktur erfreute. Durch den Ausfall der Lieferungen aus den USA während des Sezessionskrieges wurde diese Hochkonjunktur im Vorderen Orient noch zusätzlich angeheizt.
Der Handel zwischen dem Osmanischen Reich und dem Rest der Welt vervielfachte sich so im Laufe des 19. Jahrhunderts. Auch nahm die Wirtschaftsleistung des Reiches in ihrer Gesamtheit deutlich zu. Neben den Großgrundbesitzern waren es insbesondere christliche, zuweilen auch jüdische Zwischenhändler, die von dieser neuen wirtschaftlichen Situation profitierten. Für viele Kleinunternehmer, insbesondere im Bereich der Teppichweberei, bedeutete der neue Zugang zum Weltmarkt sogar eine Chance. Das heißt allerdings nicht, dass es jetzt allen Menschen besser gegangen wäre: Der neue Wohlstand war ungleich verteilt. Profitieren konnten diejenigen, denen der neue Weltmarktzugang Möglichkeiten eröffnete, während Personen in Hafenstädten oder anderen verkehrsgünstig gelegenen Regionen, die bis dato von der Weberei gelebt hatten, sich wie die aus Hauptmanns Theaterstück bekannten schlesischen Weber der vollen Wucht der insbesondere britischen industriellen Konkurrenz ausgesetzt sahen. Welche Rolle in diesem Kontext das Handelsabkommen von Balta Liman spielte, das die Briten dem Osmanischen Reich im Gegenzug für ihre Hilfe gegen den ägyptischen Gouverneur Mehmet Ali im Jahr 1838 aufgezwungen hatten (s. oben), bleibt unklar. Man wird davon ausgehen können, dass auch ohne die niedrigen Zollsätze, die dieses Abkommen vorsah, ein großer Teil der günstigen britischen Industriewaren, gegebenenfalls auf dem Weg des Schmuggels, in leicht zu erreichende osmanische Städte gelangt wäre.8
Es waren so neben den hohen Bürokraten und Militärs insbesondere die Großgrundbesitzer, die von den Veränderungen profitierten. Zum anderen waren es die religiösen Minderheiten, die bis ins 19. Jahrhundert eine zwar wichtige, aber doch untergeordnete Rolle im Osmanischen Reich gespielt hatten. Angesichts der neuen Bedingungen hatte es für viele Muslime den Anschein, als seien die Christen nunmehr gar privilegiert. Sie verfügten über Kontakte zu den europäischen Mächten, die sie vor den Übergriffen der osmanischen Bürokratie schützten, sie waren gleichzeitig Mittelsmänner im sich neu formierenden, europäisch dominierten vorderorientalischen Wirtschaftsraum.
Aber nicht allein die Verteilung politischer und wirtschaftlicher Macht wandelte sich; auch das kulturelle Kapital der bis dahin dominanten muslimischen Bevölkerungsgruppe wurde entwertet. Klassisches osmanisches Bildungsgut, wie es insbesondere an islamischen Medresen gelehrt und darüber hinaus an der traditionellen Hofschule des Sultans den Nachwuchskräften der Bürokratie vermittelt wurde, verlor an Wichtigkeit. Das Wissen, auf das es jetzt ankam, stammte aus Europa. Dieses Wissen erlangten wenige besonders privilegierte Angehörige der Bürokratie durch Studienaufenthalte in Frankreich oder Großbritannien, andere durch Ausbildung an wenigen neu eingerichteten Akademien wie der Militärakademie und der zivilen Verwaltungsakademie. Die Literatur, die in diesem Milieu gelesen wurde, war zunehmend weniger die klassisch islamische Literatur arabischer, türkischer und persischer Sprache. Es war europäische Literatur, teils auf Französisch, teils in osmanischer Übersetzung. Eine neue Medienwelt entwickelte sich, für die nicht allein die Lehrbücher standen, wie sie an den Akademien benutzt wurden, sondern auch Zeitungen. Diese Medien ermöglichten es den wenigen Menschen, die in der Lage waren, zu lesen und zu schreiben, über die politischen Verhältnisse im Lande und notwendige Reformen zu diskutieren. Erstmals bildete sich im Vorderen Orient eine weite Räume, ja das ganze Reich umfassende politische Öffentlichkeit heraus. Dies ermöglichte es den Angehörigen der Elite nicht allein, die von ihnen gewünschten Reformen zu diskutieren, sondern potentiell auch Kritik an Sultan und Ministern zu üben. Diese Kritik konnte den Mangel an Reformwillen zum Gegenstand haben, genauso aber ein als übertrieben angesehenes Nachahmen westlicher Verhaltensweisen und Vorstellungen. In jedem Fall ging es den verschiedenen Seilschaften und Interessengruppen innerhalb der bürokratischen Eliten darum, ihre Position im Ringen um die Macht, aber auch um die richtigen Ideen für die Zukunft des Reiches weiter zu festigen. In den Jahren vor 1870 gelangten so zentrale Konzepte der europäischen Moderne wie politische Freiheit und Vaterland in das Osmanische Reich und von da aus in den Kadscharischen Iran.9
In den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts gerieten die Reformbemühungen in eine Krise. Dies hatte einerseits mit erneuten verlustreichen Kriegen auf dem Balkan zu tun und in der Folge mit der Notwendigkeit, muslimischen Flüchtlingen aus verlorenen Territorien im verbliebenen Reichsgebiet eine Heimat zu gewähren. Es lag aber zudem vor allem daran, dass der Zwang zu militärischer Modernisierung und zur Errichtung einer das gesamte Reich durchdringenden Bürokratie mit großem finanziellem Aufwand verbunden war. Diesem waren die Finanzbürokratie, aber auch die Wirtschaft des Osmanischen Reiches im Ganzen wie seiner autonomen Provinzen Ägypten oder Tunesien nicht gewachsen. Ähnlich sah es im kadscharischen Iran aus. Es kam daher in den 70er Jahren überall im Vorderen Orient zu Finanzkrisen. Geld, das man zuvor für Modernisierungsprojekte einfach hatte leihen können, war immer schwieriger aufzutreiben. Europäische Gläubiger verlangten angesichts der wachsenden Risiken, die mit Anleihen in der Region verbunden waren, noch höhere Zinsen als zuvor. Die Staaten waren zusehends weniger in der Lage, Altschulden zu bedienen.
Das galt insbesondere in Ägypten, wo durch den weitgehend unabhängigen Gouverneur, der nunmehr den Titel eines Khediven (Fürsten, Vizekönigs) trug, das aufwendigste der infrastrukturellen Modernisierungsprojekte des 19. Jahrhunderts betrieben wurde: der Bau des Suezkanals. Dieser sollte zunächst zu einem guten Teil in ägyptischem Eigentum sein. Angesichts des Umstandes aber, dass der Khedive nicht imstande war, die Schulden, die er zum Bau des Kanals aufgenommen hatte, zu bedienen, kamen seine Aktien in die Hände der britischen Regierung. Für diese war die Kontrolle über Ägypten durch den Kanal wichtiger als je zuvor. Ägypten war die zentrale Achse auf dem Weg zwischen Großbritannien und Indien. Ägyptischer Widerstand gegen britische Einflussnahme auf den Khediven wurde militärisch gebrochen und das Land geriet 1882 unter informelle britische Kontrolle.
Frankreich errichtete, um italienische Ansprüche abzuwehren, mit Rückendeckung Bismarcks ungefähr gleichzeitig ein Protektorat über die autonome osmanische Provinz Tunesien. Die Kernprovinzen des Osmanischen Reiches mussten in den 1870er Jahren zwar im Krieg gegen Russland und die sich aus dem Reichsverband lösenden Balkanstaaten eine schmerzliche Niederlage hinnehmen. Zudem wurde auch die Zentralregierung 1881 zahlungsunfähig. Anders als im Fall Ägyptens oder Tunesiens jedoch waren aber, was die osmanische Zentralmacht anging, die Großmächte nicht gewillt, einer Nation die Kontrolle über das Reich zu überlassen. Auch das Reich unter sich aufzuteilen war für sie keine Option. Sie richteten vielmehr eine internationale Schuldenverwaltung ein, die für die ihr auf dem Boden des Reiches zufallenden Steuern eine nicht unter osmanischer Regierungskontrolle stehende moderne Steuerbürokratie schuf. So wurden die Interessen der Gläubiger des Reiches auf Kosten der osmanischen Souveränität bedient.
Die Schuldenkrisen der 1870er und 80er Jahre stellten einen wichtigen Einschnitt in der Geschichte des modernen Vorderen Orients dar. Die Europäer strebten nunmehr immer offener eine direkte Beherrschung des Vorderen Orients und der übrigen noch nicht unter Kolonialherrschaft stehenden Teile der Alten Welt an.