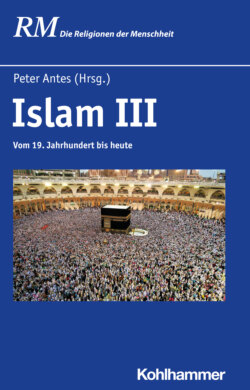Читать книгу Islam III - Группа авторов - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEine islamistische Machtübernahme gelang (mit Ausnahme Irans) nur da, wo islamistische Militärs putschten. Doch war der Islamismus in seinen gewaltfreien wie in seinen gewaltbereiten Spielarten seit der Mitte der 70er Jahre eine dauernde Bedrohung für die Stabilität der Regime der islamischen Welt. Die Regierenden bemühten sich, die Islamisten durch konservativ-islamische Maßnahmen in für ihre Macht ungefährliche Bereichen einzubinden (Geschlechterpolitik, Moscheebau). Gewaltbereite Islamisten wurden auf andere Wirkungsfelder verwiesen. Dies war insbesondere der Dschihad in Afghanistan. Hier war die UdSSR 1979 zur Unterstützung eines instabilen kommunistischen Regimes einmarschiert. Von den USA mit Waffen unterstützt und von Saudi-Arabien finanziert, organisierte in der Folge der pakistanische Geheimdienstapparat einen islamistischen Aufstand, dessen Niederschlagung Kosten verursachte, die nicht unerheblich zum Niedergang der Sowjetunion beitrugen und an dessen Ende islamistische Warlords Afghanistan unter sich aufteilten. Meist aber kam es nicht zu einer islamistischen Machtübernahme. Beschwichtigungspolitik der Herrschenden und Repression durch allgegenwärtige Geheimdienste erwiesen sich als erfolgreiche Medizin gegen eine potentielle islamistische Revolution.
Die wichtigste Ausnahme war Iran. Hier war der Schah seit den 50er Jahren gezielt gegen jede Form von Opposition oder auch nur unabhängiger politischer Betätigung vorgegangen. Eine politische Beteiligung der nicht zuletzt angesichts der Modernisierungspolitik des Schahs in den 70er Jahren recht breit gewordenen städtischen Mittelschichten war nicht erwünscht. Der Geldzufluss nach der Ölpreisexplosion hatte zudem hier nicht nur zu Wachstum, sondern auch zu Inflation und zusätzlichen sozialen Spannungen geführt. Während die Oberschicht und ein Teil der Mittelschichten vom neuen Reichtum profitierten, litten die städtischen Unterschichten unter den Preissteigerungen und traditionelle Händler unter der internationalen Konkurrenz. In dieser Situation konnten sich Teile des sehr gut organisierten schiitischen Klerus an die Spitze einer breiten revolutionären Bewegung gegen den für Korruption und Unterdrückung allein verantwortlich gemachten Schah stellen. Durch sukzessives Ausschalten anderer, kommunistischer wie linksislamistischer Kräfte gelang es dem charismatischen Ayatollah Khomeini ab 1979 in Iran ein islamistisches Regime zu etablieren. Dieses konnte sich genau auf die Schichten stützen, die unter den Veränderungen der 60er und vor allem 70er Jahre gelitten hatten und denen die kulturelle Verwestlichung der Jahrzehnte zuvor als Prozess der Entfremdung vom eigenen Erbe erschienen war.
In den meisten Ländern des Vorderen Orients waren aber nicht Revolutionen (auch nicht Militärputsche) das hervorstechendste Merkmal der politischen Geschichte der Zeit nach 1970, sondern eine erstaunliche politische Stabilität. Angesichts der ideologischen Delegitimierung vieler politischer Systeme der muslimischen Welt mag das erstaunen. Eben war bereits auf die Rolle allgegenwärtiger Geheimdienstapparate verwiesen worden. Wichtiger aber noch ist der fast alle Länder der Region prägende Klientelismus.16 Damit ist gemeint, dass es den Regierenden gelang, im Gegenzug für politische Loyalität soziale Wohltaten oder Privilegien unter allen potentiell für das Regime gefährlichen Gruppen der Gesellschaft zu verteilen. Dies können Lebensmittelsubventionen für die städtischen Unterschichten oder der Bau einer Schule in einem Dorf sein. Führende Militärs und Beamte erhalten nicht allein hohe Gehälter und eine weit über dem landesüblichen liegende Krankenversorgung. Sie erhalten darüber hinaus die Möglichkeit, unter Umgehung von Regelungen zollfrei Waren einzuführen, die Arbeitskraft von Rekruten für ihre privaten Zwecke auszunutzen usw. Traditionelle Führer wie Stammeschefs und Dorfoberhäupter spielen in solchen Netzwerken auf der regionalen und lokalen Ebene eine große Rolle. Ihre Macht vor Ort beruht nicht zuletzt auf ihren guten Beziehungen in die Hauptstadt, wo sie etwas für »ihre Leute« ausrichten können. Korruption ist in einem solchen Regime nicht die Ausnahme, sondern normal. Da sie aber formal illegal bleibt, sind alle, insbesondere die führenden Gruppen der Gesellschaft, potentiell durch das Regime erpressbar. Sie bleiben politisch loyal, nicht allein wegen der durch den Herrscher gewährten Vorteile, sondern auch aus Angst vor Strafverfolgung sowohl im Falle von Renitenz gegen das Regime wie im Falle seines Sturzes.
Ein zentraler Bestandteil des Klientelsystems vieler Staaten der Region sind Rentengelder, über die das Regime verfügt. Dies gilt vor allem für die bevölkerungsarmen Ölstaaten am Golf, in geringerem Maße aber auch für andere Staaten. Ein Rentierstaat ist ein Staat, der über Einnahmen (sog. Renten) verfügt, die nicht auf der wirtschaftlichen Tätigkeit seiner Einwohner beruhen. Dies sind vor allem Tantiemen aus der Ausbeutung von Bodenschätzen wie Öl. Daneben spielen Einnahmen aus Gastarbeiterüberweisungen und Benutzungsgebühren für Kanäle oder Militärbasen eine Rolle. Renten können aber auch Subventionszahlungen ausländischer Regierungen (Entwicklungs- und Militärhilfe) sein, die vor allem solche Staaten erhalten, deren Stabilität für den jeweiligen Geldgeber von Bedeutung ist. Ein Beispiel in dieser Hinsicht wären die amerikanischen Zahlungen an Ägypten, nachdem das Land im Jahr 1979 Frieden mit Israel geschlossen hatte. Der Herrscher eines Rentierstaates, dem in der Regel die Renten zunächst einmal zukommen, wird so in die Lage versetzt, in größerem Umfang Gelder an die Bevölkerung zu verteilen. In einem Rentiersystem finanziert der Staat zumindest in Teilen die Bürger und erwartet dafür im Gegenzug politisches Wohlverhalten. Das Gegenmodell ist der Produktionsstaat, in dem die Bürger über Steuern den Staat finanzieren und insofern im Prinzip Mitbestimmung verlangen können. Gleichviel, welche Rolle Renten für den Staatshaushalt eines Landes spielen: Überall gilt, dass ohne Nähe zur politischen Macht große wirtschaftliche Macht in vorderorientalischen Staaten und anderen Ländern der sog. Dritten Welt nicht denkbar ist, während in westlichen Industriestaaten in der Regel große wirtschaftliche Macht umgekehrt zu politischem Einfluss führt.
Die Regime der meisten Länder des Vorderen Orients waren so am Ende des 20. Jahrhunderts ausgesprochen stabil. Diese Stabilität der politischen Systeme wurde allerdings fast nirgends von wirtschaftlicher Entwicklung begleitet. Ausnahmen waren die bevölkerungsarmen Ölländer. Hier reichte die Höhe der Rentenzuflüsse aus, um eine von außen finanzierte Entwicklung voranzutreiben. Die zweite Ausnahme war die Türkei. Hier erwies sich seit den 80er Jahren das Rezept des IWF als erfolgreich, auf exportgetriebene Entwicklung zu setzen. Die Türkei profitierte dabei vom Massentourismus, von der Nähe des europäischen Marktes, ihrer vergleichsweise gut ausgebauten Infrastruktur und dem Ausbildungsstand der Bevölkerung. Ob das türkische Modell anderswo in der Region wiederholbar ist, bleibt offen. Hier war die sozioökonomische Konsequenz des im Verhältnis zur geringen Dynamik der Wirtschaft hohen Bevölkerungswachstums, einer Verstädterung ohne entsprechenden Ausbau der Infrastruktur sowie schlechter Bildungsmöglichkeiten und Korruption fast überall das Gleiche: Der Abstand zu den reichen Ländern der Welt konnte nicht verringert werden. Dabei wurden die fortdauernde Unterentwicklung genauso wie politische Krisen von weiten Teilen der Gesellschaft mehr mit der unterstellten Kontinuität imperialistischer Fremdbestimmung als mit den Strukturen der vorderorientalischen Staaten erklärt.
Auch wenn der politische Islam nur in den wenigsten Ländern zur Macht gekommen war, boten konservative islamische Wertvorstellungen den wichtigsten Halt in einer für die Menschen immer unübersichtlicheren Welt. Angesichts ökonomischer wie politischer Krisen verstärkte sich zudem wieder die Tendenz zum Zusammenschluss auf der Grundlage von religiöser oder ethnischer und tribaler Zugehörigkeit (zuweilen auch auf der Basis von Stammesverbänden). Die Lage nichtmuslimischer Minderheiten ist dadurch in vielen Ländern deutlich kritischer geworden. Das Gleiche gilt für die Verschärfung der Konfliktlagen zwischen Sunniten und Schiiten, für die auch das Ringen zwischen dem konservativ-sunnitischen Saudi-Arabien und dem schiitischen Iran um die regionale Vorherrschaft eine Rolle spielt.
Diese Entwicklungen erscheinen den Globalisierungsprozessen in anderen Teilen der Welt entgegengesetzt. Doch zum einen führt auch im Westen die Globalisierung in den letzten Jahren vielfach zu einer Rückbesinnung auf regionale und nationale Identitäten, die als Schutzwall gegen eine unkontrollierbare Globalisierung angesehen werden. Zum anderen macht die kulturelle Globalisierung auch vor der muslimischen Welt nicht halt. Noch in den 90er Jahren haben Islamisten im Regelfall westliche Konzepte wie Demokratie und Menschenrechte als unislamisch abgelehnt. Heute sehen viele – in der Literatur oft als Postislamisten bezeichnete – Gruppen ihr politisches Engagement parallel zu demjenigen christdemokratischer Parteien in Europa. Die neuen Medien, Satellitenkanäle und das Internet ermöglichen einen transnationalen Pluralismus der Meinungen, der in den autoritär regierten Ländern der Region zwischen 1950 und 1990 unvorstellbar war. Beides hat nicht wenig zu den Unruhen seit 2011 in der arabischen Welt beigetragen. Die ursprünglich weitverbreiteten Hoffnungen auf eine Demokratisierung des Vorderen Orients haben mittlerweile einer gewissen Ernüchterung Platz gemacht. Im Gefolge der Revolutionen kam es dort, wo die Bevölkerung ethnisch-religiös stark segmentiert war, zu blutigen Bürgerkriegen, teils zu völligem Staatszerfall (Syrien, Jemen, Libyen). Anderswo, insbesondere in Ägypten, hat die Revolution nur zu einem Austausch des Personals innerhalb traditioneller Elitenmilieus, insbesondere des Militärs, nicht aber zu einer strukturellen Veränderung geführt. Ob dies in Tunesien, Algerien und Sudan dauerhaft anders sein wird, ist im Moment noch offen. Die oben beschriebenen sozioökonomischen und kulturellen Strukturen lassen sich durch eine politische Revolution jedenfalls genauso wenig von einem Tag zum anderen verändern wie der Umstand, dass konservative Deutungen von Islam und die damit einhergehende religiöse Normierung des Alltagslebens und der Kultur in den letzten Jahren stark an Boden gewonnen haben.
Das lässt sich auch am Beispiel des sozioökonomisch modernsten Landes der Region illustrieren, der Türkei. In der Türkei war die Phase der modernisierenden Diktatur bereits nach dem Zweiten Weltkrieg zu Ende gegangen. An die Stelle der Einparteienherrschaft trat, wie wir sahen, hier ein pluralistisches System, das allerdings bis in das 21. Jahrhundert hinein unter militärischer Aufsicht stand. Jedoch war eine einheimische Unternehmerschicht entstanden, die vor allem mit den neoliberalen Reformen seit den 80er Jahren an Breite gewann und zunehmend auch das politische Geschehen im Lande bestimmte.17 Zu Beginn des 21. Jahrhunderts konnte diese Unternehmerschicht im Bündnis mit westlich orientierten Angehörigen der Bildungseliten die Macht des Militärs brechen. Die auch in der Türkei starken klientelistischen Netzwerkstrukturen der Gesellschaft führten jedoch dazu, dass in dem Moment, als das Militär als Schiedsrichter und entscheidender Machtfaktor wegfiel, das um den gegenwärtigen, postislamistischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan gruppierte stärkste Klientelnetzwerk versuchte, die politische und wirtschaftliche Macht im Land zu monopolisieren. Ob dies angesichts der vergleichsweise großen Stärke der Zivilgesellschaft und der Komplexität der politischen und wirtschaftlichen Strukturen des Landes auf Dauer gelingt, bleibt abzuwarten.
Die Darstellung war in den bisherigen Abschnitten fast ganz auf den Vorderen Orient beschränkt und hat andere Teile der muslimischen Welt, insbesondere in Zentral-, Süd und Südostasien allenfalls gestreift. Das entspricht einer nicht unproblematischen Tradition in der Islamwissenschaft, die als Fach immer eng mit dem arabisch- und persischsprachigen Raum verbunden war. Angesichts des Umstandes, dass die große Mehrheit der Muslime heute in Asien lebt und auch der subsaharische Islam immer wichtiger wird, ist das bedauerlich. In Hinblick auf die Religion allerdings ist angesichts des Einflusses der Golfstaaten und des Prestiges des Arabischen der Vordere Orient noch immer von deutlich überproportionaler Bedeutung. Außerdem haben sich viele der oben beschriebenen zentralen gesellschaftlichen Entwicklungen im muslimischen Asien in ganz ähnlicher Weise vollzogen. Wir können also bei der Betrachtung des asiatischen Raums diese zentralen Prozesse noch einmal systematisch in den Blick nehmen.
Imperiale Herrschaft im engeren Sinne hat vor der Kolonialzeit in Asien nur im zentralasiatischen und indischen Raum eine Rolle gespielt. Überall allerdings waren diese Imperien zum Zeitpunkt der Kolonisierung bereits zerfallen und hatten kleineren, regionalen Herrschaften Platz gemacht. Es war die Kolonialherrschaft, die die Grundlage für die heutigen Nationalstaaten gelegt hat. Indonesien und Malaysia sind als Nationen schlicht Fortsetzungen der niederländischen und britischen Kolonialstaaten und haben keine gemeinsame politische Tradition, die in die vorkoloniale Epoche zurückreicht. Wir haben es hier mit dem gleichen Phänomen zu tun, das wir bereits in der ostarabischen Welt beobachten konnten. Im Moment der Unabhängigkeit war eine auf das Territorium der Kolonie fixierte einheimische Elite herangewachsen, die kein Interesse daran hatte, die Kontrolle über das nunmehr unabhängige Territorium mit Personen von außerhalb zu teilen oder auf die Kontrolle über das gesamte ehedem koloniale Territorium zu verzichten.
In Zentralasien haben die Zaren zunächst eine indirekte Herrschaft über die zentralasiatischen Khanate ausgeübt. Es gab eine gemeinsame, allerdings wenig normierte türkische Schriftsprache; die Stadtbevölkerung sprach überall auch persisch. Es waren die Sowjets, die dann in den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts relativ willkürlich neue Verwaltungseinheiten schufen und für diese jeweils eine eigene Schriftsprache normierten. Diese Sowjetrepubliken waren es, die sich nach dem Zusammenbruch der UdSSR als unabhängige Nationen wiederfanden, die sich nun eine jeweils eigene, im Regelfall bis ins Mittelalter zurückreichende Geschichte erfanden.
In Indien war die Lage schwieriger. Bis ins 18. Jahrhundert hatten die Muslime dominiert und auch später herrschten vielerorts Muslime über eine nichtmuslimische Mehrheit. Diese politische Dominanz kam mit der Kolonialepoche an ihr Ende. Die Forderungen der indischen Nationalbewegung seit dem späten 19. Jahrhundert, ein autonomes, schließlich unabhängiges Indien aus der britischen Kronkolonie und den zahlreichen mit ihr verbundenen Fürstenstaaten zu schaffen, war für viele Muslime inakzeptabel. Sie hatten die politische Kontrolle verloren, waren weit weniger als die Hindus in moderne Sektoren von Wirtschaft und Verwaltung integriert und drohten als Minderheit in einem unabhängigen Indien in eine noch schwächere Position zu geraten. So entstand eine eigene muslimisch-indische Nationalbewegung, die die Muslime Indiens als eigene Nation begriff und für diese einen eigenen Staat forderte. Ein solcher entstand dann 1947 in den Gebieten mit muslimischer Mehrheit in Gestalt von Pakistan. Dabei stellte die Staatsgründerelite zunächst eher kulturelle als glaubensmäßige Zugehörigkeit zur islamischen Religion in den Mittelpunkt der nationalen Identität. Im Laufe der Zeit spielte die religiöse Praxis und Überzeugung dann eine immer größere Rolle. Diese dominiert heute in einer für individuelle Freiheitsrechte nicht unproblematischen Weise. Ähnliche Phänomene beobachten wir in Malaysia (und im Vorderen Orient in Israel oder der Türkei). In all diesen Ländern ist die Zugehörigkeit zur jeweils dominanten Religion konstitutiv für die Zugehörigkeit zur Nation: Die durch Religion (und Sprache) markierten Malaien sind in Malaysia das Staatsvolk und gegenüber chinesisch- und indischstämmigen Bürgern rechtlich privilegiert. Ein »wahrer« Türke ist Muslim, ein Armenier hat allenfalls die türkische Staatsbürgerschaft. Im Fall des von säkularen Zionisten gegründeten Israel ist dieses Phänomen noch deutlicher: Nur in einem sozialen, nicht religiösen Sinne jüdische Personen sind Staatsbürger mit allen Rechten. Auch wenn der politische Einfluss der Religion sowohl in Israel wie in der Türkei heute größer ist als 1950, erscheint die Macht konservativer Religion in beiden Fällen bei weitem nicht so dominant wie in Pakistan.
Neben der Religion war im pakistanischen Fall auch die Frage problematisch, welche Rolle den jeweils sehr unterschiedlichen Sprachgruppen innerhalb dieser Nation zukommen sollte. Die Diversität der Bevölkerung war in dieser Hinsicht sehr viel größer als andernorts, zudem gab es keine von vorneherein dominante Gruppe. Viele bengalische Muslime sahen ihre Interessen im pakistanischen Staat nicht ausreichend gewahrt, so dass es 1971 zu einem der wenigen Fälle kam, in dem postkoloniale Eliten einer Veränderung der in oder am Ende der Kolonialzeit gezogenen Grenzen zustimmen mussten. In einem blutigen Krieg machte sich Bangladesch von Pakistan unabhängig.
In den asiatischen muslimischen Ländern fanden, was die innere politische Ordnung und die dominanten sozialen Gruppen angeht, ähnliche Prozesse statt wie im Vorderen Orient. In der Kolonialzeit vor 1920 dominierten lokale Grundeigentümer und traditionelle Eliten, in Niederländisch-Indien (Indonesien) und in Zentralasien mehr oder weniger bedrängt von der Kolonialmacht oder Siedlern mit ihren Ansprüchen. An diese Phase schloss sich eine der revolutionären Umgestaltung der Gesellschaft an. Am radikalsten geschah dies im sowjetischen Zentralasien, das von 1920 bis 1991 beim Versuch des Aufbaus des Kommunismus alle Wechselfälle der Geschichte der UdSSR bis hin zu furchtbaren Gewalthandlungen und Hungersnöten miterlebte. Der Kommunismus verlor dann in der sogenannten Stagnationsepoche vor der Perestroika seine Glaubwürdigkeit ganz. Das hinderte die kommunistischen Parteichefs der zentralasiatischen Sowjetrepubliken nicht daran, als Präsidenten auf Lebenszeit die nunmehr unabhängigen Nationalstaaten mit genau den Mitteln zu regieren, die oben für vorderorientalische klientelistische, autoritäre Regime beschrieben wurden.
In Pakistan und Indonesien lag die Phase der revolutionären Umgestaltung später und ging auch keineswegs so weit wie in der UdSSR. Ähnlich wie in vielen Ländern der zeitgenössischen arabischen Welt regierten auch hier nach der Unabhängigkeit in den 50er und 60er Jahren linksnationalistische autokratische Reformer, deren Ideen und Maßnahmen mit denen Nassers in Ägypten zu vergleichen sind. Nach deren Scheitern finden wir hier genauso wie im Vorderen Orient oder Zentralasien klientelistische Regime, die nur in Pakistan zeitweilig islamistisch aufgeladen waren.
Malaysia und Indonesien haben seit den 1990er Jahren Anteil am Wirtschaftsaufschwung in Ostasien. Dabei gibt es durchaus Parallelen zur Entwicklung in der Türkei. Pakistan, Bangladesch und die meisten Länder in Zentralasien dagegen scheinen wirtschaftlich den Anschluss an die entwickelte Welt im Westen wie in Ostasien immer weiter zu verlieren.
In politischer Hinsicht scheinen sowohl offene Militärdiktatur wie islamistische Utopien in Süd- und Südostasien im Moment keine Konjunktur zu haben. Pluralistische Demokratie geht einher mit Klientelismus, und immer wieder kommt es zu Versuchen, die Macht der Opposition mit problematischen Methoden zu beschränken.
Die sozialwissenschaftliche Forschung hat in den letzten Jahrzehnten die Rolle der Religion im Kontext der Probleme von Unterentwicklung und Autoritarismus als eher gering oder inexistent veranschlagt.18 Diese Frage kann hier nicht weiter diskutiert werden. Dass zwischen den Gesellschaften der mehrheitlich von Muslimen bewohnten Länder der Welt in Hinblick auf politische Systeme und wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungsstand bei allen Unterschieden auch zahlreiche Gemeinsamkeiten bestehen, ist in diesem knappen Überblick hoffentlich deutlich geworden. Diese Gemeinsamkeiten erklären sich, selbst wenn man die Rolle der Religion nicht gänzlich in Abrede stellen will, nicht allein aus dieser, sondern insbesondere auch aus dem im Vergleich mit Europa oder Ostasien zu konstatierenden sozioökonomischen Entwicklungsrückstand und – in Hinblick auf politische Debatten und Haltungen – aus gemeinsamen (post)kolonialen Erfahrungen.