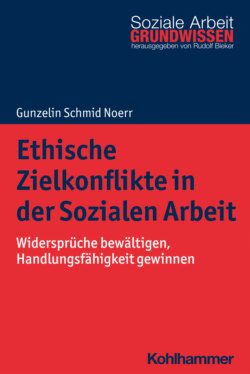Читать книгу Ethische Zielkonflikte in der Sozialen Arbeit - Gunzelin Schmid Noerr - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2.1 Deskriptiv-explanatorische, normative und kritische Ethik
ОглавлениеZunächst ist zu unterscheiden, ob von Wertbegriffen wie dem der Gerechtigkeit in einer erklärenden oder in einer bewertenden Perspektive die Rede ist. Diese Perspektiven gehören zwei Formen der Ethik an:
a. Die deskriptiv-explanatorische Ethik beschreibt und erklärt empirisch vorfindliche moralische Phänomene. In diesem Sinne verfahren beispielsweise soziologische oder psychologische Forschungen darüber, welche moralischen Werte und Normen in einer bestimmten Kultur oder in einem Milieu gelten, wie sie sich entwickeln und wie sie befolgt werden. Mit solchen Erklärungen sind an sich noch keine Bewertungen dieser Werte und Normen verbunden, also Stellungnahmen dazu, ob ein bestimmtes Verhalten, das für sich Gerechtigkeit in Anspruch nimmt, dies zu Recht oder zu Unrecht tut.
b. Aber man kann moralische Werte und Normen auch argumentativ stützen, unabhängig davon, ob sie faktisch eingehalten werden. In diesem Sinn verfährt die normative Ethik, die moralische Werte und Normen prüft, begründet und anwendet. Dies war und ist traditionell die Hauptaufgabe der philosophischen Ethik. Sie fragt dann zum Beispiel: Ist es in irgendeiner Weise gerecht, wenn das Einkommen eines hochgestellten Managers das Hundertfache einer seiner einfachen Mitarbeiterinnen beträgt?
c. Damit verbunden ist ein weiterer Aspekt der Kommunikation über Moral, die kritische Ethik. Sie fragt nach dem moralischen Wert der Moral selbst. So bemerkte beispielsweise der Philosoph Artur Schopenhauer (1788–1860) über das gängige moralische Gefühl:
»Mancher würde sich wundern, wenn er sähe, woraus sein Gewissen, das ihm ganz stattlich vorkommt, eigentlich zusammengesetzt ist: etwa aus ⅕ Menschenfurcht, ⅕ Deisidaimonie [Aberglauben], ⅕ Vorurteil, ⅕ Eitelkeit und ⅕ Gewohnheit, so dass er im Grunde nicht besser ist als jener Engländer, der geradezu sagte: ›I cannot afford to keep an conscience‹ (Ein Gewissen zu halten ist für mich zu kostspielig).« (Schopenhauer 1986 [1839], 723)
Schopenhauers »Engländer« kann sich angeblich aus finanziellen Gründen Moral nicht leisten, und damit ist er sehr zeitgemäß, insofern sich auch die Soziale Arbeit heute mit der »Ökonomisierung des Sozialen« (Wilken 2000) herumschlagen muss. Die Reflexion und Kritik des Moralischen war immer schon eine wesentliche Aufgabe der philosophischen Ethik. Mit den Worten Albert Schweitzers: »Die primäre Aufgabe der Ethik ist es, Unruhe zu wecken gegen die Gedankenlosigkeit, die sich als Sachlichkeit ausgibt.« Das darf freilich nicht als Absage an Fachlichkeit überhaupt missverstanden werden. Die kritische Ethik trägt auch zur Selbstklärung der Sozialen Arbeit bei. So schlägt Hans Thiersch vor,
»spezifische pädagogische Stile […] jeweils auf die in ihnen liegenden Chancen des sublimen Machtgewinns hin zu analysieren. Es gibt eine Nötigung, die schon im Zeitarrangement liegt oder in der Kunst eines bedrängenden, gleichsam inquisitorischen Fragens, es gibt auch einen Überfall mit Sachklarheit […], es gibt vor allem aber auch einen professionell gleichsam gesättigten, erfahrungsstabilisierten und geradezu detektivischen, kriminalistischen Spürsinn im Überraschen, Stellen, Ertappen und Festnageln.« (Thiersch 1995, 90)
Die eigenen Werthaltungen zu verabsolutieren und damit die Klientinnen auf eine subtile und kaum bewusste Weise zu entmündigen, ist eine Gefahr des professionellen Handelns. Darauf aufmerksam zu machen, wäre also ein Stück kritische Ethik der Sozialen Arbeit.
Das folgende Schema soll die bislang unterschiedenen Formen der ethischen Kommunikation über Moral zusammenfassend veranschaulichen ( Abb. 1).
Abb. 1: Formen des Sprechens über Moral