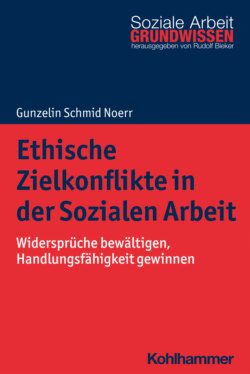Читать книгу Ethische Zielkonflikte in der Sozialen Arbeit - Gunzelin Schmid Noerr - Страница 31
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.3.2 Ziele
ОглавлениеDas Ziel des fachlichen Handelns ist vor allem dann auf seine ethische Legitimität hin zu befragen, wenn es mit alternativen berechtigten Zielvorstellungen kollidiert. Der Hierarchie von Nicht-Schaden und Nutzen liegt das allgemeinere Prinzip zugrunde, dass das Dringliche Vorrang vor dem weniger Dringlichen hat. Diese beiden Prinzipien sind hinsichtlich ihrer praktischen Anwendung weiter zu differenzieren. Was genau soll durch eine schadensmindernde Maßnahme vermieden oder gelindert werden, was durch eine Hilfemaßnahme gefördert werden? Zur Beantwortung können wir auf das sozialpsychologische Konzept der Bedürfnisse von Abraham Maslow (2014 [1954], 1971) zurückgreifen (die griffige Darstellung der »Bedürfnispyramide« kam allerdings erst bei der Rezeption der Theorie durch andere auf). Hier geht es um die anthropologische Struktur menschlicher Bedürfnisse, deren Nichterfüllung die Verletzbarkeit des menschlichen Lebens darstellen und zu deren Schutz moralische Werte und Normen dienen. Sie sind (im folgenden Schema von unten nach oben) nach Dringlichkeit ihrer Berücksichtigung gestaffelt ( Abb. 2).
Abb. 2: Bedürfnispyramide nach Maslow (die in Klammern aufgeführten, konkretisierenden Bezeichnungen sind beispielhaft, nicht als vollständig zu verstehen)
Ursprünglich hatte Maslow ein einfacheres Modell von nur fünf Bedürfnisklassen entworfen, erweiterte es dann aber durch die Einfügung geistiger Bedürfnisse. Er klassifizierte die vier basalen Bedürfnisklassen als »Mangelbedürfnisse«, die ursprünglich fünfte, nämlich Selbstverwirklichung, als »Wachstumsbedürfnisse«. Das Konzept ist in der Psychologie vielfach rezipiert und diskutiert worden. Um mögliche Missverständnisse zu vermeiden, sollten die folgenden Merkmale des Konzepts festgehalten werden:
• Die Abgrenzung zwischen den Bedürfnistypen ist nicht strikt, vielmehr gibt es vielfache Übergänge und Vermischungen.
• Die basalen Mangelbedürfnisse motivieren, nach dem Modell der Homöostase, nur dann zum Handeln, wenn sie nicht erfüllt sind.
• Dagegen haben die ›höheren‹ Wachstumsbedürfnisse, insbesondere das der Selbstverwirklichung, keinen Ruhepunkt, vielmehr generiert gerade ihre Erfüllung die Motivation, weiterzugehen.
• Dass die Befriedigung der jeweils ›unteren‹ Bedürfnisse die Voraussetzung für die ›oberen‹ Bedürfnisse ist, gilt nach ›oben‹ zu immer weniger.
• Die von ›unten‹ nach ›oben‹ gestaffelte Dringlichkeit der Bedürfnisse gilt nicht notwendig in jedem Hier und Jetzt, sondern auf Dauer und im Allgemeinen.
• Die gestaffelte Dringlichkeit hängt auch von der jeweiligen Persönlichkeitsstruktur, der Kultur, dem Milieu und der konkreten Situation ab.
• Trotz der zunehmenden Unterscheidung von Bedürfnistypen zeigen sich in der Anwendung auf unterschiedliche Gruppen von Betroffenen (wie psychisch oder körperlich Behinderte, Kinder, Jugendliche, Migranten und Migrantinnen usw.) große qualitative Unterschiede, die in der interaktiven Praxis zu berücksichtigen sind.
Nun steht hier nicht der empirische Status der Maslow’schen Annahmen zur Diskussion, also etwa Fragen, welche Bedürfnisse unter welchen Bedingungen zu welchem Verhalten motivieren. Vielmehr geht es darum, welche Befriedigungsmöglichkeiten von Bedürfnissen Anderer von uns nach ethischen Kriterien vorrangig zu berücksichtigen oder zu fördern sind. Damit gehen wir über die psychologische Ebene der Beschreibung und Erklärung hinaus und bringen die Gesichtspunkte der Rechtfertigung der Bedürfnisbefriedigung ins Spiel. Der Mensch hängt ja nicht gleichsam als eine Marionette an Fäden, die von den natürlichen Bedürfnissen bewegt werden, vielmehr kann er auch – jedenfalls zu einem gewissen Grad – auswählen, welche Bedürfnisse er auf welche Weise befriedigt und welche nicht. Nicht alle Bedürfnisse, und seien sie anthropologisch und psychologisch noch so grundlegend, stellen professionsethisch gerechtfertigte Werte und damit Handlungsziele dar. Dennoch kann als allgemeine Richtlinie formuliert werden, dass der jeweils dringlichere Wert – dieser resultiert zumeist aus einem »Mangelbedürfnis« – einem ranghöheren Wert – der entspricht den »Wachstumsbedürfnissen« – vorzuziehen ist. Dabei ist es, ethisch gesehen, ein entscheidender Unterschied, ob wir selbst unsere elementaren physio-psycho-sozialen Bedürfnisse zugunsten unserer Selbstverwirklichung einschränken oder ob wir das Anderen zumuten.
Ein Beispiel für den Vorrang der jeweils unteren gegenüber den jeweils höheren Bedürfnissen ist der im ersten Kapitel aufgeführte Fall des »Schüttelbabys«. Das staatliche »Wächteramt« gegenüber den Eltern dient hier der Sicherung der grundlegenden Bedürfnisse des hilflosen, zu seinem Überleben auf Hilfe angewiesenen Kindes, wobei die Selbstverwirklichungsbedürfnisse der Eltern, die auch in ihrem Recht auf Erziehung abgesichert sind, gegebenenfalls zurückstehen müssen. Ein anderes Beispiel ist das Spannungsverhältnis zwischen Autonomie und Fürsorge. Menschen, die ihre Autonomie noch nicht oder nicht mehr im vollen Umfang wahrnehmen können wie zum Beispiel Kinder, psychisch oder geistig Behinderte, Kranke, Demente müssen kompensatorisch versorgt werden. Wenn dabei die physische und materielle Versorgung gesichert werden muss, müssen demgegenüber unter Umständen selbstbestimmte Individualbedürfnisse zurückstehen.