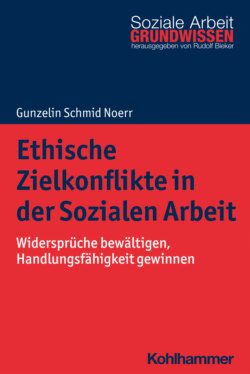Читать книгу Ethische Zielkonflikte in der Sozialen Arbeit - Gunzelin Schmid Noerr - Страница 28
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2.3 Strebensethik und Sollensethik
ОглавлениеDie Ethik hat es mit der Reflexion von Werten und Normen des gelingenden Lebens und guten Zusammenlebens zu tun. Eine letzte hier zu erklärende Unterscheidung der Ethik geht von dieser Zweiheit von Werten und Normen aus. Die Zweiheit von Werten und Normen verweist darauf, dass es in der Ethik auf eine zweifache Weise um das ›Gute‹ geht: einerseits im Sinn des Wertes einer Einstellung, Handlung oder Struktur und was deshalb von Einzelnen oder Gemeinschaften anzustreben ist (»Strebensethik«), andererseits im Sinn dessen, was Andere von den Einzelnen oder auch der Gemeinschaft zu Recht erwarten können (»Sollensethik«).
a. Strebensethik (Selbstethik, Güterethik, Wertethik, Tugendethik)
Diese historisch älteste Form der Ethik (begründet im antiken Griechenland) hat viele moderne Fortsetzungen gefunden. So ist es auch ein zentraler Aufgabenbereich der Sozialen Arbeit, den Klienten zu einem besser gelingenden Alltag zu verhelfen. Das beinhaltet eine Förderung ihrer Selbstregulation in den jeweils betroffenen Lebensverhältnissen. Zu verbessern sind beispielsweise der Umgang mit Beeinträchtigungen wie Krankheit oder Behinderung, die Gestaltung sozialer Kontakte, die Möglichkeiten der Selbstversorgung, der Freizeit oder der Arbeit. Die ethische Methode beschränkt sich hier, auf der Basis von Selbstevaluation, im Wesentlichen auf Ratschläge und Empfehlungen der Verwirklichung eines reflektierten, klugen Eigeninteresses.
b. Sollensethik (Pflichtethik)
Diese Form der Ethik enthält Weisungen, die nicht abhängig von den Dispositionen und Vorlieben der Betroffenen sind, sondern unbedingt gelten. Sie betreffen das, was alle unter gleichen Bedingungen anderen Menschen schulden. »Gleiche Bedingungen« heißt zum Beispiel, dass wir Fernstehenden nicht immer dasselbe schulden wie Nahestehenden. Es gibt positive Pflichten (was man tun soll) und negative Pflichten (was man nicht tun darf), wobei die negativen vor den positiven Vorrang haben. In der Geschichte der Ethik war es vor allem Immanuel Kant, der darauf bestand, dass das moralische Sollen unabhängig davon zu gelten hat, ob dadurch das Glück des Handelnden vermehrt wird oder nicht. Der wichtigste Gesichtspunkt der Sollensethik ist nach Kant der der Verallgemeinerbarkeit einer moralischen Norm, d. h. ihre Unparteilichkeit. In der sozialarbeiterischen Professionsethik bezieht sich die Frage nach dem Sollen nicht nur auf die Verpflichtungen der einzelnen Fachkräfte, sondern auch anderer Beteiligter. Die Sollensethik wird vor allem als Verantwortungsethik formuliert.
Die genannten Unterscheidungen gelten nicht absolut, vielmehr gibt es vielfach wechselseitige Bedingtheiten, Überschneidungen und Übergänge. Dennoch trägt die begriffliche Unterscheidung in der Anwendung auf konkrete Fälle zur Klarheit bei. In diesem Sinn ergeben sich durch die Kombination der unterschiedlichen Perspektiven vier Problembereiche ( Tab. 1).
Tab. 1: Zuordnung der Strebens- und Sollensethik zur Individual- und Sozialethik
StrebensethikSollensethik