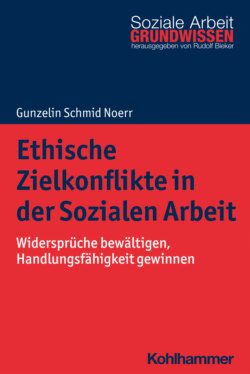Читать книгу Ethische Zielkonflikte in der Sozialen Arbeit - Gunzelin Schmid Noerr - Страница 29
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.3 Grundlagen der ethischen Entscheidungsfindung
ОглавлениеBei Entscheidungen im fachlichen Handeln gibt es, innerhalb gesetzlicher und institutioneller Vorgaben, Ermessensspielräume. Diese kommen dadurch zustande, dass die Subsumtion von konkreten Personen und Vorkommnissen unter allgemeine Handlungsregeln immer mit der Reduktion ihrer Komplexität verbunden sind. Die Betroffenen sind gleichsam von einem Bedeutungsüberschuss umgeben. Angesichts dessen entscheiden die Fachkräfte in der Praxis oft, und besonders unter Zeitdruck, ›aus dem Bauch heraus‹, geleitet von Erfahrungen und Gewohnheiten, die sich in der Praxis eingespielt und mehr oder weniger bewährt haben. Ein solches Verfahren genügt aber nicht unbedingt den ethischen Ansprüchen der Profession, nach denen stattdessen ein prinzipiengeleitetes, begründetes und verantwortbares Handeln gefordert ist.
Selbst wenn den Fachkräften die im vorigen Abschnitt angeführten Prinzipien bewusst sind, so ist damit noch nicht klar, in welchem Verhältnis diese zueinanderstehen. Zwar werden die Prinzipien als derart grundlegend angesehen, dass sie, wenn sie denn auf einen bestimmten Fall anwendbar sind, allgemeine Geltung beanspruchen. Was aber, wenn zwischen ihnen alternativ zu entscheiden ist, wenn also zum Beispiel mit einer geplanten Maßnahme der Verselbständigung eines betreut wohnenden, früher straffällig gewordenen Jugendlichen ein hohes Risiko für ihn verbunden ist, wieder in die Delinquenz abzurutschen, wenn demnach zwischen Nutzen und Schaden in einem etwa gleich hohen Maß zu wählen ist?
Die beiden ethischen Prinzipien, anderen zu nützen und ihnen nicht zu schaden, sind, Schopenhauer zufolge, im Wesentlichen allen bekannten ethischen Systemen gemeinsam, ja fassen in einfachster Form das Moralische überhaupt mit der Aufforderung zusammen: »Verletze niemanden, vielmehr hilf allen, soviel du kannst« (Schopenhauer 1986 [1841], 663). Diese Formulierung hat einen negativen und einen positiven Teil, und es ist kein Zufall, dass der negative zuerst genannt wird. Denn das Verbot, anderen zu schaden, gilt in der Tradition der Ethik allgemein als das gewichtigere gegenüber dem Gebot, anderen nach Möglichkeit zu helfen. Dieses Verbot – man könnte es auch als Gebot der Schadensminimierung formulieren – ist der Kern der traditionell sogenannten »Rechtsmoral«, die diejenigen Mindestanforderungen enthält, die wir anderen Menschen unbedingt schulden. Dagegen ist das Hilfegebot der Kern der sogenannten »Tugendmoral«, die moralisch wertvolle, aber nicht unbedingt einzufordernde Leistungen darstellt. Warum das Schadensverbot im Zweifelsfall Vorrang vor dem Nutzengebot hat, liegt an den jeweils zugrundeliegenden Werten. Der durch das Schadensverbot zugrundeliegende Wert ist der eines bestehenden Daseinsrechts, während der dem Nutzengebot zugrundeliegende Wert der eines berechtigten und zuträglichen Wohlseins des Anderen ist. Das Recht auf Dasein ist aber die Voraussetzung für ein mögliches Recht auf Wohlsein, nicht umgekehrt. Deshalb ist es elementarer, also vorzugsweise schützenswert.
Wenn in diesem Zusammenhang von »Recht« die Rede ist, dann ist das »moralische Recht«, das moralisch Rechtmäßige oder Richtige gemeint, nicht das von staatlichen Organen gesetzte, »positive« Recht. Letzteres hat für die heutige Sozialen Arbeit bekanntlich eine grundlegende, rahmengebende Funktion. Das Bürgerliche Gesetzbuch und das Sozialgesetzbuch enthalten entscheidende Rechtsvorschriften, die in der Praxis anzuwenden sind. Das macht den Umgang mit Widersprüchen zwischen moralischem und positivem Recht sehr schwierig. Das moralische gegen das positive Recht durchzusetzen ist nur unter extremen Bedingungen des Machtmissbrauchs oder gar einer diktatorischen Herrschaft ethisch legitim. Dennoch kann der Widerspruch auch im Rechtsstaat virulent werden.
Dazu ein Beispiel aus den Interviews. Die Sozialpädagogin Corinna Weißgerber leitet in einem Kinder- und Jugendheim eine sogenannte Diagnosegruppe. Dort sind Kinder aus Familien mit schwerwiegenden Problemen vorübergehend, normalerweise nicht mehr als ein halbes Jahr, untergebracht, damit über ihre Rückkehr in die Familie oder über einen anderen Verbleib entschieden werden kann. Der sechsjährige Martin ist wegen der Schwierigkeiten seines Falles schon seit fast drei Jahren in der Gruppe. Er kam dorthin mit schwersten Entwicklungsverzögerungen. Möglicherweise hat er von den Eltern oder einem Elternteil über lange Zeit hinweg und immer noch starke Beruhigungsmittel bekommen. Diesbezüglich beschuldigen die Eltern sich gegenseitig und zugleich sind sie in eine Scheidung verwickelt. Für den Medikamentenmissbrauch gibt es Indizien, aber beweisen ließ sich bislang nichts. Corinna Weißgerber:
»Je nachdem, wie man die Situation sieht, ist da nicht nur eine Zwickmühle. […] Letzten Endes spielen wir ja hier fast schon mit den Eltern auf dem Kopf des Kindes. Das moralische Problem liegt hier eigentlich nicht darin, dass man irgendwelche Entscheidungen treffen müsste, die für den einen oder anderen negativ wären oder die man lange abwägen müsste und mit denen man hinterher vielleicht doch nicht zufrieden wäre. Mein Problem liegt mehr darin, hier eigentlich gar keine Entscheidungsgewalt zu haben. So gerne ich einfach sagen würde: ›Komm, pack den Jungen in ’ne nette Pflegefamilie und lass ihn noch ’ne Therapie dabei machen‹ – ich kann nicht, ich darf nicht. Nur weil keiner keinem irgendwas nachweisen kann, steckt der Junge bei uns in der Gruppe […]. Er darf zur Mutter, dann wieder nicht, dann alleine zum Vater, dann nur Besuch in der Gruppe, dann eine Stunde draußen alleine mit dem Jungen, dann doch ein Wochenende, dann stellt sich hier wieder irgendeine Gefährdung raus, dann darf wieder keiner kommen, dann streiten sich die beiden wieder vor Gericht, dann – es nimmt einfach kein Ende. Und es ist nicht gut so, wie es läuft. Es macht keinen Sinn. Es macht das Kind mürbe und kaputt […]. Mein Gewissen wird also eingebunden in das Regel- und Gesetzeswerk unseres Heimes und des Jugendamtes und des gesamten Rechtsapparates. Und ich frage mich immer wieder […], ob ich das verantworten kann.«
Die sozialarbeiterische Fachkraft kann die rechtlichen Regeln der Unterbringung eines in seinem Wohl gefährdeten Kindes weder ändern noch umgehen, sondern allenfalls auf eine hinreichend gute und rasche Anwendung des Rechts hinwirken, was sich unter widrigen Bedingungen als höchst schwierig erweisen kann. Zurecht prangert Corinna Weißgerber in diesem Fall eine erneute Gefährdung des Kindeswohls allein aufgrund der langwierigen Prozedur von Anamnese und Diagnose an. Zweifelhaft erscheint, ob Heim, Jugendamt und Familiengericht dieses Problem genügend im Blick haben. Allerdings ist die rechtliche Anforderung für den ursächlichen Nachweis der Kindeswohlgefährdung und den auch prognostisch relevanten Sachverhalt sehr hoch, ist doch »ein Eingriff in das Elternrecht nur im Falle einer nachhaltigen, mit ziemlich sicherer Sicherheit voraussehbaren Kindeswohlgefährdung zulässig« (Heilmann 2020, 231).
Das positive Recht ist ein dem Anspruch nach widerspruchsfreies System, auch wenn sich die Wirklichkeit oft genug in dieses System nicht zweifelsfrei einordnen lässt. Demgegenüber sind moralische Normen und Werte in ihrer Anwendung sehr viel weniger eindeutig und systematisch. Auch spielt die Eigenverantwortung des handelnden Subjekts eine viel stärkere Rolle als beim positiven Recht. Den ethischen Ansprüchen nach muss es sich
1. der eigenen Motive,
2. der Ziele,
3. der dafür erforderlichen Mittel und
4. der Folgen des Handelns bewusst sein.
Und es hat diese, den jeweiligen Umständen entsprechend, eigenverantwortlich umzusetzen.