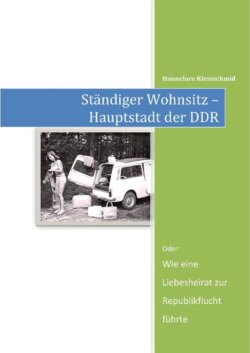Читать книгу Ständiger Wohnsitz: Hauptstadt der DDR - Hannelore Kleinschmid - Страница 11
10. Ein Österreicher
ОглавлениеZur Silberhochzeit wie auch bei anderen passenden Gelegenheiten wird Hanne vielleicht einmal erzählen, sie habe während ihres Studiums an der Ostberliner Humboldt-Universität nach einem westlichen Ausländer Ausschau gehalten, um mit seiner Hilfe über die Mauer zu überwinden. Am liebsten sei ihr, so habe sie damals entschieden, ein deutschsprachiger Ausländer, denn da bekäme sie keine Probleme mit der Verständigung. Würde sie dann laut lachen, wüssten die Gesprächspartner nicht so genau, ob etwas Wahres an der Geschichte ist. Ein Mann namens Harald lebte seit 1957 als Österreicher in der DDR, war also westlicher Ausländer mit deutscher Muttersprache.
Als er in ihr Leben trat, bemerkte sie es zunächst kaum.
Im dritten Semester tauchten die Theaterwissenschaftler auf, die das erste Studienjahr im Praktikum an den verschiedenen Bühnen der Republik verbracht hatten. Im Dramaturgieseminar berichtete ein Kommilitone von Aufführungen, die er in Westberlin gesehen hatte. Er tat das mit österreichischem Akzent. Sie konnte nicht beurteilen, ob er angeben wollte mit seinen Erlebnissen, von denen alle anderen durch die Mauer abgeschnitten waren. Es interessierte sie auch nicht sonderlich.
Auffällig an ihm war der weißrote Westwagen, mit dem er zum Institut fuhr. Jedenfalls gelegentlich. Angezogen war er weniger auffällig: Stoffhosen, Stoffmantel und manchmal eine Art Jägerhut auf den dunklen Haaren. Augenscheinlich hatte ihm im Gegensatz zu Hanne niemand austreiben können, über den großen Onkel zu gehen.
Nach und nach erfuhr sie etwas über seinen familiären Hintergrund. Wie gerät ein junger Österreicher in die DDR?
Wieso lebt er mit seiner Mutter in Ostberlin?
Sein Stiefvater war der verstorbene Schriftsteller Arnolt Bronnen gewesen. Da im Studium der deutsche Expressionismus behandelt wurde, war auch von Bronnen die Rede, der sich als Dramatiker vor allem mit dem „Vatermord“ einen Namen gemacht hatte. Den Spruch: „Der Becher geht so lange zum Bronnen, bis er Brecht“ würde Hanne in Zukunft noch oft von Harald hören. Immer dann nämlich, wenn er Fragen nach seinem Weg in die DDR beantwortete.
Während Johannes R. Becher Kulturminister unter Ulbricht war und Bertolt Brecht das Theater am Schiffbauerdamm leitete, das als Brecht-Theater weltberühmt wurde, verlor Bronnen in Wien seinen Broterwerb, weil dort das Theater „Die Scala“ geschlossen wurde, bei dem er als Chefdramaturg tätig gewesen war. Die „Scala“ galt als kommunistisch beeinflusst und den Sowjets nahe stehend, die das Land verließen, als der österreichische Staatsvertrag in Kraft trat. Bis dahin war Österreich wie Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg besetzt gewesen, wurde jedoch 1956 in die Neutralität entlassen. Damals herrschte Kalter Krieg zwischen Ost und West.
Bronnen, der in seinem Leben schon viele politische Wendungen vollzogen hatte – vom Nazi bis zum Kommunisten –, suchte und fand in der DDR einen neuen Arbeitsplatz als Theaterkritiker für die „Berliner Zeitung“. Der SED-Staat, der damals in der westlichen Welt als sowjetisch besetzte Zone diplomatisch nicht anerkannt wurde, suchte seine internationale Aufwertung auch dadurch, dass er sich mit namhaften Persönlichkeiten schmückte. So erhielt Bronnen nach kurzer Zeit mit seiner jungen Frau ein Haus in einer für sozialistische Intellektuelle und Künstler in den 50er Jahren errichteten Einfamilienhaus-Siedlung in Berlin-Niederschönhausen. Er verlor zwar sehr schnell die Weggefährten aus expressionistischer Zeit – Becher und Brecht starben kurz nach seiner Übersiedlung -, doch er bemühte sich, Fuß zu fassen, und war zu Zugeständnissen an den SED-Staat bereit. In diesem Sinne schrieb er die Reportage „Deutschland – kein Wintermärchen“. Einige seiner Bücher wurden in der DDR gedruckt, sein Roman „Aisopos“ verkaufte sich als sozialistischer Bestseller, bei dem der ständige Papiermangel Auflage und Angebot bestimmte. Jedoch wurde keines von Bronnens Theaterstücken aufgeführt. Die fehlende Akzeptanz brach ihm schließlich das Herz. So jedenfalls sah es seine Witwe, die Ende 1959 als Österreicherin mit ihren beiden Söhnen in Ostberlin plötzlich vor dem existenziellen Nichts stand.
Der DDR-Ministerrat reagierte auf ihre schriftliche Bitte und gewährte ihr eine Ehrenpension. Mit 600 DDR-Mark und sporadischen West-Tantiemen des verstorbenen Schriftstellers zauberte sie sich durchs Leben, solange die DDR währte.
Bronnens Stiefsohn Harald zog nach einigen Besuchen in Ostberlin den dortigen Sozialismus einem katholischen Internat im noch immer kaisertreuen Bad Ischl vor und begann sein Leben in dem fremden Land mit dem Besuch der 10. Klasse der Erweiterten Oberschule „Friedrich List“. Harald maturierte nicht in Österreich, sondern machte Abitur in der DDR. Aber zu jenem Zeitpunkt lag Arnolt Bronnen schon wie Becher und Brecht auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof, der mittlerweile zu den Berliner Sehenswürdigkeiten zählt, weil so viele prominente Persönlichkeiten dort beerdigt worden sind.
Wie viele seines Alters wusste Harald nicht so recht, was er nach dem Abitur anfangen sollte. Er schwankte zwischen einem Mathematik- und einem Germanistik-Studium. Mit seinem Schulfreund Jürgen gestaltete er, weil es den beiden Spaß machte, Sketche aus der satirischen DDR-Zeitschrift „Eulenspiegel“. Sie ernteten bei ihren Auftritten viel Beifall und landeten schließlich sogar mit Erfolg in der Talente-Show des DDR-Fernsehens „Herzklopfen kostenlos“, die Entertainer Heinz Quermann moderierte. Das Liebäugeln mit dem öffentlichen Auftritt erleichterte Harald die Entscheidung für Theaterwissenschaften. Als Nebenfach wählte er Anglistik, da Mutter und Sohn das als gute Grundlage für eine gewisse Weltläufigkeit ansahen. Seine Zukunft würde vermutlich nicht in der engen DDR liegen. Meinten sie.
Auch bei dem jungen Österreicher musste für den gewünschten Studienplatz von oben nachgeholfen werden. Im Laufe der Jahre wurde es im realen Sozialismus immer wichtiger, jemanden mit Einfluss zu kennen, der „Beziehungen“ spielen lassen konnte. Der Stellvertretende Kulturminister der DDR, Alexander Abusch, war es in diesem Fall, der sich, wohl auch aus schlechtem Gewissen Bronnen gegenüber, der Bitte der Witwe nicht verschloss und einen Studienplatz am Institut für Theaterwissenschaften der Humboldt-Universität besorgte.
Der junge Mann aus Österreich pendelte zwischen zwei Welten, die durch den Eisernen Vorhang voneinander getrennt waren. Er fuhr zwischen Ost- und Westberlin hin und her. Auch sein Heimatland besuchte er regelmäßig mehrmals im Jahr. Im Sommer 1961 weilte er zwischen Abitur und Immatrikulation an der Donau. Von dort aus erschien der Mauerbau ein unglaubliches und gefährliches Unterfangen, das sofort die Frage aufwarf, wie Österreicher mit ständigem Wohnsitz in Ostberlin fortan leben würden. Durften sie weiterhin nach Westberlin fahren, oder wurde auch für sie der antifaschistische Schutzwall unüberwindlich?
Harald erlebte, wie seine Mutter diese existenzielle Frage im Café und an der Bar, die ihrer besten Freundin gehörten, mit vielen guten Freunden erörterte. Zu ihm sagte sie schließlich: „Du musst dein Studium an der Humboldt-Universität beginnen und dich immatrikulieren lassen. Anderswo zu leben haben wir nicht das Geld. Also, weißt du, es ist am besten, du fährst mal dorthin und erkundest die Lage. Falls du nach Westberlin gelangst, kannst du mich ja von dort aus anrufen oder ein Telegramm schicken.“
Dann sagte sie noch: „Gute Reise.“
Er wusste nur, dass er ein Leben lang nicht vergessen würde, wie sie einen Achtzehnjährigen vorschickte ins Ungewisse.