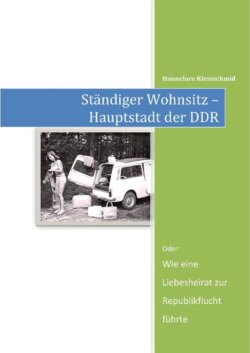Читать книгу Ständiger Wohnsitz: Hauptstadt der DDR - Hannelore Kleinschmid - Страница 3
2. Einen Wunsch hat jeder frei
ОглавлениеAm nächsten Morgen stand ein feierlicher Akt bevor: die sozialistische Immatrikulation.
Hanne war sicher, dass sie die ganze Nacht kein Auge zugetan, sondern auf die Geräusche im Zimmer geachtet hatte, als würde sie von einem Wach- und Abhördienst bezahlt. Unheimlich laut knallten die Türen im ganzen Haus. Geheimnisse unter den Studenten gab es nicht, ging man von der Hellhörigkeit des Gebäudes aus. Noch bevor die vier Zimmergenossinnen richtig aufwachten, machte sich die Neue davon. Da es ihr zu kompliziert erschien, in der Mensa des Studentenheimes Frühstück aufzutreiben, trank sie aus dem Wasserhahn im Duschraum und aß auf dem Weg zum S-Bahnhof die letzte von der Mutter mit viel Liebe und noch mehr Leberwurst zurecht gemachte Schnitte. Als Provinzlerin wusste sie nicht, wie lange sie bis in die Humboldt-Universität unterwegs sein würde. Der Gedanke quälte sie, an diesem Tag unpünktlich zu sein oder sich womöglich gar nicht hinzufinden. Aber der Mensch wächst ja bekanntlich mit seinen Aufgaben, und so nahm sie die Hürden der Großstadt und durchschritt nach gut einer Stunde, also viel zu zeitig, das Foyer der Uni. Für einen kurzen Augenblick war das ein erhebendes Gefühl. Sie drang ein in die Hallen, die der echten Wissenschaft geweiht waren. Allerdings bestimmten die Blauhemden der Freien Deutschen Jugend das Farbbild im größten Raum des Gebäudes und wiesen darauf hin, dass es nicht allein um Wissenschaft gehen würde. Der Sozialismus spielte immer mit. Übrigens trug auch Hanne brav ihr Blauhemd und beobachtete interessiert, wie andere aus Taschen die blauen Blusen hervorkramten und lediglich für die sozialistische Zeremonie überzogen, um sie alsbald wieder in die Tiefen der Behältnisse zu stopfen und sich ganz zivil zu bewegen. Wieder kam sich das Mädchen aus der kleinen Stadt trottelig vor, weil es den Rest des Tages FDJ-Zugehörigkeit demonstrieren musste, denn unter dem blauen Hemd trug es nur den Büstenhalter. Man lernt aus der Betrachtung der Mitmenschen.
Um einen Studienplatz zu bekommen, reichten gute Leistungen in der Schule nicht aus. Gesellschaftliche Aktivitäten hieß das Zauberwort. Dabei handelte es sich um Aufgaben, die man ehrenamtlich übernahm, allerdings nicht unbedingt aus Leidenschaft, sondern um eben diese gesellschaftliche Aktivitäten nach- und vorweisen zu können. Eine sozialistische Persönlichkeit entwickelte sich am sichtbarsten als Funktionär in einer Massenorganisation. Das Amt des Kassierers bei der Deutsch-Sowjetischen Freundschaftsgesellschaft war besonders begehrt, weil jeder wusste, dass es kaum Mühe machte, von Mitschülern oder Kollegen monatlich zehn Pfennige Beitrag einzusammeln. Darüber hinaus wurden kaum Aktivitäten bei der DSF augenscheinlich.
Hanne war ein Junger Pionier gewesen. Fast alle ABC-Schützen gingen zu den Pionieren. Ein sechsjähriges Kind will so sein wie die anderen. Die meisten Eltern kamen aus der Hitlerzeit und überlegten zweimal, ob sie Nein sagten zur kommunistischen Kinderorganisation und womöglich Unbilden auf sich nahmen.
Mit zehn Jahren wurden die Jungpioniere in einer Feierstunden zu Thälmann-Pionieren erklärt, benannt nach dem Kommunisten, Ernst Thälmann, der im faschistischen Zuchthaus umgekommen war.
In der 8. Klasse wurden sie allesamt wiederum pauschal mit einer Zeremonie in die Freie Deutsche Jugend, die sozialistische Jugendorganisation FDJ, übernommen.
Schon beim Nachwuchs wurde das Ja als selbstverständlich vorausgesetzt. So wurde das Nein zum mutigen Schritt des Einzelnen, man sagte es stets allein und im Bewusstsein möglicher Schwierigkeiten. Dieses Nein musste man persönlich erklären und war dabei immer dem Verdacht ausgesetzt, ein Gegner der DDR, ein Feind des Sozialismus zu sein.
Hanne neigte dazu, stets die Beste sein zu wollen. Später reimte sie sich in Küchenpsychologie zusammen, warum da so war: Zwischen Mutter und Vater flogen nicht selten laute Worte hin und her, und das Kind meinte, es sei schuld daran. Also mühte es sich nach Kräften, reibungslos zu funktionieren. Deswegen grämte sich Tochter Grimm, wenn sie in der Schule eine Zwei bekam und keine Eins. Zwar versprachen ihr die Eltern fünf Mark für jede Drei oder noch schlechtere Zensur, doch der pädagogische Trick klappte nicht, wie alle drei Familienmitglieder von vornherein wussten.
Eines Tages brachte sie tatsächlich eine Fünf nach Hause. Sie ärgerte sich mächtig über diese Ungerechtigkeit. Es geschah im Unterricht in der Produktion, der während ihrer Oberschulzeit eingeführt wurde, um die Schüler an die sozialistische Produktion und die siegreiche Arbeiterklasse heranzuführen. Der Beschluss von oben musste umgehend in die Praxis umgesetzt werden. Da spielte es keine Rolle, dass vielerorts die praktischen Voraussetzungen fehlten. So wurde die Schulklasse beauftragt, einen Sandhaufen vermittels Schaufeln von A zu einem etwa 20 Meter entfernten B zu befördern. Inspiriert von dem westdeutschen Spielfilm „Das Spukschloss im Spessart“, der in den sozialistischen Kinos lief, bildeten die Schüler unter Hannes Regie eine Kette, und der erste legte den Sand von seiner Schaufel vorsichtig auf die Schaufel des nächsten und so weiter und so fort.
„Skandal! Skandal!“ hieß es, nachdem das unwürdige Verhalten entdeckt wurde.
Da alle Titel, Berufsbezeichnungen und Titulierungen in der DDR männlich waren, wurde Hanne zum Rädelsführer eines Anschlags auf den Sozialistischen Unterrichtstag in der Produktion. Das hatte einen Elternabend zur Folge, der wenig gute Haare an ihrem Pferdeschwanz ließ, und eine Fünf. Beides geschah allerdings vorübergehend. Schon auf dem Zeugnis schien die Welt in Ordnung:
“Auch im Betrieb war sie eifrig und gewissenhaft bei der Sache.“ befand die Klassenlehrerin. Ein Jahr später war aus dem Rädelsführer wieder der „Typus eines verantwortungsbewussten, zielstrebigen FDJ-Funktionärs“ erstanden, wie auf dem Zeugnis verlautete, nachdem der Sandhaufen verschwunden und durch das millimetergenaue Feilen eines Metallstücks ersetzt worden war.
Hanne litt darunter, dass sie nicht als Typ für Partys aller Art begehrt wurde. Sie war neidisch auf die Schönen und Flotten in ihrer Klasse, die von Jungen umschwärmt waren. Im Vergleich zu ihnen hielt sie sich für eine graue Maus mit großer Nase und kleinen Augen. In diesem Punkt widersprach die Mutter nicht. So kam die Tochter nicht auf die Idee, es könnte den Jungen einfach zu anstrengend sein, sich mit einer einzulassen, die alles besser wusste.
„Du musst doch wissen, was du willst“, verlangte der Vater, als sie sich nicht entscheiden konnte, ob sie Medizin oder Germanistik studieren wollte. Annemarie hätte sie liebend gern als Ärztin gesehen, hielt sich aber zurück, das laut zu sagen. In Bukarest oder Budapest hätte Hanne sofort mit dem Medizinstudium beginnen können, weil sie Klassenbeste und eine fleißige FDJ-Funktionärin war. Aber die rumänische oder die ungarische Hauptstadt lagen noch viel weiter von zu Hause weg als die Hauptstadt der DDR. Schmutzwäsche heim zu bringen und thüringische Wurst mitzunehmen, wurde bei dieser Entfernung unmöglich. Obwohl die Mutter ihre Tochter am liebsten als Frau Doktor in der Poliklinik konsultiert hätte, wollte sie sie doch nicht in so weiter Ferne wissen.
Hanne sah sich zwar gern als helfender Engel im weißen Kittel, doch gleichzeitig erinnerte sie sich gut daran, wie sie zweimal ohnmächtig vom Stuhl gekippt war, nachdem sie ihren Finger versehentlich geritzt und zwei Tropfen Blut entdeckt hatte. So beriet sie sich mit dem bewunderten Deutschlehrer und bewarb sich anschließend für Germanistik. Nach der angemessenen Frist kam auf einer kleinen grauen Postkarte die Nachricht, ein Studienplatz für Wirtschaftswissenschaften stehe sofort zur Verfügung. Es war das Wesen der staatlichen Lenkung, dass fast jedem ein Ausbildungsplatz zugewiesen wurde, allerdings wenigen der, den sie angestrebt hatten.
„Soll ich abhauen in den Westen?“ fragte Hanne daraufhin tief enttäuscht ihren Vater.
Sie war nie in Westberlin gewesen und nur zweimal als Kind mit dem Vater in seine alte Heimat, nach Nürnberg, gereist. Mitschüler erzählten hinter vorgehaltener Hand als großes Geheimnis, dass es sehr einfach war, von Ostberlin aus in den Goldenen Westen zu gelangen. Man stieg dazu in eine S-Bahn, die in den Westteil der Stadt fuhr, mit einer S-Bahn-Karte für zwanzig Ostpfennige. Die Menschen ließen ihr Hab und Gut in den ostdeutschen Wohnungen sowie bei Verwandten und Bekannten zurück, bis auf ein oder zwei Koffer, die bei Reisenden nicht weiter auffielen. Damit fuhren sie nach Berlin und dort weiter mit der S-Bahn. In Westberlin verließen sie den rotgelben Zug und meldeten sich im Aufnahmelager Marienfelde als DDR-Flüchtlinge, um in ein neues Leben zu starten, das nicht so grau und arm war wie in der von den Sowjets beherrschten Ostzone und ohne die dort geforderten gesellschaftliche Aktivitäten. Viele Leute stellten Anträge, als Flüchtling anerkannt zu werden, denn das brachte eine finanzielle Starthilfe in das neue Leben. Viele kamen anfangs bei Verwandten unter. Hannes Tante, die Schwester des Vaters in Nürnberg, war jedoch von abweisender Art. Annemarie schimpfte sie einen Geizkragen. Weder Hilfe noch Geld konnte man von ihr erwarten.
Im Sommer nach Hannes Abitur ergoss sich der Flüchtlingsstrom wie eine große Welle in den Westen. Oder wie eine Lawine, die anschwoll, weil sie immer größere Massen mit sich riss. Der westliche Rundfunk brachte in jeder Nachrichtensendung Zahlen, wie viele Menschen am gestrigen Tag, in der vergangenen Woche, im letzten Monat und seit Beginn der deutschen Teilung abgehauen waren. Republikflucht hieß dieses Verbrechen in der DDR. Jeder fünfte Bewohner suchte bis zum August 1961 die Freiheit im Westen und ließ die kommunistischen Machthaber im Osten zurück. In den Augusttagen bis zum 13. waren es 47-tausend Menschen, die flüchteten. Jeder kannte jemanden, der nicht in seine Wohnung zurückkehren würde. Aus jeder Straße in jedem Ort des Landes fehlten Bürger. Hanne sann darüber nach, ob man nicht nachmachen müsse, was so viele taten. Also fragte sie ihren Vater. Statt einer vernünftigen Antwort schimpfte er, sie sei von den Kapitalisten und von ihrem Großvater verhetzt worden. Beim zweiten Versuch, einige Tage später, reagierte er ruhiger und bemühte sich um eine ernsthafte Antwort.
Auf keinen Fall wollte Hanne sozialistische Wirtschaft studieren. Das begriff ihr Vater. Er sah es sogar ein. Also erklärte er ihr, im Osten wie im Westen sehe er Gutes und Schlechtes. „Meiner Meinung nach“ sagte er, „gilt es abzuwägen, wo das Gute überwiegt.“
Nach einer Pause fügte er hinzu: „Noch immer sehe ich die DDR als den besseren Staat, auch wenn es wahrscheinlich nur ein bisschen besser und gerechter zugeht im Sozialismus als im Kapitalismus, nur ein bisschen.“ Er atmete tief: „Weißt du, das muss jeder selbst herausfinden und entscheiden.“
Das schien Hanne ein aufrichtiges Bekenntnis zu sein, aber es ließ sie allein mit ihren Zweifeln. Sie musste sich ganz allein entscheiden.
In politischen Fragen hatte sich der Vater selten gelassen geäußert. Mit dem Großvater stritt er immer sehr laut. Die Lautstärke beruhte auf Gegenseitigkeit, und Mutter und Großmutter sagten dann nur: „Jetzt politisieren sie wieder.“
Hinter dem Rücken des Vaters half ihr die Mutter. Gemeinsam verfassten beide einen Brief an den Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht. Die Leute in der DDR witzelten hinter vorgehaltener Hand, einen Wunsch habe jeder Bürger beim Spitzbart frei. Also tippte die Mutter in die Schreibmaschine, was für ein tüchtiges und intelligentes Mädchen Hanne sei und dass sie das Abitur als beste der Schule und damit der ganzen Stadt M. abgelegt habe. Und auch gesellschaftlich sei sie aktiv. Als Belohnung dafür müsse doch der gewünschte Studienplatz bereit stehen. Annemarie wagte es, parteilos wie sie im Gegensatz zu Willi, dem Genossen der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, war und Hausfrau noch dazu, zu erwähnen, wie wenig es verwundere, wenn junge Menschen in den Westen gingen, die so vor den Kopf gestoßen würden. Wirtschaftswissenschaften statt Germanistik!
Gut, dass der Vater nichts von dieser leichtsinnigen Äußerung wusste, die ein misstrauischer Mensch als feindlich gegenüber dem sozialistischen Staat hätte auslegen können! Den Brief zeigten die beiden Verschwörerinnen ihm erst, als nach der zweizeiligen Nachricht aus dem Büro des Staatsratsvorsitzenden, die Sache würde bearbeitet, zwei Wochen später wieder eine kleine graue Postkarte eintraf. Sie enthielt nichts als die Nachricht, Hanne G. würde zum Germanistikstudium zugelassen und am 23. August 1961 immatrikuliert.
Sie hatte großes Glück gehabt. Oder war es historisch gesehen eher Pech? Jedenfalls wurde sie auf ein Gleis gelenkt, das sie nach Ostberlin und in die Humboldt-Universität führte.
Hätte sie anstelle der Zu- eine Absage erhalten, hätte sie sich womöglich gen Westen aufgemacht und ihr ganzes weiteres Leben wäre anders verlaufen. Vielleicht aber hätte sie es gar nicht mehr bis in den Westen geschafft, weil der 13. August 1961 ihr dazwischen gekommen wäre.
An diesem Tag startete die DDR eine weltweit einmalige Aktion. Sie mauerte sich ein, indem sie eine Mauer baute, die auf sozialistisch fortan "antifaschistischer Schutzwall" hieß. Westberlin war wie eine Insel rundum von der DDR umgeben. Um diesen größeren Teil der Stadt Berlin wurde in einer Nacht- und Nebel-Aktion eine Trennwand hochgezogen und in den folgenden Jahren mit viel schöpferischer Phantasie und militärischen Mitteln nahezu unüberwindlich gemacht. Auch an der Grenze zu Westdeutschland wurde eine Mauer errichtet.
Für Menschen wie Hanne wandelte sich der Staat vom 12. auf den 13. August zu einem Gefängnis, Zwar war das Gefängnis so groß wie die DDR, aber eine Flucht aus dieser Haftanstalt wurde so schwierig und lebensgefährlich wie aus jedem Hochsicherheitstrakt. Wer das Land verlassen wollte, begab sich von nun an in Lebensgefahr. Auf Flüchtlinge wurde geschossen.
Das alles geschah neun Tage, bevor Hanne zum Studium nach Berlin fuhr. Als im Radio gemeldet wurde, die DDR baue eine Mauer, ging Hanne in M. mit Freunden spazieren. Anstatt sich voneinander zu verabschieden, stritten sie erregt darüber, ob von nun an innerhalb der DDR mehr Freiheit herrschen würde. Die Menschen konnten nicht mehr wegrennen. Das könnte allerdings auch zur Folge haben, meinte Hanne, dass die Kommunisten jetzt tun und lassen, was sie wollen. Schließlich gab es keine Alternative mehr zur DDR und ihrer Sozialistischen Einheitspartei. Hanne begann vor Empörung zu weinen, als sie diesen Gedanken dachte. Klaus, ein Schulkamerad, mit dem sie nichts hatte und auch nicht viel zu tun haben wollte, sah die Sache ganz anders und erklärte sie zu einer Heulsuse, die keine Ahnung habe. Der Sozialismus sei nämlich von den neidischen und Macht gierigen Imperialisten bedroht worden, die die DDR unterwandert hätten und ausbluten lassen wollten. Sie hätten ihr die Menschen geraubt, indem sie sie mit falscher Propaganda lockten, was nun endgültig zu Ende sei. Außerdem hätten sie die DDR leer gekauft, die billigen sozialistischen Waren weggeschleppt. „Das ist nun vorbei, endgültig!“ freute sich Klaus.
„Glaubst du wirklich, dass die Rundfunkwellen jetzt an der Schutzmauer abprallen?“ fragte Hanne mit gehässigem Unterton. Mit plötzlich aufkommender Furcht fügte sie hinzu: „Und wenn die Amerikaner sich das nicht gefallen lassen? Dann haben wir den dritten Weltkrieg! Und Atombomben noch dazu! „
Klaus übersah ihre Angst: „Die fangen doch keinen Krieg gegen die Sowjetunion an. Wegen ein paar Mauersteinen und Westberlin!“
Sie brüllten sich in der Folge noch ein bisschen an und gelobten, einander nie wieder sehen zu wollen. Obgleich die Mauer dafür sorgte, dass beide und die übrigen 17 Millionen in der DDR bleiben mussten.