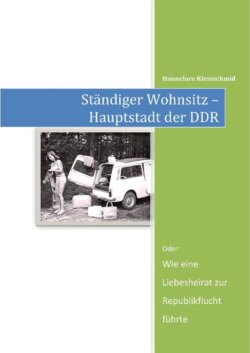Читать книгу Ständiger Wohnsitz: Hauptstadt der DDR - Hannelore Kleinschmid - Страница 5
4. Des Generals Töchterchen
ОглавлениеMit den Zimmergenossinnen im Studentenheim wuchs Hanne nicht zu einem Kollektiv zusammen. Über „Guten Morgen“ und „Gute Nacht“ ging der Kontakt nicht hinaus. Am dritten Tag war keine Toilette in dem großen Gebäudekomplex mehr benutzbar. Überall hatte die zukünftige geistige Elite des Landes Dinge ins Klo geworfen, die weder Spülung noch Abwasserrohre bewältigen konnten. Das bedeutete ekelhafte Verschmutzung allerorten. Ein enttäuschender Eindruck mit aufhaltender Wirkung!
Doch Hanne hatte Glück. Zwar war sie nicht abergläubisch, aber ihre Geburt als Sonntagskind wirkte sich offensichtlich aus. Die Zeit der mobilen Telefone stand erst mehr als drei Jahrzehnte später bevor, und ein Kennzeichen der DDR-Planwirtschaft bestand darin, dass Telefone Mangelware blieben bis zuletzt und Anmeldungen für einen berechtigten Telefonanschluss – nicht jeder Irgendwer durfte einen solchen Antrag abgeben – hatten eine Laufzeit bis zu 14 Jahren. So kam es zu einer spontanen Handlung, als sich Hanne und eine der seltenen intakten, damals noch gelben Telefonzellen sowie zwei Groschen Gebühr zufällig begegneten: Hanne rief die Dame an, die sie im Zug nach Berlin kennen gelernt hatte. Überaus freundlich verkündete die Frau, ihre Mutter verfüge tatsächlich über ein nicht vermietetes möbliertes Zimmer, für das sie die junge Reisebekanntschaft als ideale Bewohnerin vorgeschlagen habe.
Hoch erfreut wurde Hanne noch am selben Tag dort vorstellig. Bedenkt man den Zustand der sanitären Anlagen und das Klima im von fünf Personen bewohnten Vier-Bett-Zimmer, versteht man das Glücksgefühl, mit dem sie kurz darauf ihr Felsbrocken schweres Gepäck von Biesdorf nach Pankow beförderte.
Durch das einzige Fenster des Zimmers blickte man auf graue Rückwände und in den Hof, die Möblierung war ältlich und abgenutzt, aber die junge Studentin konnte die Tür schließen und war dann allein. Sie konnte entscheiden, wann sie las, wann sie das Licht an oder aus schaltete und wann sie schlief. Wie sich nach wenigen Tagen herausstellte, wurde das Alleinsein zu einer merkwürdigen Angelegenheit. Die Zimmerwirtin mokierte sich darüber, wie das von der Mutter verwöhnte Mädchen die Tagesdecke über das Bett breitete. Oft sah sie sich genötigt, glättend nachzubessern. Abends mit den Schnellheftern vom Studium und einer Reihe von Büchern allein zu sein, war nicht das, was sich Hanne unter dem Studentenleben vorgestellt hatte. Verdammt einsam kam sich Annemaries und Willis Tochter als Untermieterin vor, obgleich sie Gesprächen unter Kommilitonen entnahm, welchen Glückstreffer sie gezogen hatte. Noch bevor sie ihrer Mama schrieb, wie froh sie in dem Pankower Zimmer sei oder doch nicht, veränderten sich die Umstände ihres Studentenlebens schon wieder.
Alla trat für sehr kurze Zeit in ihr Leben. Ein sowjetisches Generalstöchterchen tauchte in der Seminargruppe bei den Diplomgermanisten auf. Sie sprach kein Wort Deutsch und war erst 18 Jahre alt wie Hanne. Im Gegensatz zu ihr kaute sie heftig an den Fingernägeln und schaute verlegen in die Runde. Zwar hatten die DDR-Genossen den sowjetischen Freunden mit dem Studienplatz offenbar ein Geschenk machen wollen, doch Alla fühlte sich sichtlich, als sei sie gerade vom Mond gefallen.
Bei der deutsch-sowjetischen Freundschaft handelte es sich um ein typisch sozialistisches Gewächs. Sie wurde verordnet, durch geringe Beiträge für die Freundschaftsgesellschaft DSF abgehakt und zu offiziellen Anlässen als Zeremonie gefeiert. Dann sang der sowjetische Soldatenchor „Kalinka“, der Kosakentanz Kasatschok forderte Beifallsstürme heraus, doch die offiziellen Reden machten Übersetzer erforderlich.
In der DDR-Schule galt Russisch als schwer erlernbare Sprache. Die sowjetische Besatzungsmacht hatte den Kommunisten in der Ostzone zur Macht verholfen. Russisch war ungeliebt wie das Verhältnis zu den Siegern des Zweiten Weltkrieges, die offiziell als Vorbilder und Helden hingestellt und auf Denkmalssockeln postiert wurden. Aus dem zerstörten Land hatten die Sowjets in ihr zerstörtes Land alles abgeschleppt, was nicht niet- und nagelfest und noch irgendwie brauchbar war. Offiziell als Freunde deklariert, hielt sich die Sympathie füreinander in engen Grenzen. Bei vielen DDR-Bürgern überwogen Abneigung und Arroganz. Sie erzählten sich, wie die russischen Soldaten nach dem Krieg einen Wasserhahn in die Wand schlugen und enttäuscht feststellten: „Hahn kaputt! Nix Wasser aus Wand!“
Die Menschen erhielten keine Gelegenheit, ihre Vorurteile abzubauen, denn private Kontakte waren unerwünscht. Bis in die letzten Jahre des realen Sozialismus wurden sowjetische Offiziere samt ihren Familien umgehend nach Hause geschickt, wenn sie sich privat mit Deutschen trafen. Wurden DDR-Studentinnen in Leningrad von sowjetischen Freunden geschwängert, bedeutete das die sofortige Heimreise ohne Wiederkehr.
Ab Klasse fünf war Russisch für alle Schüler Pflichtfach. Selbst die Studenten mussten nach vier Semestern Russisch ein Examen ablegen.
Aufgewachsen mit sowjetischen Kinderbüchern, lernte Hanne die erste Fremdsprache mit Begeisterung. Ganz in der Nähe der Grimmschen Wohnung waren Ein- und Zweifamilienhäuser enteignet und sowjetischen Offizieren mit ihren Familien übergeben worden. Nur wenige Straßen weiter befand sich eine sowjetische Kaserne. Oft ging Hanne über diesen Umweg von der Schule nach Hause. Meistens wartete sie vergebens, um ein Kind oder einen Soldaten zu treffen und einige russische Worte loszuwerden. Als Alla nun plötzlich im Seminarraum stand, sah sie eine Chance, ihre Russischkenntnisse auszuprobieren. So wurde sie unversehens zu ihrer Dolmetscherin und schon nach wenigen Tagen gefragt, ob sie mit der jungen Russin zusammen in ein Wohnheim für ausländische Studenten ziehen, mit ihr ein Zimmer teilen und sich als Betreuerin kümmern wolle. An Übermorgen als Umzugstag wurde gedacht. Eine schnelle Lösung musste gefunden werden, denn die Generalstochter brauchte dringend Hilfe. Das baute die Bürokratie ab und beschleunigte den Vorgang. Dass der sozialistische Staat so viel Vertrauen in sie setzte, sei als Ehre aufzufassen, wurde Hanne erklärt. Nur etwa zehn Prozent DDR-Bürger gab es im Ausländerheim. Alle gehörten der SED an. Im Nachhinein lässt sich vermuten, manch einer habe dem Ministerium für Staatssicherheit als Inoffizieller Mitarbeiter gedient. Hanne suchte und fand dafür keine Beweise. Nach der Wende erreichte sie das Gerücht, Doktor K., Dozent für Marxismus/Leninismus an der Humboldt-Universität und Bruder einer prominenten westdeutschen Schauspielerin, habe den Freitod gewählt. Er lebte als leitender Betreuer und Chef der SED-Parteigruppe viele Jahre im Ausländerheim.
Hanne selbst wurde damals nicht gefragt, ob sie in die Partei eintreten wolle. Ungeschoren verbrachte sie mehrere Semester als Betreuerin im Zweibettzimmer Nummer 203. Darin gab es gegenüber der Tür zwei Fenster, dazu zwei Betten, zwei Regale, einen zweitürigen Kleiderschrank, einen Tisch und vier Stühle sowie Spiegel und Waschbecken, Toiletten auf dem Flur und Duschen im Keller.
Nach der Wende wurde an dem Haus in der Mahlsdorfer Straße eine Gedenktafel angebracht. Es hatte ein jüdisches Altersheim beherbergt, bis die Bewohner in der Hitlerzeit nach Theresienstadt, Auschwitz und Riga verschleppt wurden. Die auf ihren Antifaschismus so stolze DDR hatte darüber kein Wort der Erinnerung verloren. Die Studenten ahnten nichts vom Schicksal der früheren Bewohner.
Nach nur wenigen Wochen als Untermieterin in Pankow zog die Germanistikstudentin mit dem schweren Gepäck erneut durch Ostberlin. Es war das letzte Mal, dass sie es allein schleppte.
Von Alla sah sie in den Tagen bis zu den Weihnachtsferien nur wenig. Die Generalstochter blieb lieber bei den Eltern in Potsdam. Von Seminaren und Vorlesungen im Fach Germanistik hätte sie sowieso nichts verstanden. Nach Neujahr kehrte sie nicht mehr zurück. Aber dank ihrer war Hanne im Köpenicker Heim gelandet, in dem nur 130 Studenten wohnten. In der eingemauerten DDR war es ein winziges Guckloch zur Welt, wenn auch vornehmlich zur kommunistisch und rot eingefärbten.
Nach Alla kam Marjatta aus Finnland für ein Semester in das Zwei-Bett-Zimmer, ein zurückhaltendes Mädchen, das wenig von sich und seinem Land erzählte. Hanne bekam im Grunde nur mit, wie schwierig die finno-ugrischen Sprachen sind. Sie lernte nicht einmal Guten Tag auf Finnisch zu sagen oder Danke, denn die Germanistikstudentin Marjatta sprach gut Deutsch.
Abends gab es warmes Essen im Wohnheim, drei Gänge zum günstigen Preis. Aber Hanne aß nicht mit. Immer bestrebt, ja nicht
zu-, sondern abzunehmen, und genauso bestrebt, mit dem Stipendium auszukommen, ging sie oft um der Geselligkeit willen in die Mensa, auch wenn deren Angebot wenig Appetit anregend war. Sie brachte Gaben aus Thüringen mit, wo die Großeltern und Eltern sich mühten, schmackhafte Wurst für die arme Studentin zu besorgen. Einen Kühlschrank gab es weder auf der Etage noch in den Zimmern, so dass in der kühlen Zeit das Doppelfenster herhalten musste.
Wenn eine Delegation der sozialistischen Partei aus Zypern in die Hauptstadt der DDR reiste, brachte ein Genosse dem Antonios einen Kanister Oliven im eigenen Öl und eine große Flasche Brandy mit, und alle seine Freunde im Heim genossen mit ihm diese Köstlichkeiten mit Brot und Salz. Gelegentlich wunderte sich das Mädchen aus der Kleinstadt über den Morgen danach. Irgendwie befand sich der Kopf nicht in seiner normalen Position. Immerhin hatten Weinbrand und Wodka und Whisky auch einen positiven Effekt. Hanne gewöhnte sich nie das Rauchen an, weil sie am nächsten Tag zum schweren Kopf den Nikotingeschmack im Mund nicht verkraften konnte. Den Eltern erzählte sie nicht davon, wie sie im „Hauptmann von Köpenick“, einer Kneipe beim S-Bahnhof, Sieg und Niederlage der Skat spielenden Mitbewohner notierte und mit ihnen Bier und Korn teilte. Von viel Lektüre und schwierigen Referaten war vielmehr die Rede.
Der Vater brummte manchen Kommentar in sich hinein, wenn er die Studentin nach drei oder vier Wochen wiedersah. Da ihre Haare irgendwo zwischen Blond und Braun keine Farbe hatten, griff sie zur Blondierung. Um die Kurzhaarfrisur der Schauspielerin Jean Seberg nachzuahmen, benutzte sie, misstrauisch gegenüber den Künsten sozialistischer Figaros, eigenhändig eine Rasierklinge und säbelte sich vor dem Spiegel seitenverkehrt die Haare streichholzkurz. Das entsprach keineswegs Willis Idealvorstellung von einer ordentlichen Frisur.