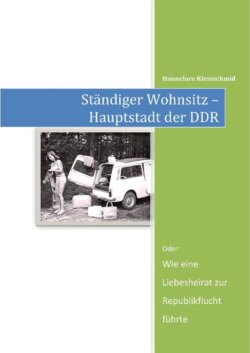Читать книгу Ständiger Wohnsitz: Hauptstadt der DDR - Hannelore Kleinschmid - Страница 6
5. Vertrauenssache
ОглавлениеHanne hatte das Germanistikstudium an der Humboldt-Universität aufgenommen, ohne überhaupt zu wissen, dass man zwei Fächer studierte und in beiden einen Abschluss machte. Ein Drittel der Seminargruppe entschied sich für Nordistik, die am selben Institut angeboten wurde. Vor allem Schwedisch und Altisländisch wurden gelehrt, da jeweils ein Professor aus der Kälte bis nach Ostberlin vorgedrungen war. Einige Mitstudenten wählten Kunstgeschichte, andere Theaterwissenschaften. Hanne wanderte einige Male zum Schwedischunterricht. Danach ließ sie sich gern überreden, zu den Theaterwissenschaftlern mitzukommen. Allerdings fühlten sich die Neuen dort anfangs überfordert, denn sie studierten zusammen mit dem dritten Studienjahr, weil die echten Theaterwissenschaftler mit einem einjährigen Praktikum anfingen und die Theorie erst im dritten Semester begann. So dauerte es noch ein Jahr, bis Hanne den Mann ihres Lebens zum ersten Mal erblickte.
An Seminaren und Vorlesungen teilzunehmen, war keine Frage des Ehrgeizes. Im DDR-Sozialismus funktionierte die gegenseitige gesellschaftliche Kontrolle. Fehlte zum Beispiel Carola V., eine Berlinerin, mehrmals hintereinander, so hieß es in der Gruppe: „Wir müssen uns darum kümmern, was los ist.“ Hanne wurde gebeten, für Carola mitzuschreiben. Doch wie die Russin würde auch die Berlinerin, mit der sie sich anfreundete, nach nur wenigen Wochen aus ihrem Leben verschwinden. Und zwar ebenfalls für immer.
Die Dozenten lehrten nach ihren eigenen Aufzeichnungen, Vervielfältigungen gingen selten darüber hinaus, ein Original mit einigen Durchschlägen in die Schreibmaschine zu tippen. Noch Jahre später wurde um die wenigen Kopiermaschinen ein ausgefeiltes Genehmigungswesen entwickelt, könnten sie doch heimlich benutzt werden, um feindliche Flugblätter herzustellen. Wissenschaftliche Bücher zur Germanistik gab es so gut wie gar nicht. In den damals zwölf Jahren DDR hatten die Experten noch zu selten Gelegenheit gefunden, die jeweilige sozialistische Version zu veröffentlichen. Der Weg vom Schreiben bis zum Druck war Zeit aufwändig und unterlag vielerlei Kontrollen.
In den sechziger Jahren war die sozialistische Variante der verschiedenen germanistischen Problemstellungen in den meisten Fällen noch subjektiv geprägt. Der Wissenschaftler, der sich damit befasste, war oft der einzige Spezialist, und die regierende SED konnte nicht einschätzen, ob er womöglich individuelle, bürgerlich verseuchte Irrwege ging.
Da es kaum Möglichkeiten gab, die Worte des Professors nachzulesen, empfahl sich, fleißig mitzuschreiben. Mit der Hand und mit Durchschlag. Nicht selten war das Kohlepapier knapp. Und manchmal schlich sich die Sehnenscheidenentzündung näher.
Auftragsgemäß schrieb Hanne für Carola mit, die nach zehn Tagen wieder bei den Germanisten auftauchte und sich mit einer Grippe entschuldigte. Die Seminargruppe akzeptierte die Entschuldigung. Immerhin war die Kommilitonin SED-Mitglied, und ihre Eltern gehörten zur diplomatischen Vertretung der DDR in den Niederlanden, waren also von Kopf bis Fuß überprüft worden, ob sie auch wirklich zu 200 Prozent hinter dem Arbeiter- und Bauern-Staat standen.
Von nun an ging das Mädchen aus Thüringen mit der zwei Jahre Älteren, die in der Hauptstadt zu Hause war, in die Mensa, in eines der Cafés oder auf Jagd nach Lektüre in die verschiedenen Bibliotheken rund um die Humboldt-Universität. Im Gegensatz zu ihr hatte sich Carola oft in Westberlin aufgehalten wie fast alle Ostberliner bis zum Mauerbau. Sie waren nahe der Grenze in die extra billigen Kinos gegangen, hatten – wie es damals hieß – bei der „HO Gesundbrunnen“, also im Westen, eingekauft, nachdem sie in den dortigen Wechselstuben viele DDR-Mark in wenige Westmark verwandelt hatten. Die DDR-Währung war nicht konvertierbar, es gab also keinen offiziellen Geldumtausch in westliche Devisen, sondern in den Wechselstuben Westberlins regelte sich der Kurs nach Angebot und Nachfrage. Wollten vor dem 13. August 1961 viele DDR-Bürger viel Geld wechseln, dann bekamen sie manchmal nur eine Westmark für zehn Ostmark. Den Ausverkauf des sozialistischen Deutschlands nannten das die SED-Propagandisten.
Carola konnte Hanne vieles erzählen. Von Literatur, die man im Westen las, vom modernen Theater in Westberlin, das sie in der vorigen Spielzeit noch besucht hatte. Sie beschrieb das Schaufenster des Westens, wie es am Kudamm leuchtete. Sie sprach leise mit meist ernstem Blick durch ihre Brille. Doch sie meldete sich jedes Mal zu Wort, wenn in der Seminargruppe diskutiert wurde. Mancher grinste hinter vorgehaltener Hand über den unvermeidlichen Beitrag der V. Andere fühlten sich genervt, weil sie dabei stets ein wenig leidend aussah. Hanne war es dagegen wichtig, eine Vertraute im fremden Berlin zu finden. Die beiden Frauen redeten stundenlang miteinander. Sie erzählten sich von ihrem Leben und davon, wie sie dachten. Über dies und jenes. Über das Studium und den Beruf. Über die Politik und den Sozialismus. Über Westdeutschland und die DDR.
Es regnet. Wie immer bespritzt sich Hanne die Beine und macht beim Gehen Perlonstrümpfe und Hosenbeine fleckig. Im November dringt das Grau in Deutschland vom Himmel bis auf die Erde. Im Ostberliner Regen siegt es. Grau in Grau wirkt die Stadt.
Hanne und Carola sind in einer Vorlesungspause die Linden entlang spaziert, als gäbe es die Nässe von oben und unten nicht. Nun sitzen sie in einem Café bei der ersten Tasse Mokka. Plötzlich fragt die Ältere: „Hast du eigentlich einen Freund? Zu Hause? In deinem Nest?“ Hanne zögert. Dann schüttelt sie den Kopf. Nach einer Weile fügt sie hinzu, irgendwie sei der Richtige noch nie gekommen.
„Einmal habe ich mir eingebildet, ich sei verliebt. Ich habe auf seine Briefe gewartet. Und mit Liebesgrüßen geantwortet. Er war ein Förstersohn. Also ganz romantisch. Aber wenn ich ihn dann traf und er mich küssen wollte, war ich sofort auf der Flucht. Habe Ausreden gesucht. Es hat mir nicht gefallen!“
Sie erzählt nicht, dass die Mutter die Briefe öffnete und las, denn zwischen ihr und der Tochter herrsche ja uneingeschränktes Vertrauen. So meinte und sagte sie jedenfalls. Dagegen nuschelte der Vater etwas von Briefgeheimnis in den nicht vorhandenen Bart.
„Mit einem Mann geschlafen hast du also noch nicht“, schlussfolgert Carola. Hanne nickt und wird rot.
„Aber auf die Hochzeit willst du doch nicht warten, oder?“
„Nein, natürlich nicht! Nur auf den Richtigen! Und wie ist es bei dir?“ wendet sie sich an die Kommilitonin.
„Ich bin gerade verliebt“ gesteht Carola „bis über beide Ohren sozusagen.“
„Und-?“ fragt Hanne und lässt die Stimme oben.
„Mensch, ich bin fast 21! Da sind viele schon längst verheiratet und haben Kinder – stehen womöglich schon vor der Scheidung!“
Carola lacht. In der Seminargruppe gibt es tatsächlich Verheiratete. Und Familienväter.
Nachdem sie einen zweiten Kaffee bestellt haben, erzählt sie:
„Der Erste war ein Schulkamerad. Meine Eltern waren schon weg. In Holland. Ich hatte die Wohnung für mich. Wir haben gedacht, es wäre an der Zeit. Er hat ein Kondom benutzt, es war irgendwie kompliziert und nicht schön.“
„Hat es wehgetan?“
„Ach, nein!“ antwortet sie. „Aber es war auch nicht toll, und ich habe furchtbare Angst gehabt vor einer Schwangerschaft.“
„Trotz des Kondoms?“ fragt Hanne erstaunt.
„Na ja“ sagt Carola, „es hat nicht so richtig geklappt.“
„Meine Mutter hat zu mir gesagt, ich solle nur dann mit einem Mann schlafen, wenn ich mir vorstellen könnte, mit ihm zusammen zu bleiben, also ihn zu heiraten. Das klingt doch vernünftig. Was meinst du?“
Carola lächelt weise, und die Provinzlerin ärgert sich. Doch dann sagt die neue Freundin: „Genauso geht es mir jetzt. Und weißt du, es ist wunderbar.“
Sie macht eine Pause, als überlege sie sich den nächsten Satz sehr genau. „Aber weißt du“ sagt sie dann „und darüber darfst du mit keinem reden, das musst du mir versprechen –„
„Versprochen!“ sagt Hanne.
„Ja weißt du, er ist aus dem Westen. Jetzt kommt er mich besuchen aus Westberlin. Dabei – wir haben uns schon vor der verdammten Mauer kennen gelernt. Alles, alles hätte ganz anders sein können! Ganz einfach!“
Hanne erklärt, wie leid ihr das täte. Und dass sie selbstverständlich kein Sterbenswörtchen darüber verlieren werde.
Zwei Wochen vergehen, in denen die beiden Freundinnen oft miteinander tuscheln. Und dann sieht Carola noch blasser und ernster aus als gewöhnlich. In dem Café gesteht sie Hanne unter dem Siegel allergrößter Verschwiegenheit: „Ich bin schwanger.“
Hanne fehlen die Worte. Nach einer langen Pause sagt Carola: „Es darf nicht sein. Nicht jetzt.“