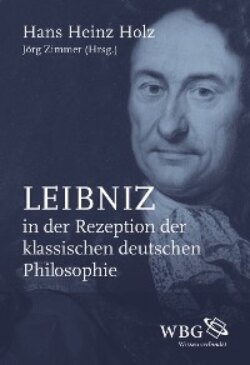Читать книгу Leibniz in der Rezeption der klassischen deutschen Philosophie - Hans Heinz Holz - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II.
ОглавлениеDas war anders in Deutschland, wo die Vernunftprinzipien noch im Vorfeld der Formierung bürgerlicher Klasseninteressen und -strategien zur Geltung kamen15 und darum in abstrakter Allgemeinheit und das heißt auch mit größerer deduktiver Reinheit formuliert wurden. Leibniz, Thomasius, Tschirnhaus und ihresgleichen strebten wohl nach einer an Prinzipien des Vernunftrechts orientierten Gesellschaft; aber die Idee des commune bonum hatte sich ihnen noch nicht in eine bloße Summe oder Resultante individueller Eigeninteressen aufgelöst. Von der axiomatischen Trias der rechtsbegründenden Gebote des Gemeinwesens steht bei Leibniz das „neminem laedere“ unbestreitbar vor dem „suum cuique tribuere“, und die dritte Regel kann sowohl das Prinzip allgemeiner Sittlichkeit „honeste vivere“ als auch das der gegenseitigen Solidarität „omnes adiuvare“ sein. In vielen Leibnizschen Entwürfen gesellschaftspolitischer Art steht die Freude am Glück des anderen ganz am Anfang (vgl. Pol. Schr. I + II sowie Grua).
Auch hier ist Toleranz keine gesellschaftsbegründende, sondern eine nachgeordnete Tugend. Ihr vorgeordnet ist das Glück des Menschen, dessen Voraussetzung wiederum die Erhaltung des Friedens ist. Wie für Hobbes und Locke, die die Erfahrung des englischen Bürgerkriegs hinter sich hatten, so ist auch für Leibniz, der zwei Jahre vor dem Westfälischen Frieden geboren wurde, und der das vom Elend des Dreißigjährigen Krieges verwüstete Deutschland16 nicht nur als Jugenderlebnis, sondern auch noch als politisches Problem in den Diensten des Erzkanzlers des Reichs17 erfuhr, der Frieden eine Hauptsorge. Frieden heißt aber – in der Zeit der Aufhebung des Edikt von Nantes, der Vertreibung der Protestanten aus Österreich – immer auch Religionsfriede. So ergibt sich für Leibniz (wie für Locke) das Toleranzgebot im Zusammenhang mit den konfessionellen Auseinandersetzungen. Am 14. März 1685 schreibt Leibniz an den Landgrafen von Hessen-Rheinfels: „Übrigens würde es zweifellos viel für das Wohl des Reiches bedeuten, wenn die Feindschaften, die noch aus religiösen Gründen bestehen, durch gegenseitige Toleranz gegenüber den Besonderheiten der Konfessionen enden würden … Als erstes müssen die Mächte sich über gegenseitige Toleranz verständigen, um die Gemüter zu besänftigen, ehe man auf eine Wiedervereinigung hoffen kann … Daher ist es meine Methode, alle guten Absichten zu unterstützen und zu loben“ (Grua, S. 188ff.).
Dabei zielt das friedenspolitische Argument in zwei Richtungen: einmal auf eine stabile Ordnung des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, zum anderen auf die Wiedervereinigung der christlichen Konfessionen. Der Landgraf war einer der wichtigsten Partner von Leibniz bei seinen Bemühungen um die Wiedervereinigung, denen er eine umfangreiche Korrespondenz und viele Denkschriften widmete – mit dem Fernziel der Einheit der protestantischen und katholischen Kirchen, vorerst aber doch wenigstens der lutherischen und reformierten.
Leibniz war sich darüber im klaren, daß die Reunion nicht nur auf gegenseitiger Akzeptanz der Verschiedenheiten beruhen könne. Zwar schreibt er am 15. April 1698 an Molanus: „Zudem handelt es sich gegenwärtig nicht so sehr um die Wahrheit und Übereinstimmung der Lehrsätze, als vielmehr um Toleranz“ (Grua, S. 424.); aber schon einen Monat später, am 30. Mai 1698, heißt es in einem Brief an Ludolf, die „conciliation doctrinale“ sei einfacher zu erreichen als die „tolérance civile“ (Grua, S. 400). Das war zwar eine rationalistische Illusion, die die Hartnäckigkeit der Vorurteile im Glauben nicht in Rechnung stellte und davon ausging, daß die „Attribute Divina“ in den Bekenntnissen kompatibel sein müßten (Grua, S. 430). So entwickelten Leibniz und Molanus in einer Denkschrift das Programm, die Streitpunkte zwischen den Kirchen seien so zu explizieren, daß nicht nur kirchliche Toleranz, sondern wahre Übereinstimmung vorbereitet werde (Grua, S. 428).
Leibniz will also keineswegs nur auf die relativistische Hinnahme der Differenzen, also letztlich auf einen in erkenntnistheoretischer Skepsis begründeten Respekt hinaus, wie ihn Pierre Bayle im Sinne hat: „Man kann nicht zweifeln, daß es eine unendliche Zahl ewiger Wahrheiten gibt, von denen wir keine Kenntnis haben … Es ist klar, daß alle Unterwerfung, die wir der Wahrheit schulden, notwendigerweise von dem Vorbehalt abhängt, daß wir sie kennen … Es gibt keine guten Gründe für die Tolerierung einer Sekte, die nicht zugleich gültig wären für die Tolerierung einer anderen“.18 Sondern es geht Leibniz um die durch Vernunft verbürgten ewigen Wahrheiten, an deren absoluten Charakter kein Zweifel möglich ist.19 Die vérités de raison dürfen nicht einmal aus dem Willen, das heißt der Willkür Gottes abgeleitet werden, sondern nur aus der Notwendigkeit seines Verstandes, aus dem lumen naturale; sonst blieben sie kontingent: „Denn auf die Masse würden veritates aeternae keine Gewißheit in sich haben, selbst bonitas et justitia Dei würden nur denominationes extrinsecae, ja gar in der That ohne Grund seyn, wenn ihre Wahrheiten allein von Gottes Willen herrührten … Ihre Erkenntnis aber fließet wie alle guthe gaben aus der freywilligen Gnade Gottes, nehmlich aus dem Licht der Natur, so Gott dem menschlichen Verstande eingegeben“ (Grua, S. 433f.). Gilt aber die Unumstößlichkeit der aus dem lumen naturale zu gewinnenden Vernunftwahrheiten, so kann Toleranz im Hinblick auf sie kein Prinzip, sondern nur eine gesellschaftliche Verhaltensmaxime sein. Der Aufklärer kann aus Gründen der Vernunft keinen Pluralismus der Wahrheit(en) zulassen, also der Toleranz keine erkenntnistheoretische Legitimation verschaffen.
Soweit würde auch der Skeptiker Bayle folgen, für den Toleranz ein Prinzip aus Konsequenz der Unsicherheit des Wissens war. Immerhin schreibt er: „Wenn diese ursprünglichen Ideen, die ihre Überzeugungskraft in sich selbst tragen, uns gegeben wurden, damit wir die Dinge richtig beurteilen, und damit wir uns einer Unterscheidungsregel bedienen, so folgt notwendigerweise, daß sie unser souveräner Richter sein sollen und daß wir ihrer Entscheidung alle Differenzen unterwerfen, die wir in dunklen Erkenntnissen haben“.20 Nur daß eben für Bayle das Reich der evidenten Wahrheiten, der Ideae clarae et distinctae, ein eng begrenztes war, dem die unendliche Menge ungewisser Meinungen gegenübersteht, über die wir keine Wahrheitsentscheidungen herbeiführen können.
Für Leibniz aber verschärft sich das Problem, denn er kann in einem durch allseitigen Bedingungszusammenhang determinierten Universum überhaupt keine reale Kontingenz anerkennen, sondern muß in letzter Instanz die Notwendigkeit (und Deduzierbarkeit) jeder Wahrheit annehmen.21 Das logische Prinzip „praedicatum inest subiecto“ ist ihm zugleich ein ontologisches: Die Welt ist das universale Subjekt, und alles, was der Fall ist (und sein kann), ist in ihr eingeschlossen; jede Wahrheit kann darum so weit auf ihre Gründe und Bedingungen transparent gemacht werden, daß sie sich als analytische erweist.22 Wahrheiten, die einmal auf diese Weise eingesehen und deduziert sind, schließen ihr Gegenteil als falsch aus; und in dieser Hinsicht kann es auch keine Toleranz gegenüber dem Irrtum, der Unwahrheit geben. Die Wahrheit ist zwingend.
Diese Konsequenz ist in einer aufklärerischen, das heißt rationalistischen Weltkonzeption unausweichlich. Nur ein Verzicht auf Metaphysik, also auf eine kohärente Konzeption von Welt im ganzen (der dann gerade nicht mehr rationalistisch wäre), könnte den Pluralismus der Wahrheiten retten. Aus dem Vernunftwesen des Menschen begründet sich die Humanität, die Humanität fordert Toleranz, die Vernunft widerspricht ihr. In diese Antinomie findet sich jede Weltanschauung verstrickt, die den Wahrheitsanspruch der Vernunft nicht aufgeben will.