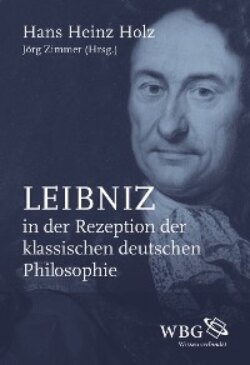Читать книгу Leibniz in der Rezeption der klassischen deutschen Philosophie - Hans Heinz Holz - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III.
ОглавлениеEs würde den gegebenen Rahmen sprengen, wollte ich nun Gottscheds Zubereitung der Leibnizschen Gedanken anhand seiner Anmerkungen in extenso verfolgen; das wäre auch eine pedantische, die Leistung Gottscheds schmälernde Beckmesserei. Ich möchte nur an einem zentralen Beispiel die Tendenz aufzeigen, die für Gottscheds Leibniz-Rezeption charakteristisch ist und von da aus das Leibniz-Bild des Bildungsbürgertums bestimmte (ja dieses Bild hat, trotz Marx’ und Lenins Wertschätzung für Leibniz, auch noch in das Verständnis der Philosophiegeschichte der Arbeiterbewegung hineingewirkt, wie Franz Mehrings Äußerungen über Leibniz zeigen).
Die zentrale und den gesunden Menschenverstand am meisten provozierende These von Leibniz ist die, unsere Welt sei die beste aller möglichen. Der Schlüssel zum Verständnis dieser These ist der Leibnizsche Möglichkeitsbegriff. Gut oder Böse ist nicht ein Seiendes an sich, sondern in seinem Verhältnis zu anderen Seienden. „Man kann das Böse in metaphysischem, physikalischem und moralischem Verstande nehmen. Das metaphysisch Böse besteht bloß in der Unvollkommenheit, das physikalische im Leiden und das moralische in der Sünde“ (Theod., Teil 1, § 21). Die bewertende Qualifikation betrifft einen Sachverhalt, einen Zustand, mithin eine Relation. In einer Welt, die eine sehr große oder unendliche Menge von Seienden oder Substanzen umfaßt, bestehen a priori unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten oder mögliche Relationen, die im Hinblick auf das Ganze oder einen Teil des Ganzen eine größere oder geringere Vollkommenheit seines Zustands darstellen, in denen für einige ein physisches Leiden entsteht oder eine moralisch verwerfliche Handlung begangen wird; das ist eine Vernunftwahrheit, die notwendig und deren Gegenteil unmöglich ist (Mon., § 33). Also gilt: „Ob nun zwar das physikalische und moralische Böse gar nicht notwendig sind, so ists doch schon genug, daß sie vermöge der ewigen Wahrheiten möglich sind. Und gleich wie diese unermessliche Gegend der Wahrheiten alle möglichen Dinge in sich fasset, so muß es unendlich viele mögliche Welten geben und das Böse muß in vielen derselben, ja selbst mit in der besten derselben enthalten sein“ (Theod., Teil 1, § 21). Denn jede mögliche Welt ist „von unermeßlicher Vielfalt“ („varieté immense“), und „es gibt eine unendliche Zahl von Figuren und Bewegungen“ („infinité de figures et mouvements“), die in das System der Ursachen und Zwecke eingehen (Mon., § 36). Aus der ontologischen Verfassung der Welt kann auch Gott die Möglichkeit des Bösen nicht ausschließen. Welt ist der Titel für „den ganzen Zusammenhang und Begriff aller vorhandenen und auf einander folgenden Dinge“, und jede Welt ist stets das Ganze alles Wirklichen und Möglichen, und nichts anderes kann außer ihr sein: „Damit man nicht sage, daß viele Welten zu unterschiedenen Zeiten und an unterschiedenen Orten da sein könnten. Denn man müßte sie doch alle zusammen für eine Welt, oder wenn man will, für ein einziges Weltgebäude halten“ (Theod., Teil 1, § 8).
Nun ist ein allen Seinsaussagen vorgeordnetes Axiom der Leibnizschen Metaphysik, daß das Mögliche zu seiner Verwirklichung hindränge: omne possibile exigit existere. In jeder Welt, auf welche Weise sie auch materialiter angefüllt sein möge, streben also die Möglichkeiten zur Verwirklichung – auch jene, die Leiden bewirken oder moralisch Böses beinhalten. Aber nicht jede Möglichkeit wird wirklich, es bleiben auch Möglichkeiten unverwirklicht. Das Prinzip der Verwirklichung ist die Kompossibilität. Was widerspruchsfrei zusammen bestehen kann, also zusammen möglich ist, wird wirklich, und in einer unendlichen Welt von bewegten Seienden, von sich verändernden Zuständen bedeutet das auch den Übergang von einer bestimmten Kombination zu einer anderen, also die Möglichkeit, immer neue Möglichkeiten zu verwirklichen. Ich zitiere Leibniz nach dem Manuskript De veritatibus primis: „Die absolut ersten Wahrheiten sind unter den identischen Vernunftwahrheiten und unter den Tatsachenwahrheiten jene, aus denen alle Erfahrung apriori bewiesen werden kann, nämlich: alles Mögliche strebt nach Existenz und existiert daher, wenn nicht etwas anderes, das auch zur Existenz strebt, es daran hindert und mit dem ersten unverträglich ist, woraus folgt, daß immer diejenige Verbindung der Dinge existiert, in der am meisten existiert, so daß, wenn wir setzen, A, B, C und D seien in bezug auf ihr Wesen gleichrangig oder gleichermaßen vollkommen, das heißt gleichermaßen bestrebt zu existieren, und weiterhin setzen, D sei mit A und B unverträglich, A aber mit jedem verträglich außer mit D, und ebenso B und C, daraus folgt, daß die Verbindung A, B, C unter Ausschluß von D existiere, denn wenn wir wollten, daß D existiere, könnte nur C zusammen damit existieren, also würde die Verbindung C, D existieren, die nun aber unvollkommener ist als die Verbindung A, B, C; daher wird hieraus offenkundig, daß die Dinge auf die vollkommenste Weise existieren.“ (KS, S. 177) Ich erinnere daran, daß Leibniz perfectio als plus realitatis definiert.
Jede Kombination von Wirklichem in einer bewegten Welt ist ein vorübergehender Zustand. Aber jeder Folgezustand ist bedingt durch die vorhergehenden (nach dem principium rationis sufficientis). Wenn die Welt die beste aller möglichen sein soll, darf die Abfolge der Zustände nicht zu einer Vermehrung des Bösen, das heißt zu einer Abnahme der Vollkommenheit führen. Das ist in der Kette der zureichenden Gründe auch nicht möglich, wenn ein erreichter Vollkommenheitszustand die Bedingung der Folgezustände ist. Denn wenn auch die Rekombination der Möglichkeiten im einen oder anderen Aspekt einen Rückschritt bringen mag, so wird doch ein Ausgangszustand erhalten bleiben, hinter den nicht mehr zurückgegangen werden kann. Diese Spiralbewegung beschreibt Leibniz: „Wenn wir sagen, daß etwas ansteigt, so wird ein anderer sagen, daß es nach langer Zeit wieder absteigt, wenn es auch irgendwann wieder ansteigt. Ich sage daher, daß der Anstieg das Wahre ist, wenn jetzt ein Punkt angenommen werden kann, unter den nicht weiter abgestiegen wird, und wenn man nach irgendeiner Zeit, wie lang sie auch immer sein möge, zu einem höheren Punkte gelangt, unter den nicht weiter abgestiegen wird“ (KS, S. 369). Die Zunahme an Vollkommenheit ist auch bei einem nicht geradlinigen Verlauf des Fortschritts gesichert.
Die Behauptung, diese Welt sei die beste aller möglichen, enthält also eine Reihe streng ontologischer Aussagen:
1. Die Welt ist die Gesamtheit alles Wirklichen und Möglichen.
2. Alles Mögliche hat die faktische Strebung, wirklich zu werden.
3. Wirklich wird alles, was kompossibel ist, woraus folgt, daß immer die größte Zahl an kombinierbaren Möglichkeiten verwirklicht wird.
4. In einer unendlichen bewegten Welt bedeutet das, daß im Ergebnis einer Bewegung eine Zunahme an Vollkommenheit erreicht wird, die Welt also vervollkommnungsfähig, perfektionierbar ist.
Daraus ergibt sich, daß diese Welt die beste aller möglichen ist, weil jede andere sich von ihr ja dadurch unterscheiden würde, daß ihr das Merkmal der Perfektionierbarkeit fehlen würde. Diese Verfassung der Welt ist eine ontologische Struktur, der ihr im ganzen als einem notwendigen Seienden zukommt. Eine notwendige Substanz dieser Art, sagt Leibniz ausdrücklich, nennen wir Gott (Mon., § 38, P 8). Damit stellt Leibniz ein rein philosophisches Verständnis (à la rigueur métaphysique) in Parallele zu einem religiösen, in theologischen Kategorien formulierbaren; der Hinweis in Mon., § 38 auf Theod., § 7 macht diese Parallelisierung ganz klar.
Wie geht nun Gottsched mit diesem subtilen ontologischen Argumentationsmuster um?
Gottsched versteht Gott in einem durchaus vortheoretischen religiösen Sinn als Individualperson, die der Welt gegenübersteht, die er geschaffen hat, sozusagen nach Art eines Handwerkers, der ein Werkstück verfertigt. Die logische Wendung des Anselmschen Gottesbeweises wird dabei verfehlt; hatte Anselm Gott definiert als „das, in bezug auf das nichts Größeres gedacht werden kann“ („id quo maius cogitari nequit“),6 so war die Welt eben per definitionem in Gott „enthalten“, und jede limitierte Einzelheit in der Welt ein unvollständiges und unvollkommenes Moment des Ganzen. Ist Gott jedoch ein Individualwesen, dessen positive Eigenschaften ein Maximum bilden, und hat er die Welt geschaffen, also aus sich herausgesetzt, so ist er ein Wesen, das „außer der Welt hockt“ und steht in einer Subjekt-Objekt-Relation zu ihr. (Gott und die Welt zusammen wären dann „größer“ als Gott allein). Dann kann man aber berechtigt die Frage stellen, warum er, der das allmächtige, allergütigste und allerheiligste Wesen ist, eine Welt unvollkommener und unvollständiger Wesen, die leiden und sündigen, wirklich werden ließ, obwohl er doch genausogut die Welt hätte ungeschaffen und nur als Möglichkeit in seinem Verstande hätte belassen können. Die Radikalität der Frage, die Leibniz aus dem Satz vom Grunde ableitet – „warum gibt es überhaupt etwas und nicht nichts? Denn das Nichts ist einfacher und leichter als etwas“ (P 7) –, wird völlig entschärft und statt dessen das Böse als privatio in das principium individuationis verlegt, das eben a priori die Beschränkung jedes Einzelwesens ausmacht. „Um aber apriori zu zeigen, daß eine Welt nicht ohne alles Böse sein könne: so erwäge man nur, daß sie notwendig aus lauter endlichen, das ist unvollkommenen Geschöpfen bestehen müsse. Wer will nun da einen reinen finden, da keiner rein ist? Ich will sagen, wie soll auch das beste einzelne Geschöpf in den Augen Gottes ohne allen Tadel sein? Aus dieser Unvollkommenheit nun, als aus einem metaphysischen Übel, fließt bei vernünftigen Wesen, von mittelmäßiger Fähigkeit, sehr leicht, ja fast unfehlbar, das moralische. So wird denn in einer jeden Welt, darin es viele Ordnungen und Klassen vernünftiger Geschöpfe geben muß, wenn sie anders den göttlichen Eigenschaften gemäß sein soll, auch solche geben müssen, die sündigen können. Und genug, daß wir Ursache haben zu glauben, diese itzt vorhandene Welt halte deren weniger in sich als alle übrige, die nicht von Gott erwählet worden“ (Gottscheds Anmerkung 17 zu Theod., Teil 1, § 21).
Gottsched unterstellt hier Leibniz, er habe die Güte Gottes darin gesehen, daß dieser den von ihm selbst gesetzten Regeln der Natur folge. Während Leibniz mit Subtilität in § 25 die Aspekte von Antezedentien, Konsequenzen und notwendigen Bedingungen auseinanderhält und einen Gottesbegriff, der sich logisch mit der Welt im ganzen deckt, in theologischen Kategorien des göttlichen Willens auszudrücken, also Ontologie auf Theologie zu projizieren versucht, macht Gottsched aus dem spekulativen Gedanken eine simple empirische Regelmäßigkeit. „Sie will nichts mehr sagen, als das z. E. ein Glas, welches auf einen Stein fällt, zerbrechen, ein Holz, welches ins Feuer kömmt, verbrennen, ein Stein, der ins Wasser fällt untersinken, oder auch ein endlicher Geist, der nicht allwissend sein kann, irren, und einer der irren kann, auch im Guten und Bösen irren, das ist, sündigen kann“ (Gottscheds Anmerkung 19 zu Theod., Teil 1, § 25). Er sieht nicht einmal, daß damit das Problem der Theodicée, Gott zu rechtfertigen, gar nicht berührt ist, denn es bliebe ja die Frage offen, warum Gott als Allmächtiger kein Wunder tut und durch sein Eingreifen als Allergütigster den Irrenden vor der Sünde bewahrt. Das heißt, das Prinzip der Güte Gottes, das Leibniz aus der Struktur der Welt ableitet, wird bei Gottsched wieder zum paradoxen Glaubenssatz – paradox, weil seine Güte dann das Leiden, das Böse, die Hölle und den Teufel einschließt; während Leibniz doch gerade mit äußerster Strenge statuiert hatte: „Nichts kann der Regel des Besten zuwider sein, bei der weder einige Ausnahme noch einiger Erlaß stattfindet“ (Theod, Teil 1, § 25).
So verfehlt Gottsched auch den ontologischen Sinn der Rede von den möglichen Welten. Nicht diese Welt ist als Totalität die beste aller möglichen, und alle anderen sind ausgeschlossen; sondern die Möglichkeiten in dieser Welt werden als sich gegenseitig einschränkend aufgefaßt (was ja korrekt ist) und darum die Optimierung nur als eine relative begriffen. Gottsched verwechselt hier das innerweltliche Selektionsprinzip der Kompossibilität mit dem weltbegründenden Prinzip der perfectio als plus realitatis. Das führt dann zu so erheiternden Vergleichen wie dem in Anmerkung 18 zu § 22: „Ein Beispiel gibt hier der Bauherr, der voluntate antecendente gern schön, dauerhaft und bequem bauen will; aber teils durch den Mangel der Materialien und guter Bauleute, teils durch den engen Platz zwischen seinen Nachbarn gehindert wird, alles zu tun, was er wohl wollte. Er tat also voluntate consequente, so viel er kann, und bringt ein Haus zu Stande, das nach dem Vermögen seines Beutels, der Natur der Materialien und Werkleute, und dem Raume des Bodens, so gut als möglich war, eingerichtet ist“. Wer sind denn Gottes Nachbarn, wer sind seine Bauleute, warum mangeln ihm die Materialien? Nein, so banal hat Leibniz das Theodizee-Problem nicht gesehen und schon gar nicht aufgelöst!