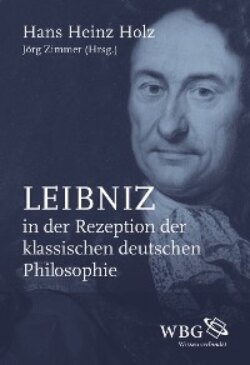Читать книгу Leibniz in der Rezeption der klassischen deutschen Philosophie - Hans Heinz Holz - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. NATUR UND METAPHYSIK BEI LEIBNIZ
ОглавлениеWolf von Engelhardt zum 90. Geburtstag
Am 12. Mai 2000 fand in der Universität Tübingen ein Festkolloquium zu Ehren von Wolf von Engelhardt statt, bei dem Hans Heinz Holz nachstehend abgedruckten Vortrag hielt.
Es ist nun fast fünfzig Jahre her, da hatte ich das Glück, einen gewichtigen Auswahlband von Leibnizschen Frühschriften zu erwerben. Er trug den Titel Schöpferische Vernunft und war „zusammengestellt, übersetzt und erläutert“ von Wolf von Engelhardt.1 Zuvor für den Handgebrauch auf Gerhard Krügers vorzügliche, aber doch sehr beschränkte Auswahl der Hauptwerke im Kröner-Verlag angewiesen,2 war dieses Buch mehr als nur eine wichtige Ergänzung; es eröffnete neue Perspektiven. Seit meinem ersten Studienjahr, in das die Dreijahrhundertfeier von Leibniz’ Geburtstag fiel und in dem jeder, der an deutschen Universitäten Rang oder Amt hatte, dem Philosophen seinen Tribut zollte, war ich von seinem Denken in Bann geschlagen. Diese Faszination hat ein Leben lang Bestand gehabt, und ich stehe nicht an, heute wie damals zu sagen, daß alle Metaphysik sich am Maßstab der begrifflichen Subtilität und systematischen Kraft von Leibniz muß prüfen lassen.
Im Vorwort zu der genannten Ausgabe Leibnizscher Frühschriften schreibt Wolf von Engelhardt, „daß dieses Denken seiner inneren Struktur nach in einer eigentümlichen Weise offen ist, das heißt: hinausweist über jedes Resultat, so wie es für den denkenden Menschen unter dem Anspruch der Vernunft in dieser Welt kein Ende gibt. Es ist offen in einem zweifachen Sinne: Offen in die Zukunft und damit über 300 Jahre hinweg auch uns noch anredend und offen in die Vergangenheit im Sinne einer philosophia perennis“ (Schriften Engelhardt, S. XV). Diese außerordentliche Offenheit, die jeder erfährt, der sich mit Leibniz beschäftigt, hat ihren Grund darin, daß er die endlichen Erkenntnisse, die wir von Natur und Menschenwelt gewinnen können, mit dem unendlichen Horizont vernünftigen Denkens methodisch vermittelt – oder streng gesagt: er vergißt nie, daß die notio completa einer Sache nur in einer infinitesimalen Annäherung konstruiert werden kann, aber eben immer auch konstruiert werden muß. Mit diesem Prinzip, das Hegel dann als „Fortbestimmung des Begriffs“ zum Leitfaden der Wissenschaft der Logik, das heißt der Dialektik machte, hat Leibniz die theoretische Verfassung dessen vorgezeichnet, was dann seit dem deutschen Idealismus „spekulative Philosophie“ genannt wurde.
Daß es der Naturforscher Wolf von Engelhardt war, der den Sinn spekulativer Metaphysik bei Leibniz festhielt, hat meinem eigenen Widerstreben gegen neukantianische oder bloß logikwissenschaftliche Deutungen eine starke Stütze gegeben. Dabei ist auch seiner Ausgabe der Leibnizschen Protogäa3 zu gedenken, die sich der Herausgabe der mineralogischen Schriften Goethes zur Seite stellt, und in der er den universalhistorischen Blick des Naturforschers Leibniz und die empirische Akribie des Universalgelehrten in ihrer Einheit bewußt gemacht hat. – Einige Jahre später kam ich dann mit Wolf von Engelhardt in persönlichen Kontakt, als die Wissenschaftliche Buchgesellschaft mich mit dem Auftrag, eine zweisprachige Ausgabe der Nouveaux Essais in neuer Übersetzung zu besorgen, der Obhut des älteren und erfahrenen Gelehrten übergab; so entstand jene Ausgabe, die unser beider Namen verbindet.4
Wohin lenkten den mit seiner Arbeit beginnenden Leibniz-Adepten die Wegzeichen, die Engelhardts Auswahlband setzte? Noch 1985 hat Daniel Garber5 daran Anstoß genommen, daß die Beziehung der Leibnizschen Metaphysik zu seinen physikalischen Untersuchungen und Anschauungen von der Leibniz-Forschung vernachlässigt werde. Engelhardts Band enthielt dagegen schon 1949 nicht nur wichtige Auszüge aus der Theorie der abstrakten Bewegung von 1668, sondern auch die bis dahin nicht edierten und für das Verständnis des Discours de Métaphysique und des Briefwechsels mit Arnauld bedeutsamen Skizzen zu einem Buche über die Naturwissenschaft von 1680 (die Garber übrigens auch 30 Jahre später noch nicht benutzte!). In dieser Auswahl von Engelhardts wurde von dem Naturbekenntnis gegen die Atheisten aus dem Jahre 1668 bis zum Discours de Métaphysique von 1686 ein Bogen geschlagen, der in der Textzusammenstellung die Einheit von Metaphysik, Logik und Naturwissenschaft bei Leibniz sofort erkennen ließ.
In jenem Manuskript-Fragment von 1680 heißt es (in der Übersetzung von Engelhardts):
„Nichts anderes nehmen wir aber an der Materie auf deutliche Weise wahr als Größe, Gestalt und Bewegung. Wenn jemand darüber hinaus den Körpern eine substantielle Form oder eine Seele und so auch Sinnlichkeit und Begehren zuschreibt, so widerspreche ich ihm zwar nicht, doch bestehe ich darauf, daß dies nichts zur Erklärung der rein materiellen Erscheinungen beiträgt, und daß es nicht genügt zu sagen, daß der schwere Körper die Erde spüre und nach ihr begehre, wenn wir nicht zugleich erklären, auf welche Weise jene Sinnlichkeit und jenes Begehren entsteht. Auf diesem Wege mußte man schließlich auf den inneren Bau der Organe des wahrnehmenden Wesens, das heißt auf mechanische Verhältnisse kommen. Denn was mit Wahrnehmung geschieht, geschieht nicht weniger mechanisch, und den Regungen der Seele entsprechen körperliche Bewegungen in den Organen, die immer mechanischen Gesetzen folgen“ (Schriften Engelhardt, S. 325).
Leibniz insistiert mit äußerster Strenge darauf, daß die Phänomene der materiellen Welt nur aus den Gegebenheiten der materiellen Welt selbst erklärt werden dürfen, wenn die „Wahrheit der Dinge“ gefunden werden soll. Ganz in Übereinstimmung mit den cartesianischen Physikern seiner Zeit erklärt er:
„Am Körper aber kann, sofern allein die Materie betrachtet wird, oder das, was den Raum ausfüllt, nichts anderes auf deutliche Weise begriffen werden, als Größe und Gestalt, die beide im Prinzip des Raumes enthalten sind, und die Bewegung, die die Veränderung des Raums ist. Deshalb kann, was materiell ist, durch Größe, Gestalt und Bewegung erklärt werden“ (Schriften Engelhardt, S. 324).
Zum traditionellen Bild vom Metaphysiker Leibniz, der die eigentliche Wirklichkeit in der Idealität mentaler Substanzen, der Monaden, gesehen habe, während die materielle Welt nur ein Phänomen sei „wie ein Regenbogen“, zu diesem Bild passen die zitierten Stellen nicht; und es läßt sich damit auch nicht vereinbaren, daß Leibniz immer wieder von „körperlichen Substanzen“ spricht, dem Materiellen also in irgendeiner Weise substantielle Wirklichkeit zuerkennt. Wie sollte ein Naturforscher von Leibniz’ Rang auch die natürliche Welt als bloßen Schein auffassen können?
Dennoch erkannte Leibniz von Anbeginn seiner Studien die Unzulänglichkeit eines rein mechanistischen Weltbilds.
„Ich habe in der Tat die Erfahrung gemacht, daß man die physikalischen Bewegungen nicht allein durch mathematische Gesetze begründen kann, sondern daß notwendigerweise metaphysische Sätze hinzugefügt werden müssen. … Aus der mathematischen Wissenschaft stammen Größe, Gestalt, Lage und deren Veränderungen, aus der metaphysischen Wissenschaft aber: Existenz, Dauer, Wirken, Erleiden, Zweck des Wirkens oder Empfindung des Wirkenden.“ (Schriften Engelhardt, S. 327f.)
Im scholastischen Begriff der substantiellen Formen, den er später durch den aristotelischen Begriff der Entelechie ersetzt und damit präzisiert, findet Leibniz einen terminologischen Schlüssel zur Lösung dieser Schwierigkeit. Das Organisationsprinzip, das jeder körperlichen Substanz ihren inneren Zusammenhalt als Einheit und ihre individuelle Besonderheit verleiht, drückt sich in der Struktur aus, die die Anordnung des materiellen Substrats ausmacht. Und diese Struktur ist begrifflich wohl zu unterscheiden von ihrem materiellen Träger, obwohl in Wirklichkeit die Struktur immer die Struktur einer Substanz ist und eine Substanz immer eine Struktur besitzt. Darum zieht Leibniz in späteren Jahren auch den Terminus Entelechie vor, weil die substantiellen Formen in scholastischer Tradition auch als separate gedacht werden. Und Goethe hat, als er den aristotelischen Begriff der Entelechie resolut adaptierte, mit Gewißheit dabei den Leibnizschen Gebrauch im Blick gehabt.6
Substantielle Form, Entelechie, dann schließlich Monade sind terminologische Versuche, den Sachverhalt zu fassen, daß die Wirklichkeit der Naturgegenstände nicht in ihrer materiellen Extension und den extensional beschreibbaren Merkmalen, Eigenschaften, Akzidentien der Gegenstände begründet ist, sondern in der formalen Verfaßtheit der zu einer Gestalt und Funktionseinheit zusammengeschlossenen Elemente eines Seienden; auch daß diese formale Verfaßtheit selbst nicht wie ein materielles Substrat begriffen werden kann, sondern als einheitstiftende Relation, die als solche nicht materiell, nicht extensional ist, vielmehr nach Art des Geistigen als intensionale Einheit von Vielen gedacht werden muß. Daraus folgt ganz selbstverständlich, daß das Verhalten der Körper in ihrer Materialität nur aus materiellen Ursachen und Zusammenhängen erklärt werden darf und wissenschaftstheoretisch dem Reich der Naturwissenschaften, ontisch dem Reich der Natur zugehört. Was aber die bestimmte Seiendheit eines Gegenstandes ausmacht, seine Identität als Dieses-da (tode ti, als welches die Substanz existiert, in der Sprache des Aristoteles) – das wird von der naturwissenschaftlichen Formulierung seiner Merkmale und Bewegungsformen nicht gedeckt und gehört in den Bereich der Metaphysik, „dadurch man apriori Grund geben kann, warum diese Sache vielmehr da ist als nicht da ist? und warum sie so und nicht vielmehr ganz anders ist“ (wie es in Gottscheds schöner Übersetzung der Theodizee heißt).7 Daß der Übergang von der Empirie der Naturwissenschaften zur Apriorität der Metaphysik genau an der Stelle liegt, wo die Einzelheit des Einzelnen als Ausdruck der Totalität der Welt begriffen werden muß, hat Leibniz im § 7f. der Principes de la Nature et de la Grâce dargelegt (KS, S. 424ff.).
Wenn Leibniz hier Physik und Metaphysik nebeneinanderstellt, welcher Juxtaposition im Titel der für den Prinzen Eugen geschriebenen Zusammenfassung seines Systems die theologische Unterscheidung von Natur und Gnade entspricht, so scheint dies einer Leibniz-Deutung entgegenzukommen, die seine Philosophie auf drei Darstellungsebenen rekonstruieren möchte.8 Die erste wäre die Ebene der physikalischen Wirklichkeit – betrachtet eben als die Wirklichkeit der Natur; die zweite die Ebene der metaphysischen Konstitution der Wirklichkeit in seelenähnlichen substantiellen Einheiten, den Monaden – betrachtet als die eigentliche Wirklichkeit, der gegenüber die Natur sich als bloßes Phänomen erweist; die dritte Ebene wäre die der theologischen Integration als Begründung des mannigfaltigen Seins der vielen Substanzen in Gott – die wirkliche Welt als beste aller möglichen in der harmonie universelle. Die jeweils niedere Ebene wäre dann eine Projektion der höheren, die Einheit des Systems und die Entsprechung von Physik und Metaphysik wäre durch die Abbildbarkeit der Ebenen aufeinander garantiert.
So verführerisch ein solches Modell ist, wenn man das verwirrende Ineinander von naturwissenschaftlichen und metaphysischen Aussagen bei Leibniz sondern und in Ordnung bringen möchte, es trifft, meine ich, den Sachverhalt nicht; so einfach ist Leibniz nicht analytisch zu ordnen und darstellungstheoretisch gefügig zu machen. Daß bei ihm ein höherer „esprit de finesse“ waltet, habe ich in meinen Anfängen bei Wolf von Engelhardt gelernt; daran halte ich fest. Das Reich der Natur als phaenomenon bene fundatum ist nicht einfach eine Projektion des Reichs der Monaden auf die Ebene der Extensionalität, sondern selbst ein Moment der metaphysischen Wirklichkeit, die immer auch eine physische ist. Es gibt nur diese eine wirkliche materielle Welt, aber die Prinzipien ihres Welt-Seins, ihrer Ganzheit, ihres gesetzlichen Zusammenhangs sind nicht materiell, wenn sie sich auch materiell realisieren. Gott ist nicht ein Deus ex machina, der von Anfang an Menschenwelt und Natur in Übereinstimmung gebracht hat, sondern das Prinzip dieser Übereinstimmung; er ist der Name dafür, wie der Mathematiker und Physiker Abraham Gotthelf Kästner in seiner Vorrede zu Raspes erster Ausgabe der Nouveaux Essais 1765 – dem Werk, in dem sich dann unsere Wege begegneten – schrieb, „daß die Welt ein Ganzes sey, dessen sämmtliche Theile so genau miteinander verbunden wären, daß, wenn man einen noch so kleinen Theil davon abreißen wollte, eine ganz andere Welt entstehen würde; daß das, was in jedem Individuum, in einem jeden Augenblicke vorgehet, mit der ganzen Welt dergestalt im Verhältnisse stehe, daß der unendliche Geist, als der Einzige, welcher das Individuum so kennt, wie es wirklich beschaffen ist, in demselben die wirklich existirende Welt erblicken müsse“.9
Muß man daran erinnern, daß es der Erfinder des Infinitesimalkalküls war, der in der Theodizee die Welt nicht einen unendlichen Gegenstand nennt, sondern ein Seiendes, das unendlich ist, da es sich in alle zukünftige Ewigkeit erstreckt – daß er mithin auch den unendlichen Geist, Gott, nicht als ein Etwas vorstellt, sondern als Grenzbegriff einer unendlichen Denkoperation, die – käme sie je zu einem Ende, was nicht geschehen kann – alles in sich aufnähme und somit auch alles Einzelne aus allen seinen Bedingungen und Beziehungen im Ganzen erkennen würde, also die notio completa von jeglicher Sache hätte (Theod., § 195).
Die Nähe zu Hegel ist unübersehbar, wenn auch die Quelle, aus der Leibniz’ Gedanken gespeist werden, eine andere ist als die Hegels. Die Orientierung aufs Ganze, die Konzeption einer notio completa, eines absoluten Begriffs, der sich aber nie gegenständlich abschließt, sondern sich nur in einer infinitesimalen Denkoperation auf jeder ihrer Stufen spiegelt – das ist das Prinzip des spekulativen Denkens und die spekulative Denkform, in der Leibniz und Hegel einander nahekommen, was Josef König (aber auch niemand sonst) in seiner Leibniz-Abhandlung von 1946 – auch diese eine meiner prägenden Studienerfahrungen – erkannt hat.10 Und an dieser Stelle mag deutlich werden, daß die Offenheit Leibnizschen Denkens, auf die als Bedingung seiner nie vergehenden Aktualität sich Wolf von Engelhardt bezog, nicht einfach ein freundlicher Charakterzug aufklärerischer Toleranz ist, sondern einen tiefen Grund in der Systemstruktur der Leibnizschen Philosophie hat.
Metaphysik und Naturwissenschaft verhalten sich zueinander nicht wie Seins- und Erscheinungswissenschaft, wie das Wissen vom Ding an sich und von den Erscheinungen. Das war Kants gründliches Mißverständnis der Leibnizschen Philosophie. Ihr Verhältnis ist übergreifend: Die Naturwissenschaft ist eine Art Metaphysik, obschon ihr Gegenteil; sie ist eingelassen in den Boden der Metaphysik,11 und eben das sagt Leibniz, wenn er die Natur, gemäß dem Modus, in dem sie sich als räumlichzeitliche zeigt, als phaenomenon bene fundatum bezeichnet. Das Wesentliche für das Verständnis des ontologischen Status der Natur ist nicht ihre Phänomenalität, sondern deren Wohlfundiertheit. Weil die Natur ein wohlfundiertes Phänomen ist, ist die Naturwissenschaft keine Erscheinungswissenschaft, sondern eine Seinswissenschaft, und Leibniz kein unvollkommener Vorläufer des transzendentalen Idealismus, sondern ein dialektischer Realist.12
Diese Einschätzung scheint dem herkömmlichen Leibniz-Bild zuwiderzulaufen. Der Antagonismus wird aber behoben, wenn wir die grobschlächtigen Klassifikationsbegriffe Idealismus und Realismus beiseite setzen und die systematische Integration des empirischen Wissens in ein transempirisches Weltmodell nicht als gleichsam photographische Abbildung, sondern als einen Konstruktionsprozeß auffassen, dessen konstitutive Prinzipien aus der Interaktion des handelnden Subjekts mit den Formbestimmtheiten und Aktivitäten der von ihm behandelten Welt entspringen und nicht aus der vorgegebenen Verfassung unseres Verstandesvermögens. Die komplizierte Dialektik der Kräfte – vis activa, vis passiva, vis primitiva, vis derivativa –, die Leibniz der Metaphysik zurechnet und doch zugleich seinem Naturverständnis zugrundelegt, bestimmt dieses Modell. In ihm, das Leibniz ausdrücklich als eine Hypothese bezeichnet, sind Naturgesetze und metaphysische Prinzipien eine systematische Einheit.
1 Gottfried Wilhelm Leibniz, Schöpferische Vernunft. Schriften aus den Jahren 1668–1686, zusammengestellt, übersetzt und erläutert von Wolf von Engelhardt, Münster/Köln 1949, 21955 (im Folgenden zitiert: Schriften Engelhardt; vgl. Siglenverzeichnis).
2 Gottfried Wilhelm Leibniz, Die Hauptwerke, zusammengefaßt und übertragen von Gerhard Krüger, Stuttgart 31949 (11938).
3 Gottfried Wilhelm Leibniz, Protogaea, übersetzt von Wolf von Engelhardt, Stuttgart 1949.
4 Gottfried Wilhelm Leibniz, Neue Abhandlungen über den menschlichen Verstand, zweisprachige Ausgabe, hg. und übers. von Wolf von Engelhardt und Hans Heinz Holz, Wiesbaden/Darmstadt 1959/1961 (NA).
5 Daniel Garber, Leibniz and the Foundation of Physics, in: Kathleen Okruhlik, James Robert Brown (Hg.), The Natural Philosophy of Leibniz, Dordrecht 1985, S. 27ff.
6 Vg. Karl Schlechta, Goethe in seinem Verhältnis zu Aristoteles, Frankfurt a.M. 1938, S. 117f.; ders., Leibniz als Lehrer und Erzieher, Mainz 1946, S. 18f.
7 Gottfried Wilhelm Leibniz, Theodizee, übers. von Johann Christoph Gottsched, Hannover/Leipzig 1744, S. 196.
8 Daniel Garber, Leibniz and the Foundation of Physics.
9 Abraham Gotthelf Kästner, Vorrede zu Gottfried Wilhelm von Leibniz, Philosophische Werke nach Raspens Sammlung, übersetzt von Johann Heinrich Friderich Ulrich, Halle 1778, Band I, S. 9 (erste deutsche Ausgabe nach der französischen von Raspe 1765).
10 Josef König, Vorträge und Aufsätze, Freiburg/München 1978, S. 27ff: Über das System von Leibniz, Vortrag zum 300. Geburtstag in der Universität Hamburg 1946.
11 Ebd., S. 34: „Die Konzeption des übergreifenden Allgemeinen ist dadurch bestimmt, … daß das Allgemeine das Allgemeine seiner selbst und seines Gegenteils ist, daß die Gattung Gattung ihrer selbst und ihres Gegenteils ist“. Vgl. dazu auch: Hans Heinz Holz, Dialektik und Widerspiegelung, Köln 1983, S. 51ff.
12 Zum phaenomenon bene fundamentum vgl.: Hans Heinz Holz, Dialektik. Problemgeschichte von der Antike bis zur Gegenwart, Band III: Neuzeit 1, Darmstadt 2011, S. 566ff.; zur Leibniz-Deutung insgesamt: ebd., S. 363–580; und: ders., Leibniz. Das Lebenswerk eines Universalgelehrten, Darmstadt 2013.