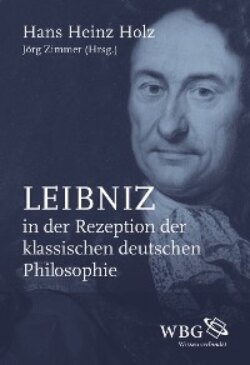Читать книгу Leibniz in der Rezeption der klassischen deutschen Philosophie - Hans Heinz Holz - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. JOHANN CHRISTOPH GOTTSCHED: LEIBNIZ’ INTEGRATION IN DIE BILDUNG DER BÜRGERLICHEN AUFKLÄRUNG I.
ОглавлениеWeich liegt das Leder in der Hand. Etwas vom Staub zweier Jahrhunderte ist an den Fingerkuppen zu spüren, die den glatten Einband halten. Eine große deutliche Fraktur macht das Lesen angenehm, hält den Blick auf der Seite fest. Die Proportion des Satzspiegels ist gefällig. Dem Herausgeber war dies wichtig, hatte er doch an der vorausgehenden Ausgabe eine „stumpfe Schrift“ und „schlechtes Papier“ zu tadeln. Nun aber kann er loben und tut dies in der Vorrede auch von Herzen:
„Was endlich das Format, Papier und die Schrift dieser neuen Ausgabe betrifft, so habe ich die Herren Verleger höchst zu rühmen, daß sie in allen Stücken meinem Rathe gefolget sind, und nichts gesparet haben, diese Ausgabe nicht nur gut, sondern auch schön zu machen. Ich bin fest versichert, daß unsre deutschen Bücher auch in die Hände der Großen dringen, und als Zierden ihrer Büchersäle, die oft so schlechten Werke der Ausländer abstechen und vertreiben würden, wenn mehrere Handlungen diesem löblichen Exempel folgen wollten“.1
„Hannover und Leipzig 1744“ lesen wir am Fuße des Titelblattes, und darüber steht: „Herrn Gottfried Wilhelms Freyherrn von Leibnitz Theodicee, das ist, Versuch von der Güte Gottes, Freyheit des Menschen, und vom Ursprunge des Bösen, bey dieser vierten Ausgabe durchgehends verbessert, auch mit verschiedenen Zusätzen und Anmerkungen vermehrt von Johann Christoph Gottscheden, Ordentl. Lehrer der Weltweish. zu Leipzig“. 1710 war das Werk erstmals in Französisch erschienen, 1720 gab es die erste deutsche Übersetzung, der allerdings erhebliche Mängel anhafteten. Bissig bemerkt Gottsched dazu: „Es gibt Leute, die sich einbilden, wenn sie halbigt ein französisches Historienbuch, oder einen Roman verstehen, so könnten sie auch die wichtigsten Werke von gründlichen Wissenschaften daraus übersetzen. Nun will ich dieses zwar dem ersten Dollmetscher der Theodicee keineswegs zur Last legen, allein so viel ist doch gewiß, daß derjenige, der dieses Buch übersetzen will, in der Philosophie, Mathematik, und Gottesgelahrtheit, mehr als mittelmäßig geübt seyn muss“.2 Jener ersten deutschen Ausgabe folgten zwei weitere, die der Leipziger Professor Richter besorgte und mit einigen kommentierenden Anmerkungen versah.
Der Band, den ich hier nun in der Hand halte, ist also die vierte Auflage, und der Herausgeber ist in der deutschen Geistesgeschichte nicht ohne Rang. Hat er doch den Kampf um die Reinigung der deutschen Sprache geführt, einem deutschen Nationaltheater auf die Sprünge geholfen, als er die große Caroline Neuberin in ihrem Bemühen um eine ernsthafte Schaubühne unterstützte; hat er doch auch in seinem Versuch einer kritischen Dichtkunst vor die Deutschen3 die nach Opitz einflußreichste und für die Entwicklung der deutschen Literatur wichtigste Poetik geschrieben. Und wenn ihn auch die Zürcher Bodmer und Breitinger und nach ihnen Lessing im Namen einer freieren, weniger regelhaften Kunst bekämpften und ihn als trockenen Pedanten zum Gespött einer jüngeren Generation machten, so ist doch sein Verdienst um die deutsche Sprache nicht zu unterschätzen.
Den Sinn für den Rang der Muttersprache, für deren Bedeutung bei der Entwicklung eines selbständigen Denkens teilte Gottsched mit Leibniz, dessen Unvorgreifliche Gedanken betreffend die Ausübung und Besserung der deutschen Sprache er 1732 neu herausgegeben hatte. Und wenn der Nachwelt eine deutsche Theodicee geschenkt wurde, die nicht nur den Gedanken von Leibniz, sondern auch der Eleganz seines Ausdrucks gerecht wurde, so ist dies Gottsched zu verdanken. Denn eben die vierte, seine Theodicee-Ausgabe ist die erste, die den Ansprüchen, die an eine deutsche Philosophie zu stellen waren, begrifflich angemessen scheint. Gottsched selbst berichtet von den Verbesserungen an der vorliegenden Übersetzung:
„Daher will ich hier dem geneigten Leser kürzlich eröffnen, was bey dieser verbesserten Auflage hauptsächlich geleistet worden.
Das erste betrifft die Verbesserung der ganzen Übersetzung. Ich habe diese nämlich durchgehends mit der zweyten franz. Ausgabe, die noch bey des Hrn. v. Leibnitz Leben in Holland herausgekommen, aufs genaueste verglichen. So richtig ich nun dieselbe (einige starke Auslassungen ausgenommen) was den Sinn betrifft, vom Anfang bis zum Ende befunden habe: so unangenehm, versteckt und rauh klang an unzähligen Stellen der deutsche Ausdruck. Es ist bekannt, daß sich seit fünfzehn bis zwanzig Jahren die deutsche Sprache sehr gebessert hat: und das zwar, nicht nur in Werken bloßen Witzes, darinn vor anderns die Schönheit und Anmuth der Schreibart herrschen muß, sondern auch in Werken des Verstandes, wo Gründlichkeit, Wahrheit und Ordnung die Oberhand haben sollen. Man hat hier angefangen, die Richtigkeit, Reinlichkeit und Deutlichkeit der Ausdrückungen für etwas mehr, als bloße Zierrathe tiefsinniger Schriften, ja fast für nothwendige Eigenschaften zu halten: indem es wirklich gewiß ist, daß ein gründliches Buch viel besser verstanden, und lieber gelesen wird, ja viel bessern Eingang in die Gemüther findet, wenn es mit solchen Eigenschaften der Schreibart versehen ist. Daran fehlte es aber unsrer Theodicee. Die Vermischung vieler ausländischer Redensarten, die Verwirrung vieler Perioden, die daraus entstehende Dunkelheit so vieler Stellen, und endlich der Mangel des Wohlklangs herrschten fast überall darinnen: und alles dieses konnte den Wahrheiten selbst, die darinn vorkommen, bey ekeln Lesern, daran es uns itzo nicht mehr fehlet, zu großem Nachtheile gereichen.
Zweytens hat Deutschland seit einiger Zeit in seiner eigenen Sprache philosophiren gelernt: so daß wir die allermeisten Kunstwörter aus der griechischen und lateinischen Sprache nicht mehr brauchen; und uns doch von den tiefsinnigsten Wahrheiten ganz deutlich, und vielleicht nur desto verständlicher zu erklären wissen, je weniger fremde Sprachen man wissen darf, um den Sinn unsrer Worte zu fassen. Man sieht daher in heutigen philosophischen Büchern fast kein fremdes Wort. Selbst die theologischen Schriftsteller sind diesem Beyspiele schon gefolget; die freyen Künste werden auch ohne das vormalige Mischmasch aller Sprachen und Zungen vorgetragen: und es kömmt nur noch auf die Rechtsgelehrten und Arzneykundigen an, um die ganze Barbarey vollends vom deutschen Boden zu verjagen. Nach dieser Anmerkung nun mußte die Theodicee auch durch und durch umgeschmolzen werden: und zwar um destomehr, jemehr der Wust ausländischen Kunstwörter in diesen metaphysischen Untersuchungen sonst geherrschet hatte. Dieses war ein wichtiges Stück meiner Arbeit, und hat nicht ein geringes dazu beigetragen, daß diese Ausgabe sich beynahe wie eine ganz neue Übersetzung lesen wird“.4
Das hört sich nach Deutschtümelei an, und viele fremde Kunstwörter, die Gottsched aus unserer Philosophie verbannen wollte, sind seither wieder zurückgekehrt, einige gewiß zu Recht, weil sie nicht ohne eine Sinnverschiebung ins Deutsche herüberzuholen waren, andere aus bloßer Manier oder gar scheinwissenschaftlicher Auftakelung. Des Wortes „Philosophie“ möchten wir wohl nicht entraten, denn „Weltweisheit“, wie Gottsched sagte, erschiene heute doch allzu betulich – obwohl es damals im Gegensatz zur Gottesgelehrtheit die Säkularisierung der Philosophie eher kämpferisch deklarierte. Indessen kann man es bedauern, daß ein Vorschlag von Leibniz, „Realität“ durch „Selbst-Wesen“ wiederzugeben, nie ins Bewußtsein der deutschen Philosophen gedrungen ist, was hätte nicht ein Hegel mit diesem kraftvollen, gedankenreichen Worte anfangen können!
Wir besitzen aus jenem Jahrzehnt, in dem Deutschland in seiner eigenen Sprache zu philosophieren gelernt hat, keine überragenden Zeugnisse deutscher Philosophie. Um so glücklicher können wir uns schätzen, daß wir von einem so bemerkenswerten Manne wie Gottsched ein so bemerkenswertes Werk wie die Leibnizsche Theodicee auf Deutsch bekommen haben, in dem der erste Höhenflug der Muttersprache sich nun sogleich auf das höchste Niveau des Gedankens erheben konnte. Das wäre kaum möglich gewesen, hätte sich der deutsche Gedanke mühsam dem zähen Grunde einer noch so wenig durchgebildeten, so wenig geschmeidigen Sprache entringen müssen; hier aber konnte er sich am fertig ausgefeilten, differenzierten Begriff üben und gleichsam mit Hilfe einer Leiter auf vorgegebenen Sprossen den First erklimmen. So daß Leibniz, eben weil er Französisch dachte und schrieb, dem deutschen Philosophieren eine mächtige Stütze gab, wie er deren selbst wohl gedachte, als er in den „Vorschlägen für eine teutschliebende Genossenschaft“ schrieb: „Denn es ist zu wissen, daß die Sprache gleichsam ein heller Spiegel des Verstandes sei, und wo die rechtschaffen blühet, da tun sich auch zugleich treffliche Geister in allen Wissenschaften herfür. …Es hat sonst die teutsche Sprach darin einen trefflichen Vorzug vor der lateinischen und denen, die aus der lateinischen entsprossen, daß sie gleichsam ein Probierstein ist rechtschaffener guter Gedanken. Denn die Franzosen, Italiener und Engländer, weilen sie die Freiheit haben, lateinische Wörter ihres Gefallens einzumischen, so ist ihnen leicht, alle Schulgrillen und undienliche Phantasien der Philosophen in ihrer Sprach zu geben. Hingegen, weil die teutsche Sprach dessen ungewohnt, daher kommt, daß die Gedanken, die man mit gutem reinem Teutsch geben kann, auch gründlich sein, was aber sich nicht in gut Teutsch geben läßt, bestehet gemeiniglich in leeren Worten und gehöret zu der Scholastik. Daher eben nicht nötig, daß man großen Fleiß anwende, die Philosophie und scholastische Theologie deutsch zu geben, sondern es ist besser, daß man der teutschen Sprach diesen Vorzug lasse, daß sie ein Probierstein der Gedanken. Denn obwohl auch die Scholastik ihren Nutzen hat, weilen doch aber derselbe allein in der Theologie gespüret wird, welche man hier billig aussetzet und ganz nicht nötig findet, daß von jedermann darin gegrübelt werde; so kann man dergleichen Redensarten im Teutschen wohl entbehren“.5