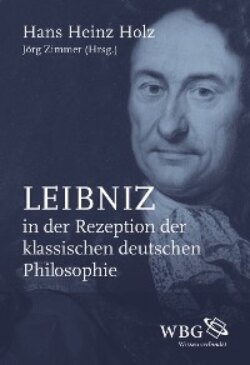Читать книгу Leibniz in der Rezeption der klassischen deutschen Philosophie - Hans Heinz Holz - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II.
ОглавлениеFranzösisch war den gebildeten Ständen im Deutschland des 18. Jahrhunderts vertraut. Selbstverständlich konnten sie die Theodicée im französischen Original lesen, und drei Auflagen zwischen 1710 und 1720, in Amsterdam erschienen, waren europaweit verbreitet. Wenn dennoch das Bedürfnis nach einer deutschen Übersetzung so groß war, daß zwischen 1720 und 1744 vier Ausgaben in drei verschiedenen Übersetzungen auf den Markt gebracht wurden, so deutet das darauf hin, daß es ein steigendes Interesse an philosophisch-weltanschaulicher Literatur auch in jenen Schichten des Bürgertums gab, die in Handwerk und Handel ihre Subsistenz hatten und noch nicht mit höherer literarischer Bildung aufgewachsen waren. Auch die Tatsache, daß Bayles Dictionnaire in vier Folio-Bänden, ebenfalls von Gottsched übersetzt, 1744 auf Deutsch erschien, ist ein Indiz dafür, daß die Rezeption des fortschrittlichsten Bildungsstands der Zeit das Bedürfnis des deutschen Bürgertums war, das den Rückstand der ökonomischen, technischen und kulturellen Entwicklung auszugleichen bestrebt war, in den Mitteleuropa seit den Verwüstungen während des Dreißigjährigen Krieges geraten war. Und eben dies war zugleich ein mächtiger Impuls, die Diskussionen und Ergebnisse der Wissenschaft nicht nur im Französischen oder Lateinischen, sondern in der eigenen Muttersprache aufzunehmen.
Nun ist Leibniz Theodicée wahrlich keine einfache Lektüre. Nicht nur sind die Varianten der theologischen Dogmenstreitigkeiten der Zeit, auch der sektiererischen Abweichungen als bekannt vorausgesetzt, sondern auch ausgebreitete Kenntnisse der theologischen und philosophischen Tradition und der wissenschaftlichen Entdeckungen der neueren Zeit verarbeitet. Es ist erstaunlich genug, welche Sachkunde einem für damalige Verhältnisse breiten Publikum bei der Lektüre der Theodicée zugemutet wird. Die fürstliche Freundin, für die die Erwägungen ja zunächst angestellt wurden, verfügte selbstverständlich über dieses Wissen, aber doch nicht der Leser, für den die deutschen Ausgaben hergestellt wurden. Zudem bewegen sich Leibniz’ eigene Gedanken auf dem hohen Abstraktionsniveau seines philosophischen Systems, das den meisten Lesern unbekannt oder nur vage bekannt gewesen sein dürfte (während er bei der Königin aus vielen vorausgegangenen Gesprächen die Vertrautheit damit voraussetzen konnte). So erklärt es sich, daß den deutschen Ausgaben der Theodicée – im Unterschied zu den französischen – von den Übersetzern Anmerkungen beigegeben wurden, die schwierige Stellen erläutern oder ergänzen sollten. Dabei ergab sich nun eine, durch Leibniz’ Darstellungsart verschuldete, Verschiebung des Erklärungsmusters.
In der Tat ist die Darstellungsart ein Problem, das sich durch das ganze Œuvre von Leibniz hindurchzieht. Wo er für einen Korrespondenzpartner schreibt, nimmt er zuweilen so weitgehend Rücksicht auf dessen Denkweise, daß seine eigene Position nur wie durch ein gefärbtes Glas erkennbar wird. Leibniz selbst hat betont, daß er für das Publikumsverständnis „exoterisch“ zu formulieren versuche, was in „akroamatischer“ Strenge (oder à la rigueur métaphysique) anders gesagt werden müsse. Man mag dabei auch an Hegels Unterscheidung denken, daß metaphysische Gegenstände philosophisch in der Form des Begriffs und religiös in der Form der Vorstellung einen jeweils eigenen Ausdruck finden. So spricht Leibniz über dieselben Sachverhalte in ontologischer Reinheit mit theologiefreien Termen und in anderer Hinsicht unter Verwendung eines theologischen Begriffssystems, dem er schließlich auch ein religiöses Alltagsverständnis unterlegen kann. An den Äquivokationen des Gottesbegriffs wird diese zu Mißverständnissen führende Vortragsart als Irritation besonders deutlich.
Gottscheds Verdienste um die Anfänge der Philosophie in Deutschland sind unbestritten; und nirgends könnten sie sich besser erweisen als in der Übersetzung eines Werks, das so sehr die Strenge spekulativer Philosophie mit der Popularität höfischer Konversation vereint, wie gerade der Theodicée, die aus den Gesprächen des Philosophen mit der ihm freundschaftlich verbundenen Königin Sophie Charlotte von Preußen hervorgegangen ist. Der vormals hannoveranischen Prinzessin verdankte Leibniz die Verwirklichung wenigstens einer seiner großen bildungspolitischen Ideen, die Gründung der Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Sophie Charlotte war schon von den Spaziergängen im Park zu Herrenhausen her das Philosophieren im geistreichen Gespräch gewöhnt; und dort war es, wo Leibniz, der Legende nach, jenes berühmte Exempel improvisierte, mit dem er seinen Begriff der Individualität (und deren Umkehrung: die lex identitatis indiscernibilium) zu belegen unternahm; indem er nämlich zeigte, daß nicht zwei Blätter eines Baumes einander völlig gleich seien, sondern sich feine Unterschiede der Gestalt und Zeichnung an ihnen finden ließen. Dieses Beispiel ist so recht aus dem Geiste eines lustwandelnd im Park geführten Gesprächs geboren, anschaulich, verblüffend, illustrativ, daß es durchaus auf eine Weise, die nun allerdings ganz und gar nicht à la rigueur métaphysique ist, einen Gedanken verdeutlichen mochte, den Leibniz auf spekulative Weise und mit apriorischer Beweiskraft gewonnen hatte. Ebenso oszilliert die Philosophie der Theodicee im Konversationsstil zwischen esoterischen Wahrheiten und exoterischer Darstellung, das heißt zwischen einer abstrakten und deduktiven Beweisführung und einer allgemeinverständlichen empirischen Erläuterung. Dies eben ist die Situation, der die Theodicée ihre Entstehung verdankt: einem halb ernsthaften, halb spielerischen, halb belehrenden, halb ergötzenden Umgang mit Theorien und Weltanschauungen, die à la mode in Kreisen gebildeter Standespersonen waren. Sophie Charlotte hatte allerlei übrig für die Freigeisterei ihrer Epoche; sie korrespondierte mit dem englischen Aufklärer und Atheisten John Toland und hatte, eine kenntnisreiche Leserin, den Dictionnaire Pierre Bayles als eine intellektuelle Gourmandise zu schätzen gewußt. So fortschrittlich war sie dann allerdings doch nicht, daß sie nach mancherlei libertinen Delektationen nicht auch eine Lehre gesucht hätte, die ihr auf undogmatische Art die Beruhigung beim vertrauten Glauben an eine väterlich gehütete und gelenkte Weltordnung erlaubte. Die Expektorationen kurfürstlicher und königlicher Hofprediger waren allerdings nicht dazu angetan, dieses Bedürfnis zu befriedigen. Was lag näher, als beim gelehrten Freunde, dessen konzilianter Art man sich ohne Furcht vor einem tiefgreifenden Schock anvertrauen durfte, Rat zu suchen? Und Leibniz, dem alles in der Welt ein Ausdrücken war, mochte in der naiven Auslegung ontologischer Konstruktionen nichts anderes als eine Projektion metaphysischer Theorie auf die Ebene anschaulichen Verständnisses erblicken, eine andere, spezifisch veränderte Form der Wahrheit, die für den Kundigen in das System notwendiger ontologischer Sätze mühelos rückzuübersetzen war. So daß er sich nichts oder doch kaum etwas vergab, wenn er mit solcherart doppelter Wahrheit spielte. Ja, für den strengen Philosophen kann dieser Rösselsprung zwischen zwei Ebenen gerade zum Ansporn werden, sich in der Anstrengung des Begriffs zu üben und auf seine Weise aus der vertrackten Verschlüsselung der akroamatischen Sätze ein geistiges Vergnügen zu ziehen.
Ich möchte hier eine Zwischenbemerkung machen. Zweifellos war Leibniz ein ganz ernster, gläubiger lutherischer Protestant. Die Projektion der semantischen Ebenen von reiner Ontologie, Theologie und untheoretischer Religiosität war für ihn gewiß der Modus, in dem sich philosophische Immanenz und Glauben verbinden ließen. Ein solches Projektionsverhältnis entsprach auch durchaus seiner eigenen Lehre, die die Beziehungen in dieser Welt – ontisch, semantisch und formal – in einer allgemeinen Theorie des Ausdrückens, der repraesentatio, zu fassen versuchte. Für jeden Interpreten entsteht jedoch hier die Schwierigkeit, die Semantiken dieser Ebenen auseinanderzuhalten und ineinander zu übersetzen. Daß dabei eine gewisse Subjektivität, ein „Fingerspitzengefühl“ für die Sinnhorizonte einer Aussage unerläßlich ist und daher Auslegungsdifferenzen unvermeidbar sind, muß als ein Moment des Leibniz-Verständnisses in Kauf genommen werden.
Nach den ersten, manchmal etwas unbeholfenen Übersetzungen wirkte die deutsche Fassung der Theodicee von Gottsched wie die sprachliche Eroberung eines geistigen Kontinents. Nicht nur wurde eine deutsche philosophische Begrifflichkeit herausgebildet – das hatten auch schon Thomasius und Wolff begonnen –, sondern in flüssiger Diktion wurde auch das Muster einer Syntax philosophischer Gedankenführung gegeben, die das Philosophieren in die entstehende Nationalliteratur zu integrieren erlaubte. Bei Lessing, Jacobi und Mendelsohn wird das spürbar. Im Spinozismus-Streit wird mit Leibnizens Sprache gefochten!
Johann Christoph Gottsched war ein Mann von brav aufklärerischer Redlichkeit, die viel vom Denkstil eines nüchternen protestantischen Pastors hat, ihm war die Dialektik zwischen Denkfiguren und ihren Projektionen (und einer dahinter gemeinten Wirklichkeit) ganz und gar fremd. Und so hat er, der Leibniz’ Gedanken in ein makelloses Deutsch herüberholte, sie im Fortgang seiner wohlmeinenden Kommentare zuweilen bis zur Lächerlichkeit trivialisiert. Er hat die schwierigen dialektischen Denkbewegungen von Leibniz in den Verständnishorizont des gebildeten protestantischen Durchschnittsbürgers überführt und damit zwar zur Popularisierung, aber auch zur Banalisierung der Leibnizschen Philosophie beigetragen. Die so erzeugten Mißverständnisse wurden dann auch in der philosophischen Leibniz-Tradition weitergetragen – was etwa an den Darstellungen von Tennemanns Geschichte der Philosophie bis zum älteren Sigwart zu überprüfen ist. (Welche Folgen das für das Metaphysik-Verständnis von Kant und Hegel hatte, ist eine weiterführende Frage). Jedenfalls hat erst Ludwig Feuerbach wieder ein Verhältnis zu den systematischen Problemen der Leibnizschen Philosophie gewonnen.