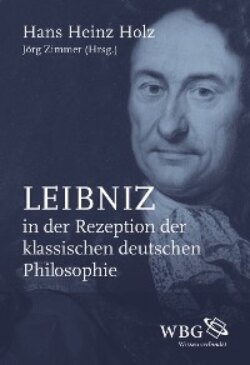Читать книгу Leibniz in der Rezeption der klassischen deutschen Philosophie - Hans Heinz Holz - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. LEIBNIZ UND PASCAL
ОглавлениеEINE MINIATUR
Das Problem der Unendlichkeit ist mathematisch und metaphysisch nachantik. Wenn es auch bei den Griechen den Begriff des Grenzenlosen (ἄπειρον) gab, so war doch ihr Wirklichkeitsverständnis fest an den Begriff der Grenze (περας) geknüpft; was jenseits einer äußersten Grenze des Kosmos lag, war das Nicht-Seiende (μὴ ὄν), und es war gemeingriechische Weltvorstellung, die Aristoteles von den frühen Philosophen berichtet: nämlich „daß zum Seienden nur das gehört, was sinnlich wahrnehmbar ist und was der Himmel umfaßt“ (990 a 4).
Erst mit dem christlichen Gottesbegriff kommt die Frage nach der Unendlichkeit ins Spiel. Von Gott hieß es, er sei „größer als alles, was gedacht (definiert = durch Grenzen bestimmt) oder gemessen werden könne“. Das mathematische Äquivalent dieser theologischen Aussage, die seit Anselm von Canterbury das Grundmuster des sogenannten „ontologischen Gottesbeweises“ bildete, ist zunächst das Problem der unendlichen Teilbarkeit einer Strecke oder eines Körpers (das „unendlich Kleine“) und der unendlichen Verlängerbarkeit einer Strecke oder Erweiterbarkeit eines Körpers (das „unendlich Große“). Bei Pascal gehen der theologische und der ontologische Aspekt ineinander über.
Leibniz nimmt die Pascalsche Problematik auf. Aber er überführt sie nun ganz in die rein mathematische Aufgabe, wie der Grenzübergang zum unendlich Großen und zum unendlich Kleinen in einem Kalkül operationalisierbar sei. Der Kalkül sollte die Möglichkeit geben, die extensionale Verfassung der Welt, ein ausgedehntes Seiendes zu sein, mit ihrem intensionalen Ausdruck, als welcher sie in jedem Punkte in ihrer Totalität sich vergegenwärtige, in einem rationalen Verhältnis zu verbinden.
Das Leibniz-Manuskript „De l’infinité“ ist in dieser Hinsicht besonders aufschlußreich, weil Leibniz den vollen Wortlaut der Pascal-Stelle aus den Pensées zitiert, um ihr dann seine eigene Umdeutung zu geben. So wird der Vergleich der zwei in mathematischen Dingen so nahe verwandten und in metaphysischen Fragen so entfernten Geister in einem kleinen Text möglich.
Daß in der Geschichte des Unendlichkeitsproblems Pascal die Leibnizsche Infinitesimalrechnung vorbereitete, ist allgemein anerkannt. Leibniz selbst hat davon gesprochen, Pascals Gedanken zur Unendlichkeit seien so etwas wie eine Einleitung in sein eigenes System (KS, S. 376ff.); er meinte das in metaphysischer Hinsicht, doch koinzidieren metaphysischer und mathematischer Aspekt des Infinitesimalen hier an dieser Stelle wie grundsätzlich überhaupt im Denken von Leibniz. Pascal jedoch geht den entscheidenden Schritt zur mathematischen Operationalisierung des limes-Begriffs nicht, und zwar aus metaphysischen, das heißt für ihn aus religiösen Gründen. Bemerkenswert ist, daß Leibniz die metaphysische Schranke bei Pascal nicht wahrnimmt, bzw. sie ignoriert, und sogleich zu seinen eigenen Vorstellungen, in denen mathematisches und metaphysisches Infinitesimal zusammenfallen, übergeht.
Pascal stellt den Menschen in die Mitte der beiden Extreme Nichts und Unendlichkeit. Aber nicht etwa als vermittelnde Mitte, sondern zerrissen zwischen den Extremen, von beiden unendlich weit entfernt und in beide blickend als in Abgründe, die ihn zu verschlingen drohen. Die Sicherheit des esprit de géométrie schlägt um in das Erschrecken des esprit de finesse vor dem Unermeßlichen und Unvorstellbaren. Das Fragment läßt die Angst spüren, die das religiöse Urerlebnis der Pensées ist. Nichts und Unendlichkeit sind hier keine Grenzwerte der Extension, sondern die wahren Seinsmodi in Gott, zu deren Erkenntnis der Mensch nicht fähig ist, in deren Mitte er nur einen Schein der Dinge begreift und angesichts derer er an der Kraft seiner Vernunft verzweifeln muß. (Dies alles sind Formulierungen Pascals).1
Leibniz exzerpiert das Fragment in extenso. Er erwähnt Pascals „Kraft der Beredsamkeit“, aber er scheint sich gegen den Ton innerster Erschütterung, ja Zernichtung zu sperren; sie gehören nicht zum Argument. Leibniz ist Aristoteliker, augustinische Seelenqualen liegen ihm fern. Der Begriff Welt impliziert eine Ordnung, also muß sie auch in der Sprache von rationalen Ordnungsparametern erfaßt und abgebildet werden können. Der Verstand Gottes und der des Menschen sind nicht strukturell verschieden, sie unterscheiden sich nur hinsichtlich des Grades der Deutlichkeit. Ja, der Verstand Gottes wird selbst nur als oberster Grenzwert gedacht.2
Man sieht, Pascal und Leibniz stehen in zwei heterogenen Sinnwelten. Und doch erkennt Leibniz bei Pascal ein Problem, das unabhängig von der metaphysischen Sinnperspektive die beiden Mathematiker miteinander verbindet. Die prinzipielle Teilbarkeit – und das heißt: bis ins unendlich Kleine fortzusetzende Teilung – des Ausgedehnten und seine ebenso prinzipielle Erweiterbarkeit verlangen eine Rekonstruktion (oder Repräsentation) der Wirklichkeit, die über die der euklidischen Geometrie hinausgeht. Idealiter hatte das schon Proklos gesehen, wenn er auch mit dem Problem noch nicht umzugehen wußte.3
Hier setzt Leibniz ein, hier erkennt er in Pascal den verwandten Geist. Auch dieser hatte bei der Teilbarkeit der Materie begonnen und begriffen, daß auch jedem noch kleineren Teil ebenso alle Bestimmungsmomente des Materiellen zukommen müssen wie dem größeren Stück; und gleicherweise bei der Erweiterung. Kann der Mensch in seiner mittleren Position ausmachen, was Materialität sei, so muß das auch für die Extreme gelten. Diese Konsequenz scheut Pascal. Die Extreme Nichts und Unendlichkeit liegen außerhalb der Reichweite eines endlichen Verstandes. In Gottes Revier will er nicht eindringen.
Mit einer kleinen Verschiebung, die allerdings das Problem sofort von seiner religiösen Dimension befreit, hilft Leibniz sich weiter. Pascal spricht vom Nichts und von der Unendlichkeit. Doch für den aristotelischen Metaphysiker wie für den mechanistischen Physiker gilt: ex nihilo nihil fit. Leibniz spricht darum vom „ersten Fast-Nichts“ und vom „letzten Fast-Alles“. Damit hat er die inkommensurablen Abgründe Pascals in Grenzwerte einer Welt verwandelt, die überall, wo sie bestimmt (und das heißt logisch: definiert; physikalisch: gemessen; und mathematisch: berechnet) wird, sich in endlichen Ausdrücken darstellen läßt. Von jedem definierten Ort aus (und nur definiert gibt es einen Ort) kann der Übergang zum Unendlichen – zum unendlich Kleinen wie zum unendlich Großen – als ein kontinuierlicher Prozeß vollzogen werden.
Hinsichtlich seiner Ausdehnung kann ein bestimmter Ort auf ein Minimum reduziert werden, wie Leibniz bei der Klärung der Grundbegriffe der Mathematik ausführt: „Si spatii magnitudo aequabiliter continue minuatur, abit in punctum cujus magnitudo nulla est“ (Logik, S. 354). Dennoch ist es sinnvoll, vom Raum als dem Ort der Örter zu sprechen (locus omnium locorum; Logik, S. 362), weil nämlich der Punkt, der keine Größe hat, nicht als artverschieden vom ausgedehnten Ort (dem Standort, vestigium; Logik, S. 360), sondern als dessen Diminuierung zu einem „unvergleichlich Kleinen“ keine Größe hat, da jeder kleinere ausgedehnte Teil als dem größeren Ausgedehnten ähnlich angenommen werden muß; und so fort in infinitum. So gibt es einen kontinuierlichen Übergang vom Augenblick zur Dauer, vom Punkt zum Raum und umgekehrt (Logik, S. 358).4 Leibniz hat darin ein Grundprinzip aller Wirklichkeitserkenntnis gesehen und es unter dem Titel lex continui als eine ebenso ontologische wie logische Struktur des Seins und des Denkens formuliert.
Unter dem Gesetz der Kontinuität verliert die Unendlichkeit den Schrecken, in den sie Pascal versetzte und der ihn „erzittern“ machte. Denn sie ist ja nun extensional als die immer weiter fortgesetzte Folge von Ähnlichen zu begreifen und aus jeder Ausdehnung „herauszuspinnen“ (um einen auf das Verhältnis von Sprache und Welt bezogenen Ausdruck Wilhelm von Humboldts analog zu gebrauchen). Die ubiquitäre Homogenität der Ausdehnung gestattet Grenzüberschreitungen ohne Wagnis. Damit verschwindet die Fürchterlichkeit des „ganz Anderen“, als welches die Unendlichkeit Gottes (oder besser: Gott mit den Eigenschaften des Unendlichen) für Pascal erschien, vor der universellen Zuständigkeit der Ratio. Das Unendliche kann berechenbar werden. Die Struktur der Welt und das Wesen Gottes fallen zusammen, à la rigueur métaphysique gilt die Gleichung: Welt im ganzen = Gott.
Wie nahe dies auch der Formel Spinozas Deus sive substantia sive natura zu kommen scheint – die Differenz ist prinzipiell.5 Denn für Leibniz ist eben die unendliche Ausdehnung in ihrer Homogenität nicht die Welt, sondern nur die Form ihrer Erscheinung. Ihr Wesen ist nicht die Einheit (wie bei Spinoza), sondern die Vielheit der aufeinander wirkenden Kräfte, deren Wirkung sich jeweils in einem „Weltpunkt“ auf besondere Weise manifestiert.6 Jeder „Weltpunkt“ ist aufgrund der Ähnlichkeit jedes Ausgedehnten mit jedem Ausgedehnten ein Analogon des Ganzen, dergestalt daß „la moindre portion contient, par l’infinité actuelle de ses parties, d’une infinité de façons, un miroir vivant exprimant tout l’univers infini“ (KS, S. 376). Die mathematische Entsprechung, die in der Homogenität der Ausdehnung begründet ist, schlägt bei Leibniz in die metaphysische Korrespondenz um, dergemäß jede Monade repraesentatio mundi ist – jede also jeder anderen ähnlich, insofern sie dieselbe Welt repräsentiert, aber jede von jeder anderen verschieden, weil sie es auf je ihre eigene Weise, unter ihrer eigenen Perspektive, tut, das heißt die Welt „ausdrückt“. Die Kategorie der Perspektivität deckt intensional denselben Sachverhalt, den die Kategorie des Standorts extensional benennt. An dieser Äquivalenz der Kategorien wird das Prinzip der Leibnizschen Onto-Logik durchsichtig: Es gibt eine spiegelbildliche Entsprechung der intensional zu beschreibenden Logik des Begriffs, der notio completa, und der extensional zu beschreibenden Logik des Urteils, der series praedicatorum. Die eine führt zur intuitio mundi (die zu einem nun ganz und gar weltlich und spekulativ gedachten esprit de finesse in Beziehung gesetzt werden kann); die andere zum calculus ratiocinator (der den esprit de géométrie operationalisiert). Beide Aspekte zusammen ergeben erst die Dialektik, die das Prinzip der Totalität (Einheit) und das der Bewegung (Vielheit) miteinander systematisch verbindet und die Einheit auf die Vielheit und die Vielheit auf die Einheit abbildbar macht. „L’harmonie preetablie … donne cette même infinité universelle dans chaque premier presque neant (qui est en même temps le dernier presque tout …), c’est à dire dans chaque point reel, qui fait une Monade“ (KS, S. 378). Der Abstand zwischen Gott und den weltlichen Einzelnen schrumpft auf eine quantitativ ausdrückbare Differenz. Denn die Monade ist „une divinité diminutive, un univers materiel eminemment. Dieu en ectype et ce univers en prototype“ (KS, S. 382). Die Verfahrensweise des Infinitesimalkalküls erweist ihre metaphysische, anti-theologische Relevanz. Die Mathematik wird zum Mittel, der Dialektisierung der Metaphysik eine extensional ausdrückbare Gestalt zu geben. Damit hat Leibniz sich von Pascal (sozusagen antipodisch) entfernt.
1 Vgl. Hans Heinz Holz, Dialektik. Problemgeschichte von der Antike bis zur Neuzeit, Darmstadt 2011, Band IV: Neuzeit 2, II. Hauptstück, Kapitel 1.
2 Vgl. Hans Heinz Holz, Leibniz, Darmstadt 2013; und ders., Dialektik, Band III: Neuzeit 1, IV. Hauptstück, Kapitel 2.
3 Proklos setzt im Parmenides-Kommentar das Eine mit dem Unbegrenzten gleich und schreibt, daß es sich durch die Totalität aller Seienden ausdehnt; in bezug auf den Körper wird die Unbegrenztheit mit der Teilbarkeit in infinitum gleichgesetzt. Proklos, Comm. in Parm. 1118 und 1119. Vgl. die englische Übersetzung von G. R. Morrow und J. M. Dillon, Princeton 1987, S. 461. – Und in der Vorrede zum Euklid-Kommentar heißt es: „Die Zahl, mit der Einheit beginnend, hat die Möglichkeit, sich ins Ungemessene zu mehren, aber immer ist die genommene begrenzt; und ebenso geht die Teilung der Raumgrößen ins Unendliche; aber die geteilten Größen sind alle begrenzt und die Teile eines jeden Ganzen begrenzt“ (übers. P. Leander Schönberger, hg. und kommentiert von Max Steck, Halle 1945, S. 155f.). Vgl. dazu auch die Ausführungen zum Punkt, ebd., S. 226. Die Dialektik von peras und apeiron ist dem Problem des Infinitesimalen auf der Spur, hat aber keinen Kalkül dafür.
4 Ebd., S. 358: „Tempus et Momentum, Spatium et Punctum, Terminus et Terminatum, etsi non sint Homogenea, sunt tamen homogona, dum unum in alterum continua mutatione abire potest.“
5 Vgl. Hans Heinz Holz, Dialektik, Band III, S. 385ff.
6 Ebd., S. 544ff.