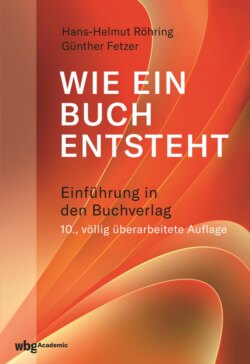Читать книгу Wie ein Buch entsteht - Hans-Helmut Röhring - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.4 Verlagstypologie
ОглавлениеDie Verlagsabteilungen, wie sie hier kurz charakterisiert wurden, sind idealtypisch dargestellt, denn schon eine erste Betrachtung der vielfältigen Verlagslandschaft macht deutlich, dass es den Buchverlag nicht gibt, sondern dass zum Beispiel Besitzverhältnisse, Programm, interne Strukturen und wirtschaftliche Daten erhebliche Differenzkriterien zwischen einzelnen Verlagen sind.
Aus den zahlreichen Versuchen, die vielfältige Verlagslandschaft zu typologisieren, seien zwei sehr unterschiedliche beispielhaft herausgegriffen. Die längste Liste von Kriterien, nach denen Verlage eingeordnet werden können, umfasst nicht weniger als 14 Positionen.
Dabei wird eine Unterscheidung der Verlage nach
• dem Inhalt des Printmediums,
• der Form des Printmediums,
• der Größe des Verlags,
• der Erscheinungsweise des Printmediums,
• der Zielgruppe,
• urheberrechtlichen Erwägungen,
• der buchbinderischen Verarbeitung des Printmediums,
• der Trägerschaft,
• der Rechtsform,
• der Urheber-Verleger-Beziehung,
• der wirtschaftlichen und rechtlichen Abhängigkeit,
• Absatzwegen,
• geografischer Bedeutung und
• der Zugehörigkeit zu einem Verband, Arbeitskreis, Verein et cetera
vorgeschlagen (Bramann/Merzbach/Münch 1999: 110).
Es ist offenkundig, dass die Kategorisierung nach Produkt, Produktmerkmalen und der Vermarktung zu vielfältig, disparat und inhomogen ist, um eine leistungsfähige Verlagstypologie zu ergeben.
Eine Typologisierung nach Konsumenteninteressen unterscheidet fünf „Interessen“ des Nutzers, die zu differierenden Verlagstypen führen: cultural interest, general interest, special interest, professional interest und scientific interest (Breyer-Mayländer 2010).
Verbindet man diese beiden Typologisierungsansätze miteinander, verbindet man also Produkttypologie und Konsumententypologie, so ergibt sich eine pragmatische Dreigliederung in Publikumsverlage, Fachverlage und Wissenschaftsverlage.
Diese mehrdimensionale Typologie erlaubt auch die Zuordnung von Verlagen, die sich der einfachen Zuordnung von General Interest und Special Interest entziehen. Bildungskonzerne sind demnach eindeutig den Fachverlagen und Ratgeberverlage, wie zum Beispiel Reiseführerverlage, den Publikumsverlagen zuzuordnen. Die Trennung von Fachverlag und Wissenschaftsverlag ist geboten, da eindeutige Differenzkriterien auf den Ebenen Produkt und Konsument gegeben sind.
Abb. 8 Verlagstypologie. Eigene Darstellung.
Zu unterstreichen ist, dass diese Verlagstypen selbstverständlich nicht immer in Reinkultur in der Verlagslandschaft auftreten. Bereits im Verlagsnamen zeigt sich, dass beispielsweise der frühere Verlag Springer Science+Business sowohl Wissenschaftsverlag als auch Fachverlag unter einem Dach war, genauer, dass sowohl Wissenschaftsverlage als auch Fachverlage zu diesem größten deutschen Verlagskonzern gehörten. Das gilt auch für den in der Nachfolge von Springer Science+Business aus einer Fusion entstandenen Konzern Springer Nature, dessen Name aber nicht mehr die zugrunde liegende Doppelstruktur erkennen lässt.
Fachverlage können sich auch in Richtung Publikumsverlage ausdifferenzieren, etwa der medizinische Fachverlag Thieme mit dem auf das allgemeine Publikum zielenden Imprint Trias, der Campus-Verlag, der seine fachspezifische Business-Literatur durch neue Produktlinien einem breiteren Publikum zugänglich macht, oder die Haufe Verlagsgruppe, die ihre Kompetenzen im Segment Recht, Wirtschaft, Steuern (RWS) in der Reihe TaschenGuide popularisiert. Wozu dient also eine Verlagstypologie? Aus analytischer Sicht ist immer die Frage nach dem Verlagstyp zu stellen. Das führt zu Fragen der Organisation eines Verlags, denn ein Fachverlag zum Beispiel wird durchaus andere Entscheidungsstrukturen und -abläufe haben als ein Publikumsverlag. Das geht weiter zu den Fragen von Prozessmanagement und Prozessoptimierung, von Workflow und Standardisierung. Und das gilt ferner für sehr konkrete Fragen der Digitalisierung sowohl der Produkte als auch des Workflows als auch des Marketings und Vertriebs.
Relevant ist eine solche Typologie auch für Branchenanalysen auf numerischer Ebene. Die Frage der Konzentration in der Buchbranche etwa wird man sinnvoll nur beantworten können, wenn man einzelne Segmente auf der Basis von Verlagstypen analysiert. Auch die historische Entwicklung der Konzentration ist unter diesem Blickwinkel zu betrachten.
Ein weiteres Beispiel ist das Hype-Thema Big Data. Es ist sicher nicht für einen mit kleinen und Kleinstauflagen operierenden Wissenschaftsverlag relevant, sehr wohl aber für einen großen Publikumsverlag. Das alles macht offenkundig, dass eine zielführende Betrachtung der Frage, wie ein Buch entsteht, auch eine differenzierte Betrachtung der Verlagslandschaft berücksichtigen muss.