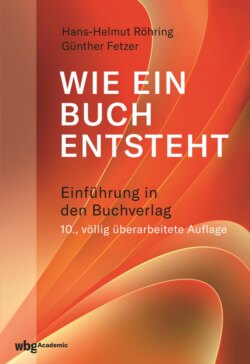Читать книгу Wie ein Buch entsteht - Hans-Helmut Röhring - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.2 Wirtschaftsdaten der Buchbranche
ОглавлениеBetrachtet man den Umsatz der Buchbranche seit der Wiedervereinigung – die ersten gesamtdeutschen Zahlen liegen für 1991 vor –, so zeigt sich in den 1990er Jahren eine deutliche Steigerung durch die große Ausdehnung des Vertriebsgebiets bei abflachender Tendenz gegen Ende des Jahrzehnts. 1991 lag der gesamte Umsatz der Branche bei umgerechnet 6,911 Milliarden Euro und stieg bis 1998 auf 9,088 Milliarden Euro – eine Ausweitung um fast 32 Prozent. Seit dieser Zeit stagniert die Umsatzentwicklung mit einem Zwischenhoch um das Jahr 2010, sodass 2017 etwa der Umsatz des Jahrs 1998 erzielt wurde, nämlich 9,131 Milliarden Euro. Diese Zahlen sind nicht inflationsbereinigt.
Die Hoffnung, dass wegbrechende Umsätze im Printbereich durch das E-Book substituiert werden könnten, wie sie die optimistischen Prognosen in den 2000er Jahren nahelegten, haben sich nicht erfüllt. Der E-Book-Markt stagniert – im Vergleich mit den USA – auf niedrigem Niveau. Sein Anteil am Publikumsmarkt betrug 2017 nicht mehr als 4,6 Prozent, wobei manche Verlage genreabhängig Umsätze von über 20 Prozent erreichten. Detaillierte Zahlen dazu liegen nicht vor.
Abb. 1 Umsätze buchhändlerischer Betriebe zu Endverbraucherpreisen 1991–2017. Quelle: Buch und Buchhandel in Zahlen. Eigene Darstellung.
Vergleicht man die Umsatzkurve der Branche mit der Entwicklung der jährlich auf den Markt gebrachten Titel, so zeigt sich bei der Titelproduktion in den 1990er Jahren ein mit den Umsätzen fast identischer Anstieg. Die Gesamtproduktion stieg von 67.890 Titel im Jahr 1991 auf 89.986 im Jahr 2001 – eine Ausweitung um rund 33 Prozent. Die Entwicklung brach abrupt im Jahr 2002 ab, als mehr als zwölf Prozent weniger Titel auf den Markt kamen als 2001.
Abb. 2 Titelproduktion 1991–2017. Erstauflagen und Neuauflagen. Quelle: Buch und Buchhandel in Zahlen. Eigene Darstellung.
Danach stieg der Titelausstoß jedoch wieder in gleichem Maß wie in den Jahren zuvor. Produktionsspitzen wurden in den Jahren 2006 und 2011 mit 96.497 beziehungsweise 96.273 Titeln erreicht. Seither ist die Entwicklung deutlich rückläufig; 2017 kamen noch 82.636 Titel auf den Markt. Diese Reduktion des Titelausstoßes bei vergleichbarem Gesamtumsatz dürfte die Rentabilität der Verlage etwas erhöht haben.
Bei der Entwicklung der Ladenpreise gibt es in der jährlichen Statistik von Buch und Buchhandel in Zahlen nur Zahlen zu den Preisen der im jeweiligen Jahr erschienenen Titel, ab Anfang der 2000er Jahre nur die Preise der Erstauflagen ohne die Nachauflagen. Der Durchschnittsladenpreis ist auch nicht nach verkauften Auflagen gewichtet, und es gehen hier auch nicht die Preise früher erschienener Bücher ein. Offenkundig ist: Nach einem moderaten Anstieg in den 1990er Jahren stagniert der durchschnittliche Ladenpreis der Erstauflagen zwischen 2002 und 2013 zwischen 24,62 Euro (2008) und 26,76 Euro (2013). Seit 2014 ist er leicht rückläufig und lag 2017 bei 24,54 Euro.
Betrachtet man jedoch die Ladenpreise aller verkauften Bücher, also sowohl die der Novitäten als auch die der Backlist, so ergibt sich ein anderes Bild. Nach Zahlen von Koch Neff & Volckmar (KNV), dem marktführenden Unternehmen des Zwischenbuchhandels, ist der durchschnittliche Ladenpreis von 15,12 Euro im Jahr 2000 auf 14,85 Euro im Jahr 2013 leicht gesunken. Die Buchpreise haben sich zudem weit unterproportional zu den Lebenshaltungskosten bewegt. Stiegen Letztere im entsprechenden Zeitraum um mehr als 130 Prozent, so lag das Preisniveau der Bücher nur um rund 22 Prozent höher. Das heißt, Bücher haben sich relativ stark verbilligt (Lucius 2014: 50). Das lag nicht zuletzt am hohen Anteil der Taschenbuchproduktion, die knapp ein Viertel des gesamten Buchumsatzes ausmacht.
Bei den Vertriebswegen, auf denen die Bücher zum Käufer gelangen, haben sich in den vergangenen Jahrzehnten zum Teil dramatische Verschiebungen ergeben. Zwischen 1991 und 2017 ist der Sortimentsbuchhandel von einem Anteil am Umsatz zu Endverbraucherpreisen von 59,8 Prozent auf 47,1 Prozent geschrumpft – bei weiter sinkender Tendenz. Die sonstigen Verkaufsstellen haben ihren Marktanteil bei knapp unter zehn Prozent halten können. Die Buchgemeinschaften und die Warenhäuser sind in dieser Zeit bedeutungslos geworden. Der klassische Reise- und Versandbuchhandel konnte gerade noch einen Anteil von 1,4 Prozent gegenüber vorher 8,1 Prozent behaupten. Der Anteil des direkten Handels zwischen den Verlagen und Endkunden hat sich von 13,9 Prozent auf 21,3 Prozent gesteigert, ist also um rund 50 Prozent gewachsen. Die höchste Steigerungsrate erzielte der Internetbuchhandel, der seit 2012 gesondert ausgewiesen ist. 2017 betrug sein Marktanteil 18,8 Prozent – allen voran Amazon mit einem geschätzten Anteil von rund drei Viertel.
Abb. 3 Anteile der Vertriebswege an den Umsätzen buchhändlerischer Betriebe zu Endverbraucherpreisen 1991 und 2017. Quelle: Buch und Buchhandel in Zahlen. Eigene Darstellung.
Die Rangliste der zehn größten Verlage, besser Verlagsgruppen, ist seit Jahren relativ konstant. Für 2017 sah sie wie folgt aus:
Abb. 4 Die zehn größten Buchverlage 2017. Quelle: buchreport.magazin 2018, Heft 4.
Auffallend ist die Dominanz der Wissenschafts- und Fachverlage: Springer Nature, Haufe, Wolters Kluwer, C.H.Beck, WEKA und Thieme. Hinzu kommen die drei Bildungskonzerne Klett, Westermann und Cornelsen. Einzig Random House gehört zu den Publikumsverlagen. Die Publikumsverlage der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck erscheinen – der dezentralen Führungsphilosophie der Gruppe folgend – getrennt und belegen unter den 100 größten Verlagen die Plätze 18 (S. Fischer), 22 (Rowohlt), 27 (Droemer Knaur), 56 (Kiepenheuer & Witsch), 83 (Groh) und 85 (Argon). Zusammen erzielten sie einen Umsatz von 245 Millionen Euro. Die Verlage der Bonnier Gruppe sind ebenfalls einzeln aufgeführt. Sie nehmen die Positionen 20 (Carlsen), 35 (Piper), 38 (Ullstein), 59 (Münchner Verlagsgruppe), 62 (Ars Edition), 77 (Thienemann Esslinger) und 90 (Hörbuch Hamburg). Zusammen erzielten sie einen Umsatz von 227 Millionen Euro. Diese Angaben bestehen in der Regel auf einer Selbstauskunft der Verlag.
Eine deutliche Sprache spricht auch die vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte Übersicht über die Anzahl steuerpflichtiger Buchverlage nach Umsatzgrößenklassen.
Einerseits zeigt die Statistik die Kleinteiligkeit der Branche – mehr als ein Drittel der Unternehmen liegen im Umsatz unter 100.000 Euro –, andererseits setzten 17 Verlage im Jahr 2016 zwischen 25 und 50 Millionen Euro um, 20 Unternehmen mehr als 50 Millionen Euro.
Abb. 5 Verlage nach Umsatzgrößenklassen 2016. Quelle: Statistisches Bundesamt.
Zahlen aus dem Jahr 2011 – neuere liegen nicht vor – belegen, dass diese oberste Umsatzklasse (20 Verlage) mehr als zwei Drittel aller Umsätze tätigte. Nimmt man noch die 18 Verlage zwischen 25 und 50 Millionen hinzu, so steigt der Anteil auf mehr als drei Viertel. Die Tendenz der Umsatzverlagerung auf große Unternehmen dürfte in den letzten Jahren eher zu- als abgenommen haben. Anzumerken bleibt, dass die deutschen Verlage und Verlagsgruppen im Vergleich zu den weltweit führenden Konglomeraten eher klein sind. Das globale Ranking führte 2017 das Bildungsunternehmen Pearson (Großbritannien) mit 5,31 Milliarden Euro Umsatz an, gefolgt von der RLX Group/Reed Elsevier (Großbritannien/Niederlande) mit 4,60 Milliarden Euro und knapp dahinter Thomson Reuters (Kanada/USA) mit 4,59 Milliarden Euro.
Auch im Zwischenbuchhandel haben Verschiebungen zugunsten der großen Marktteilnehmer stattgefunden. Heute sind auf dieser Handelsstufe noch knapp 70 Unternehmen tätig. Man geht davon aus, dass in den vergangenen 40 Jahren mehr als zwei Drittel der Barsortimente vom Markt verschwunden sind, den sich heute drei Unternehmen aufteilen (zur gegenwärtigen Situation vergleiche Bez 2018). Im Februar 2019 erschütterte die Nachricht die Branche, dass das größte Unternehmen in diesem Segment, die in Stuttgart ansässige KNVGruppe, Insolvenz angemeldet hat.
Im Bucheinzelhandel erzielte Amazon 2017 mit seinem reinen Online-Angebot einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro. Dahinter folgen die großen Filialisten Thalia (ca. 290 Filialen, 950 Millionen Euro), Weltbild (141 Filialen, 440 Millionen Euro) und Hugendubel (ca. 110 Filialen, 340 Millionen). Der größte Regionalfilialist in Deutschland, die überwiegend in Nordrhein-Westfalen tätige Mayersche, mit 53 Filialen und einem Umsatz von 155 Millionen Euro gab Anfang 2019 den Zusammenschluss mit Thalia bekannt. Alle Umsätze sind geschätzt (zur gegenwärtigen Situation vergleiche Riethmüller 2018).