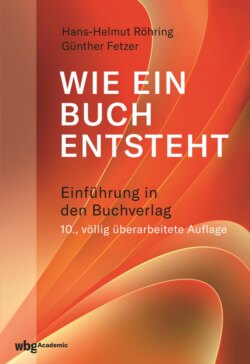Читать книгу Wie ein Buch entsteht - Hans-Helmut Röhring - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.1 Gliederung der Buchbranche
ОглавлениеNach Reclams Sachlexikon des Buches ist ein Verlag „wirtschaftswissenschaftlich eine Produktionsorganisation, in der die Herstellung bestimmter Güter durch (formal) selbstständige Gewerbetreibende durch einen Dritten (Verleger) mehr oder weniger umfassend organisiert ist. Dabei wird eine dezentrale, überwiegend handwerkliche Produktion mit einer zentralen Organisation des Absatzes verbunden.“ Diese allgemeine Definition von „Verlag“ beschreibt die Situation manufakturellen Handelns, etwa zur Zeit des Spätmittelalters und der Frühneuzeit, als ein Wirtschaftsunternehmer (Verleger) aufgrund seiner finanziellen Möglichkeiten Geld vorlegen konnte, um Handwerker mit der Herstellung von Waren beauftragen zu können, die er dann zentral vermarktete. In diesem Sinn gab es unter anderem Bierverlage und Tuchverlage. Aber auch für die modernen Buchverlage traf und trifft diese Definition zu, indem der Verlag ins ökonomische Risiko geht und eine Ware auf den Markt bringt, von der er die begründete Hoffnung hat, dafür Abnehmer zu finden. So ist der Buchverlag „ein Medienunternehmen, das Werke der Literatur, Kunst, Musik oder Wissenschaft als Werke von Urhebern in verschiedenen Formen aus ökonomischen und kulturellen Gründen vervielfältigt und verbreitet. Er erfüllt drei Kernfunktionen: Er wählt Inhalte zielgruppenadäquat aus, vermarktet diese ausgewählten Inhalte und übernimmt das wirtschaftliche Risiko für Produktion und Vermarktung“ (Rautenberg 2015: 403).
Die Hauptaufgabe eines Buchverlags besteht also darin, das Werk eines Autors zu veröffentlichen und zu verbreiten. Daraus erwächst das gemeinsame Ziel des Autors und des Verlags: Das Werk – es muss nicht immer ein Buch sein – soll von möglichst vielen Menschen gelesen und somit auch möglichst häufig verkauft werden. All dies jedoch ohne Gewähr, dass alle hergestellten Exemplare auch zum kalkulierten Preis verkauft werden können.
Im Regelfall sind der Verleger und die Mitarbeiter eines Verlages jedoch nicht nur Hersteller und Händler bedruckten Papiers, sondern sie sind auch an den Inhalten interessiert. Es ist den Verlagen normalerweise also nicht gleichgültig, welche Bücher sie verlegen, sondern sie wählen Programmbereiche, das heißt thematische oder zielgruppenspezifische Inhalte, und Autoren aus. Neben dem Kriterium der Verkäuflichkeit sind es meist objektive oder zumindest selbst definierte Kriterien der fachlichen oder literarischen Qualität, der künstlerischen oder weltanschaulichen Zielsetzung.
Kein Verlag kann es sich auf Dauer leisten, kaufmännische Überlegungen zu vernachlässigen. Das Fehlen von betriebswirtschaftlichem Know-how führt fast zwangsläufig in die Pleite und bedeutet damit das Ende des verlegerischen Engagements. Diese eigentlich selbstverständliche Tatsache muss dennoch hervorgehoben werden, weil es die weit verbreitete Meinung gibt – und keineswegs nur bei Laienkritikern und Avantgarde-Autoren –, dass Verlage und Buchhändler Kulturträger der Nation seien, denen es demzufolge eher peinlich sein müsse, wenn sie mit Konsumware und mit so genannten Bestsellern ordinäres Geld verdienen.
Es geht also nicht ohne Konsumware. Das gilt besonders für die Publikumsverlage mit gemischtem Belletristik- und Sachbuchprogramm, die sich an ein breites, allgemeines, fachlich nicht spezialisiertes Publikum wenden. Die Programmpalette ist breit gefächert und reicht von (Unterhaltungs-)Romanen der verschiedensten Genres über an eine möglichst große Zielgruppe gerichtete Gebrauchsliteratur und/oder Sachbücher zu populären Themen. Die Auflagen sind relativ hoch, die Preise relativ niedrig. Von den knapp 1800 im Börsenverein des Deutschen Buchhandels organisierten Verlagen zählen etwa 500 zu dieser Gruppe, die sich zum Teil in der Interessengruppe Belletristik und Sachbuch (vorher Arbeitsgemeinschaft Publikumsverlage) zusammengeschlossen haben.
Fachverlage sind Unternehmen, die sich ausschließlich oder weitgehend auf Fachbücher (und Fachzeitschriften) spezialisiert haben. Sie sind stark auf berufsspezifische Themen ausgerichtet. Ihre Produkte haben hohen berufspraktischen Nutzen, dienen der Aus- und Weiterbildung und sind in der Regel in einer berufs- und themenspezifischen Fachsprache verfasst. Die Auflagenzahlen differieren stark und schwanken zwischen Spezialpublikationen und Longsellern. Die Ladenpreise liegen im mittleren bis hohen Bereich.
Wissenschaftsverlage sind Unternehmen, die sich ausschließlich oder weitgehend auf wissenschaftliche Werke für die interne Fachkommunikation spezialisiert haben. Dazu gehören neben Büchern auch wissenschaftliche Fachorgane. Die Auflagen sind in der Regel niedrig bis sehr niedrig, die Ladenpreise hoch bis sehr hoch, vor allem bei den Zeitschriften.
Nach der jährlich veröffentlichten Branchenstatistik Buch und Buchhandel in Zahlen, herausgegeben vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels, gab es im Jahr 2017 in Deutschland rund 14.200 Verlage, wenn man darunter auch alle Institutionen, Gebietskörperschaften, Einrichtungen, Vereine et cetera subsumiert, die als Verlag tätig geworden sind und sei es auch nur mit einer einzigen Publikation wie etwa einer Festschrift zum Gründungsjubiläum einer Volkshochschule oder eines Vereins.
Deutlich kleiner ist die Zahl der Verlage, wenn man der Definition des Statistischen Bundesamts folgt, die die Bestimmung einer Organisation als Verlag an die Umsatzgröße bindet. Ab dem relativ niedrigen Jahresumsatz von 17.500 Euro (ohne Mehrwertsteuer) führen die offiziellen Statistiker einen Verlag als Verlag. Im Jahr 2016 gab es nach dieser Messgröße in Deutschland 2.209 Verlage. Die Umsatzgröße lässt die Annahme einer relativ regelmäßigen Geschäftstätigkeit zu.
Das ist auf jeden Fall bei den 1644 Verlagen der Fall, die Buch und Buchhandel in Zahlen als Zahl der Mitglieder des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels für 2017 nennt. Allein die Tatsache der relativ hohen Mitgliedsbeiträge lässt begründet vermuten, dass es sich bei den Verlagsmitgliedern des Börsenvereins um aktive Unternehmen handelt.
Ende 2017 waren neben dem herstellenden Buchhandel (Verlage) 67 Unternehmen des Zwischenbuchhandels sowie 2844 Unternehmen des verbreitenden Buchhandels Mitglied im Börsenverein. Durch den Konzentrationsprozess und den Strukturwandel – vor allem im Sortimentsbuchhandel – sind die Mitgliederzahlen des Börsenvereins seit 1998 rückläufig.
Wie der Name sagt, steht der Zwischenbuchhandel zwischen den Produzenten von Büchern, anderen Medien sowie Non-Books und dem Bucheinzelhandel. Er beliefert den Bucheinzelhandel und betreibt damit ein Business-to-Business-Geschäft (B2B). Zu dieser Handelsstufe zählen Barsortimente, Großantiquare, Pressegrossisten und Regalgroßhändler (Rack-Jobber) sowie Bestellanstalten, Bücherwagendienste und Verlagsauslieferungen.
Eine große Herausforderung für die Zukunft des Zwischenbuchhandels wird wie in den zurückliegenden Jahren die weitere Branchenrationalisierung sein, also die Beschleunigung und Verbesserung des buchhändlerischen Verkehrs. Zudem muss sich zeigen, wie die Branche mit der Entwicklung umgeht, dass die ursprünglich getrennten Bereiche Verlagsauslieferung und Barsortiment zunehmend unter einem Dach vereinigt sind (vergleiche Bez 2018).
Info
Über Geschichte und Gegenwart des Zwischenbuchhandels informiert Bez/Keiderling 2010. Die Fachbegriffe dieser Handelsstufe finden sich im ABC des Zwischenbuchhandels, das von der Website des Börsenvereins heruntergeladen werden kann.
Der Bucheinzelhandel stellt die Schnittstelle zum Endabnehmer dar und betreibt damit ein Business-to-Customer-Geschäft (B2C). Auf dieser Handelsstufe sind als Betriebsformen der Sortimentsbuchhandel, der Warenhausbuchhandel, der Reisebuchhandel und der Versandbuchhandel einschließlich des Internetbuchhandels zu unterscheiden.
Trotz aller rückläufigen Mitgliederzahlen des Börsenvereins ist der Buchhandel in Deutschland hoch entwickelt und leistungsfähig. In kaum einem anderen Land der Welt existiert ein derart dichtes Netz gut sortierter Buchgeschäfte, die zigtausend Titel vorrätig halten und jedes andere Buch über einen optimal organisierten Zwischenbuchhandel binnen 24 Stunden beschaffen. Wer einmal die Verhältnisse etwa in den USA beobachtet hat, wo man häufig viele Meilen reisen muss, um einen Buchladen zu finden, der sich dann als Drugstore-Nische mit den gängigen Taschenbüchern entpuppt, vermag abzuschätzen, was der Buchhandel hierzulande für die Verlage – und für die Leser – bedeutet.
In diesem Zusammenhang ist auf die Bedeutung des gebundenen Ladenpreises hinzuweisen (siehe 3.1). Danach müssen neue Bücher von Flensburg bis Garmisch-Partenkirchen sowie von Aachen bis Görlitz einheitlich den vom Verlag festgelegten Ladenpreis kosten. Es gab und gibt immer wieder Stimmen – zumeist von Branchenfremden –, die unter Hinweis auf die Gesetze der freien Marktwirtschaft auch für das Buch die Aufhebung der Preisbindung fordern und die sich davon dann günstigere Ladenpreise versprechen.
Wahrscheinlich würden bei Aufhebung des gebundenen Ladenpreises große Buchhandelsketten durch Großeinkauf und entsprechend höheren Rabatt günstiger kalkulieren und die Spitzenseller zu entsprechend niedrigeren Ladenpreisen anbieten können. Das würde vermutlich langfristig eine Abnahme des Angebots, nicht nur in quantitativer, sondern auch in qualitativer Hinsicht bedeuten.
Die teilweise heftig geführte Diskussion um die Aufhebung des gebundenen Ladenpreises, die allerdings nicht durch empirische Daten unterfüttert, sondern durch Interessenvertreter einerseits und Marktwirtschaftsideologen andererseits geprägt war, ist durch das Preisbindungsgesetz von 2002 (novelliert 2006) weitgehend zum Erliegen gekommen, wenngleich es noch immer vereinzelt Vorstöße in diese Richtung gibt.
Für den stationären Bucheinzelhandel wird es in Zukunft noch stärker darauf ankommen, das Warenangebot noch kundenorientierter zu gestalten und in den Ladengeschäften mehr Aufenthaltsqualität zu entwickeln. Ferner müssen alle angebotenen Dienstleistungen auch online funktionieren (vergleiche Riethmüller 2018).
Info
Umfassend zum Sortimentsbuchhandel Bramann/Cremer 2014.
Alle drei Sparten, die Verlage, der Zwischenbuchhandel und der Buchhandel, sind unter dem Dach des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels vereint – eine Form der Standesorganisation und Interessenvertretung, die weltweit einmalig ist. Der Börsenverein setzt sich nach eigenen Worten für wirtschaftlich und politisch optimale Rahmenbedingungen im Sinne seiner Mitglieder ein. Dazu gehören insbesondere die Mittelstandsförderung, die Erhaltung der Buchpreisbindung und ein faires Urheberrecht. Er veranstaltet die Frankfurter Buchmesse, verleiht den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und engagiert sich in der Leseförderung. Die Leipziger Buchmesse wird von einer eigenen Gesellschaft veranstaltet.
Die Mitgliederzahlen des Börsenvereins sind rückläufig, besonders stark bei den Buchhandlungen, wo die Zahl in zehn Jahren von 2009 bis 2018 von 3892 auf 2736 zurückging, was einem Minus von fast 30 Prozent entspricht. Weniger stark war der Rückgang bei den Verlagen. Hier sank die Zahl im genannten Zeitraum von 1774 auf 1606 Verlage, ein Minus von knapp zehn Prozent.