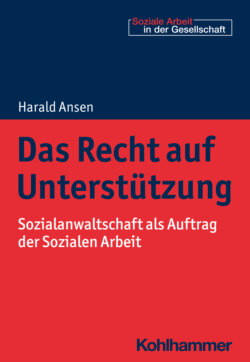Читать книгу Das Recht auf Unterstützung - Harald Ansen - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Relative Armut
ОглавлениеDie relative Armut wird am Lebensstandard der jeweiligen Bezugsgesellschaft gemessen. In diesem Fall reicht die vorhandene Ausstattung nicht mehr aus, eine als gerade noch ausreichend angesehene soziokulturelle Teilhabe zu realisieren (vgl. ebd., 152). An diese Sichtweise schließt die europäische Sozialberichterstattung an. Dort geht man von einer relativen Armut aus, wenn Menschen über so geringe soziale, materielle und kulturelle Mittel verfügen, dass sie von einer gerade noch akzeptablen Lebensweise ihrer Bezugsgesellschaft ausgeschlossen sind (vgl. Datenreport 2021, 224). Relative Armut wird in der Marktgesellschaft am verfügbaren Haushaltsnettoeinkommen gemessen. Liegt ein Haushalt unter 60 Prozent des nach Haushaltsgrößen gewichteten Medianeinkommens, gilt er als relativ arm. Von strenger Armut ist die Rede, wenn das Einkommen unter 50 Prozent des Medianeinkommens liegt.
Bezogen auf die jüngsten vorliegenden Daten lag das Medianeinkommen pro Kopf im Jahr 2018 monatlich bei rund 1.892 EUR (vgl. ebd., 223). Die 60-Prozent-Armutsgrenze liegt demnach bei 1.135 EUR, die 50-Prozent-Armutsgrenze bei 946 EUR. Die in der Armutsforschung breit rezipierte relative Armutsgrenze ist allerdings problematisch. Es wird beispielsweise nicht berücksichtigt, dass Menschen lebenslagebedingt und in Bezug auf gesundheitliche Beeinträchtigungen unterschiedliche Bedürfnisse haben (vgl. Hauser 2018, 156). Hinzu kommt, dass Schuldentilgungen, die in armutsgeprägten Lebenslagen häufiger vorkommen, in der Berechnung der Armutsgrenze nicht berücksichtigt werden. Auch wer wenige Prozentpunkte über der Armutsgrenze liegt, lebt nicht im Wohlstand, sondern allenfalls in prekären Verhältnissen. Unterstellt wird schließlich, dass das Haushaltseinkommen proportional verteilt wird, was keineswegs sichergestellt ist.
Auch wenn absolute Armut in Deutschland quantitativ eine periphere Rolle spielt und relative Armut dominiert, muss die Soziale Arbeit mit beiden Formen in ihrem Arbeitsalltag umgehen, zumal teilweise fließende Übergänge bestehen. Neben der Sicherung der Existenzgrundlagen geht es in der Unterstützung für Menschen in armutsgeprägten Lebensumständen insbesondere um die Förderung ihrer Teilhabe an den Errungenschaften der Gesellschaft. Für die Soziale Arbeit im Umgang mit Armut, die in vielen Bereichen wie der Suchtkrankenhilfe, der Sozialpsychiatrie, dem Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) oder der Migrationssozialarbeit anzutreffen ist, sind Kenntnisse über Grundsicherungs- und Sozialhilfeleistungen unabdingbar, die im SGB II und SGB XII sowie in angrenzenden Sozialleistungsgesetzen geregelt sind. Im System der sozialen Sicherung repräsentieren diese Leistungen ein soziokulturelles Minimum, das gewissermaßen die absolute und die relative Armut vereint. Wer nicht über eigene Mittel, ausreichende Eigenkräfte und/oder einen anderweitigen Anspruch auf Unterstützung, sei es durch Unterhaltsansprüche oder vorrangige Sozialleistungen, verfügt, hat nach dem gegenwärtigen Stand einen Rechtsanspruch auf subsidiär angelegte bedürftigkeitsgeprüfte Grundsicherungs- und Sozialhilfeleistungen. Diese dienen dazu, allen Betroffenen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen, das über die reine Existenzerhaltung hinausgeht und in dem mit den Leistungen ein Mindestmaß an gesellschaftlicher, kultureller und politischer Teilhabe sichergestellt werden soll (vgl. Bieritz-Harder 2019, 104).