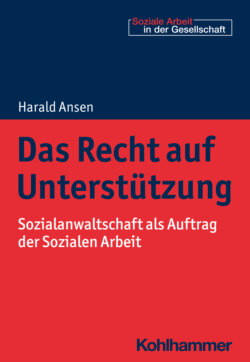Читать книгу Das Recht auf Unterstützung - Harald Ansen - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Barrieren im Sozial-, Bildungs- und Gesundheitswesen
ОглавлениеZu den Barrieren zählen institutionelle und bürokratische Anforderungen, die teilweise überfordernd sind, fehlende Informationen über infrage kommende Varianten der Unterstützung, die Angst vor Stigmatisierung bei der Inanspruchnahme sozialstaatlicher Leistungen, kulturelle Blockaden, vor allem bei denjenigen, die mit der Behördenkultur in Deutschland nicht vertraut sind, und subjektive Faktoren persönlicher Verunsicherung sowie Resignation im Umgang mit den eigenen Problemen (vgl. Papenheim et al. 2018, 217).
Wer in seinem persönlichen sozialen Netzwerk keine Unterstützung für den Rückgriff auf Angebote des Sozialstaats erhält, ist vermehrt auf eine zugängliche und leicht erreichbare Organisation der sozialen Infrastruktur angewiesen und nicht auf einen defensiven Sozialstaat, der ausgeprägte Konfliktfähigkeit in der Beantragung von Sozialleistungen voraussetzt. Das Recht auf Unterstützung überschreitet an dieser Stelle die direkte Fallarbeit, es geht darum, Einfluss auf die Gestaltung der sozialen Infrastruktur zu nehmen. Dies beinhaltet die Gestaltung des Sozialraums und die Vermeidung sozialräumlicher Ausgrenzungen im Sinne einer »residenziellen Segregation« (Keller 2019, 261). Es ist nicht immer ein ganzer Stadtteil, der Ausgrenzungen verkörpert, vielfach sind es Straßen, Straßenzüge oder auch Wohnblocks, in denen vermehrt Armutshaushalte angesiedelt sind (vgl. ebd., 261f.). Für den Umgang mit sozialräumlichen Segregationsprozessen reicht es nicht aus, nur auf bauliche Maßnahmen zu setzen, schließlich geht es darum, das soziale Miteinander im Sinne der gesellschaftlichen Kohärenz zu fördern. Ein sozialräumlicher Ansatz, der hier gefordert ist, impliziert, dass der Raum durch soziales Handeln angeeignet wird. Erst wenn das subjektive Raumerleben einbezogen wird, wenn Menschen Möglichkeiten der Beteiligung vorfinden, denen sie gewachsen sind, wenn ihre Alltagsorganisation, ihre Bedürfnisse und ihre sozialen Bezüge mit sozialpolitischen Maßnahmen in eine Balance gebracht werden, ist es möglich, die negativen Wirkungen sozialräumlicher Ausgrenzungen zu stoppen und eine soziale Infrastruktur aufzubauen, die Lernchancen, Verständnis füreinander und ein unterstützendes Zusammenleben voranbringen (vgl. Alisch 2018, 513f.).
Menschen auf ihre Eigenverantwortung zu verweisen und ihnen Aktivierung und Selbstsorge sowie Vorsorge zuzuschreiben, setzt entsprechende Lern- und Entwicklungsbedingungen voraus. Armut mit den belastenden Auswirkungen auf die soziale Sicherheit und die soziale Unterstützung konterkariert diese heute verbreitete gesellschaftliche und sozialstaatliche Erwartung. Durch Armut werden die Entfaltungsspielräume und die Teilhabechancen der Betroffenen begrenzt, sie bleiben unterhalb ihrer Möglichkeiten (vgl. Best, Boeck & Huster 2018, 53). Zur Analyse von Armut gehört aus Sicht der Sozialen Arbeit deshalb die Betrachtung der Handlungskompetenzen der Betroffenen, verbunden mit den Fragen, welche Beeinträchtigungen vor allem zu beachten sind und wie im Recht auf Unterstützung eine Förderung der Handlungskompetenzen vorstellbar ist.
In der Armutsforschung ist es heute mit Blick auf den Capability Approach fast ein Gemeinplatz zu sagen, dass Armut die Verwirklichungschancen von Menschen begrenzt. Dies belegen bereits alltägliche Beobachtungen hinsichtlich der körperlichen, sozialen, materiellen und psychischen Folgen, die vielfach mit Wohnungslosigkeit einhergehen. Capabilities stehen für die Bedingungen und Möglichkeiten, die es erlauben, persönliche, soziale, körperliche und gesundheitliche Potenziale zu entfalten und das eigene Wohlergehen in einem Leben zu verwirklichen, das man aus guten Gründen wählt. Armut stellt für die Betroffenen eine »capability deprivation« (Lepenies 2017, 107) dar. Die Ausführungen über soziale Sicherheit und soziale Unterstützung liefern dafür hinreichende Belege. Die Lebensbedingungen im Recht auf Unterstützung zu verankern und durch der Sozialen Arbeit zu verbessern, hat insofern unmittelbare Auswirkungen auf die Entfaltung persönlicher Handlungskompetenzen.
Armut und soziale Ausgrenzung, das darf nicht übersehen werden, machen Betroffene sozial verwundbar. Prekäre oder fehlende Formen der Beschäftigung, die Unterversorgung in zentralen Lebensbereichen, die Blockierung im Erwerb unterschiedlicher Kompetenzen, die Beeinträchtigung von Zukunftsoptionen und die mit erheblichen Belastungen verbundene Alltagsorganisation führen zu sozialer Erschöpfung und sozialem Rückzug (vgl. Lutz 2014, 115f.). Betroffene erleben sich abgehängt von gesellschaftlichen Versprechungen, wonach allen Menschen Räume offenstehen, ihre Bedürfnisse zu befriedigen und ihre Potenziale zu entfalten. Sie sehen sich stattdessen mit Ausgrenzungen, Enttäuschungen und Überforderungen konfrontiert, die sie zuweilen verzweifeln lassen und auf Distanz zur Gesellschaft bringen (vgl. Reckwitz 2019, 206f.). Auf der Grundlage einer Metaanalyse zahlreicher international angelegter Studien beschreiben Wilkinson und Pickett die Auswirkungen von Armut und sozialer Ungleichheit sehr treffend in der folgenden Zusammenfassung:
»The problems related to social position, like poor health, violence and low educational performance, which all become common at each step down the social ladder, also get worse in societies with wider income gaps« (Wilkinson & Pickett 2018, 23).
Die ausgeführten negativen Auswirkungen von Armut treten gehäuft, aber nicht in allen Fällen auf, insoweit sollten die personalen Belastungen nicht als zwangsläufige Folge angesehen werden. Für die Suche nach Auswegen aus armutsgeprägten Lebensumständen lohnt es, Erkenntnisse der Resilienzforschung im Umgang mit Armut zur Kenntnis zu nehmen.