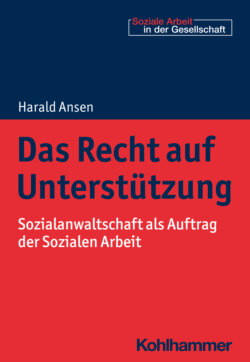Читать книгу Das Recht auf Unterstützung - Harald Ansen - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Unterstützungsrecht und Demokratie
ОглавлениеAuf die große Bedeutung von Unterstützungsrechten für den Erhalt der Demokratie hat u. a. Crouch in seinem viel beachteten Essay über »Postdemokratie« (2020) hingewiesen. Je weiter der Staat Fürsorgerechte abbaut, so eine zentrale Annahme, desto größer ist die Gefahr, dass sich auf Unterstützung angewiesene Menschen vom Staat zurückziehen, beispielsweise indem sie ihr Wahlrecht nicht mehr wahrnehmen, weil aus ihrer Sicht ohnehin nur die Eliten den Ton im Staat angeben. Dieses Risiko nimmt in dem Maß zu, in dem sozialstaatliche Leistungen immer mehr auf elementare Hilfen reduziert werden und staatsbürgerliche Teilhaberechte auf der Strecke bleiben (vgl. Crouch 2020, 30f.). Das Recht auf Unterstützung sollte schon aus Gründen der Demokratieförderung breiter angelegt sein.
Die zentralen Funktionen des Sozialstaates im Sinne des in Artikel 20 Grundgesetz verankerten Sozialstaatsprinzips bestehen bei aller Offenheit in der Detailgestaltung darin, die individuelle Existenz der Bürger:-innen zu sichern, ihre sozialen Teilhabechancen und den Zusammenhalt der Gesellschaft zu fördern (vgl. Lessenich 2012, 25). Dieses Sozialstaatsverständnis wird sozialrechtlich in § 1 SGB I konkretisiert. Dort heißt es programmatisch:
»(1) Das Recht des Sozialgesetzbuchs soll zur Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit Sozialleistungen einschließlich sozialer und erzieherischer Hilfen gestalten. Es soll dazu beitragen,
• ein menschenwürdiges Dasein zu sichern,
• gleiche Voraussetzungen für die freie Entfaltung der Persönlichkeit, insbesondere auch für jungen Menschen zu schaffen,
• die Familie zu schützen und zu fördern,
• den Erwerb des Lebensunterhalts durch eine frei gewählte Tätigkeit zu fördern und
• besondere Belastungen des Lebens, auch durch Hilfe zur Selbsthilfe, abzuwenden oder auszugleichen.
(2) Das Recht des Sozialgesetzbuchs soll auch dazu beitragen, dass die zur Erfüllung der in Absatz 1 genannten Aufgaben erforderlichen sozialen Dienste und Einrichtungen rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen.«
Die Umsetzung dieses anspruchsvollen sozialpolitischen Programms erfordert unterschiedliche sozialpolitische Interventionen, in denen auch die Soziale Arbeit einen festen Platz hat:
1. Rechtliche Interventionsform
Hierbei geht es um Schutzrechte wie beispielsweise den Mieter:innen- oder den Pfändungsschutz sowie um Anspruchsrechte auf unterschiedliche Sozialleistungen. Entscheidend ist, den rechtlichen Status der Bürger:innen zu verbessern, die nicht Bittsteller:innen, sondern Leistungsberechtigte sind. Um Rechte wahrnehmen zu können, ist ein Rechtsbewusstsein ebenso erforderlich wie der Ausgleich von Machtunterschieden in der Durchsetzung rechtlicher Positionen (vgl. Kaufmann 2009, 90f.).
2. Ökonomische Interventionsform
Die Verbesserung der materiellen Lebenslage steht im Mittelpunkt dieser Interventionsform. Erst eine ausreichende Ressourcenausstattung ermöglicht soziale Teilhabe in einer Marktgesellschaft. Zu fragen ist nach der Höhe und Ausgestaltung der Leistungen und ihrer sozialadministrativen Erbringung. Je klarer die Leistungen und je einfacher der Weg zur Realisierung, desto höher ist die Chance, dass diese auch bei den Berechtigten ankommen (vgl. ebd., 92f.).
3. Ökologische Interventionsform
Die Gestaltung des Lebensraums auch durch die Etablierung sozialer Dienste und Einrichtungen zählt zur Daseinsvorsorge. Erst wenn die soziale Infrastruktur auch hinreichend zugänglich ist, erfüllt sie ihre Funktion der Förderung sozialer Teilhabe und der Verbesserung der Lebenslage. Für die Inanspruchnahme bzw. für Barrieren der Inanspruchnahme sind anerkannte Punkte, die einen Zugang garantieren, individuelle Handlungsfähigkeiten, Wissen um Angebote, subjektiver Leidensdruck, die Zugangsbedingungen und die Qualität der Interaktion im Hilfeprozess ausschlaggebend (vgl. ebd., 96f.).
4. Pädagogische Interventionsform
Die Steigerung der Handlungsfähigkeiten und der Handlungsmotivation prägt pädagogische Interventionen, die der Umsetzung eines Selbsthilfeanspruchs dienen. Im weiteren Sinn geht es um die Förderung sozialer Kompetenzen in sozialen Lernprozessen (vgl. ebd., 101f.).
Soweit Probleme standardisiert und mit generalisierten Angeboten gelöst werden können, dominieren einzelfallübergreifende gesetzliche Maßnahmen. Immer dann, wenn stärker auf den Einzelfall einzugehen ist, kommt die Soziale Arbeit als integraler Bestandteil der sozialen Interventionen ins Spiel. Die Durchsetzung von Rechtsansprüchen (rechtliche Interventionsform) erfordert teilweise individuelle Wissensvermittlung und die Förderung der Motivation der Ratsuchenden oder auch sozialarbeiterische Antragsbegründungen und Gutachten, die für Ermessensentscheidungen grundlegend sein können. Hinsichtlich der ökonomischen Interventionsform geht es sozialarbeiterisch im weiteren Sinn um die Erschließung und Organisation alltagsrelevanter Ressourcen. In der ökologischen Interventionsform geht es um Beiträge der Sozialen Arbeit zur Sozialplanung und um unterschiedliche Varianten der Gemeinwesenarbeit. In Bezug auf die pädagogische Interventionsform ist beispielsweise die soziale Beratung geeignet, Wissen und Kompetenzen zu vermitteln und Ratsuchende ganz konkret im Umgang mit rechtlichen, ökonomischen und ökologischen Aspekten ihrer Lebenslage zu unterstützen (vgl. Kaufmann 2012, 1298f.).
Das im Sozialrecht zum Ausdruck kommende Sozialstaatsverständnis, unter dessen Dach das Recht auf Unterstützung auch durch die Soziale Arbeit verwirklicht wird, ist recht elastisch, auch wenn dies in der Realität nicht immer zum Ausdruck kommt. Zu fragen ist, ob Verbesserungen der sozialstaatlichen Praxis jenseits grundlegend neuer Strukturen möglich sind, die gegenwärtig nicht auf der Tagesordnung stehen. Der Bedarf, die Praxis des Sozialstaats zu verbessern, ist sowohl empirisch als auch sozialethisch begründet.
Zunächst zur empirischen Lage: Die Zufriedenheit mit der öffentlichen Verwaltung bzw. der Bürokratie ist nach aktuellen Daten einer repräsentativen Zufallsstichprobe unterschiedlich verteilt. In der Gesamttendenz besteht große Zufriedenheit mit der Interaktion zwischen Bürger:innen und den Behörden. Die Zufriedenheitswerte von Menschen in benachteiligten Lebenslagen, geprägt von Erwerbslosigkeit, Altersarmut und finanziellen Problemen, sind allerdings deutlich geringer. Auf einer Skala von -2 bis +2 rangieren sie zwischen 0,7 und 0,8 (vgl. Datenreport 2021, 395). Die im Vergleich nach unten abweichenden Werte bei diesen Bevölkerungsgruppen hängen eng mit der Verständlichkeit von Formularen und Anträgen, zu langen Warte- und Bearbeitungszeiten, unzureichenden Informationen, nicht verständlichen Ablehnungsbescheiden und einem als unfreundlich und wenig kompetent erlebten Personal zusammen (vgl. ebd., 396f.). Die für die tendenziell negative Bewertung ausschlaggebenden Faktoren können ohne einen Systemumbau durch eine Überprüfung der gesetzlichen Regelungen hinsichtlich ihrer Unübersichtlichkeit und Komplexität sowie durch eine Reorganisation der Verwaltungsabläufe, die vor Willkür schützen sollen und die sich gegenüber den auf Unterstützung angewiesenen Menschen zu legitimieren haben und nicht umgekehrt, überwunden werden.
Wenn Menschen sich im Umgang mit der Bürokratie schlecht behandelt, zuweilen herabgesetzt fühlen, verweist dies auf Entwicklungen, die auch sozialethisch anstößig sind. Eine Demütigung hängt mit Verhaltensweisen und/oder Verhältnissen zusammen, die Menschen einen rationalen Grund geben, sich in ihrer Selbstachtung verletzt zu sehen (vgl. Margalit 1999, 23). Übertragen auf den Sozialstaat und seine Bürokratie stehen potenziell demütigende Elemente bei einer nicht ausreichenden Würdigung des Einzelfalls, einer Behandlung der Leistungsberechtigen als Nummer und nicht als Subjekt, der Unterstellung, dass sie Leistungen zu Unrecht beantragen und nur zu faul sind, für sich selbst zu sorgen, oder auch einer paternalistischen Bevormundung in der Sachbearbeitung im Raum. Überdies kann auch dann von einer Demütigung gesprochen werden, wenn erniedrigende Lebensverhältnisse nicht mit den Mitteln des Sozialstaats überwunden werden oder wenn Rechtsansprüche auf Leistungen immer weiter reduziert werden (vgl. ebd., 256f.). Liest man diese Kriterien unter der Vorgabe, wie sich Demütigungen im Sozialstaat vermeiden lassen, folgen daraus Anforderungen, wonach
• der Einzelfall in der Leistungsbearbeitung explizit zu würdigen ist,
• der unbegründete Verdacht auf Leistungsmissbrauch zu unterlassen ist,
• Menschen an Entscheidungen über ihre Anträge zu beteiligen sind,
• der Wille erkennbar wird, die benachteiligenden Lebensumstände zu überwinden, und
• ausreichende Rechtsgrundlagen zu schaffen sind, die dazu beitragen, das Risiko willkürlicher Entscheidungen zu vermeiden.
Darüberhinausgehend sind aus ethischer Sicht für die Erbringung von Sozialleistungen auch Anregungen von Immanuel Kant aktuell bedeutsam. Kants Überlegungen zur Würde des Menschen, ausgeführt in »Die Metaphysik der Sitten« (1797) im Kapitel über die Tugendpflichten gegen andere, werden noch heute für die Interpretation von Artikel 1 des Grundgesetzes herangezogen. Danach ist die Würde eines Menschen über jeden Preis erhaben, sie hat keine materielle oder finanzielle Entsprechung. Die Würde eines Menschen impliziert die Aufforderung, ihn zu keiner Zeit als Mittel zum Zweck zu gebrauchen, der Mensch ist immer Zweck seiner selbst, völlig unabhängig davon, was er (nicht) geleistet hat (vgl. Kant 2001, 354f.). Vor diesem Hintergrund heißt es bei Kant über den Umgang mit von Armut belasteten Menschen:
»So werden wir gegen einen Armen wohltätig zu sein, uns für verpflichtet erkennen; aber weil diese Gunst doch auch Abhängigkeit seines Wohls von meiner Großmut enthält, die doch den anderen erniedrigt, so ist es Pflicht, dem Empfänger durch ein Betragen, welches diese Wohltätigkeit entweder als bloße Schuldigkeit oder geringen Liebesdienst vorstellt, die Demütigung zu ersparen und ihm seine Achtung für sich selber zu erhalten« (ebd., 336f.).
Leistungsberechtigten im System der sozialen Sicherung mit Achtung zu begegnen und ihnen eine auch ungewollte Demütigung zu ersparen beinhaltet, jede Form der Verdinglichung und damit der Beeinträchtigung ihrer Selbstbestimmung zu vermeiden. Martha Nussbaum hat, u. a. auf Kant zurückgreifend, Dimensionen der Verdinglichung konkretisiert, die ebenfalls handlungsleitend im Prozess der Erbringung von Sozialleistungen für die Leistungsträger und die Leistungserbringer sein sollten. In einer nicht abgeschlossenen Liste führt sie aus, wann es zu einer Verdinglichung kommt.
1. Instrumentalisierung
Menschen werden als Zwecke von anderen behandelt, um eigene Ziele zu erreichen.
2. Leugnung der Autonomie
Menschen werden so behandelt, als hätten sie keine Fähigkeit zu Autonomie und Selbstbestimmung
3. Trägheit
Menschen wird unterstellt, dass sie keinen Antrieb und keine Handlungsfähigkeit besitzen, ihnen wird Passivität unterstellt.
4. Austauschbarkeit
Menschen werden nicht in ihrer Individualität erkannt, sie sind für andere nur austauschbare Typen.
5. Verletzbarkeit
Die Grenzen von Menschen werden in diesem Fall missachtet, man begegnet ihnen nicht mit Respekt.
6. Besitzverhältnis
Ein Mensch wird behandelt, als würde er einem anderen gehören.
7. Leugnung der Subjektivität
Das Erleben und Fühlen eines Menschen wird missachtet, es spielt im Umgang keine Rolle (vgl. Nussbaum 2002, 102).
Die Kriterien der Verdinglichungsrisiken im Blick zu behalten trägt dazu bei, die Würde eines Menschen, der auf Unterstützung angewiesen ist, zu achten. Für Sozialarbeiter:innen und andere Fachkräfte im sozialen Sicherungssystem können diese Überlegungen ein Kompass für die Gestaltung des Umgangs mit anderen Menschen sein. Für Nussbaum sind sämtliche Kriterien relevant, wobei sie die Leugnung der Autonomie und der Subjektivität in ihrer Bedeutung für die Vermeidung einer Verdinglichung besonders hervorhebt (vgl. ebd., 104). Menschen in armutsgeprägten Lebenslagen sind leichter als andere anfällig dafür, von Fachkräften schlecht behandelt zu werden, umso wichtiger ist ein sensibler Umgang, getragen von dem Anspruch, die Würde des und der Anderen nicht zu verletzen.
Ausgewählte Studien zeigen, dass diese Forderungen keineswegs abstrakt sind, sondern von unmittelbarer praktischer Bedeutung. In einer international angelegten Studie wurde der Frage nachgegangen, wie Stigmatisierung und Scham bei der Erbringung von Sozialleistungen vermieden werden können. Nach dem Ergebnis eines Vergleichs von sozialen Sicherungssystemen in Indien, Nordamerika, Norwegen, Uganda und China setzt dies drei Bedingungen voraus, die im deutschen System der sozialen Sicherung, zumal der Grundsicherung, ohne Weiteres realisiert werden können:
• Erstens ist eine Rechtsperspektive geboten, in der Leistungsansprüche geregelt sind, die willkürliche Entscheidungen vermeiden helfen. Dadurch wird die Selbstachtung der Leistungsberechtigten gefördert.
• Zweitens sind Ermessensspielräume für die Würdigung individueller Lebenslagen erforderlich, die es den Professionellen in der Sozialadministration erlauben, auf individuelle Bedarfe einzugehen und nicht nur schematisch zu verfahren.
• Drittens ist eine Verhandlungsorientierung weiterführend, in der eine Interaktion zwischen Leistungsberechtigten und den Mitarbeiter:innen der Verwaltung eine zentrale Rolle spielt. Leistungsberechtigte werden als Expert:innen ihres Lebens wahrgenommen, ihre Stimme zählt in der Ausgestaltung der Sozialleistung (vgl. Gubrium & Pellisery 2016, 7f.).
Diese drei Schritte könnten sofort im System der sozialen (Grund-)Sicherung umgesetzt werden, sie setzen eine entsprechende Haltung und Professionalität im Umgang mit der Sozialgesetzgebung voraus, in der Spielräume für diese Vorgehensweisen bereits heute bestehen. Auch für die Begleitung von Leistungsberechtigten durch Fachkräfte der Sozialen Arbeit böte eine solche Qualität der Erbringung von Sozialleistungen Vorteile, denn in der Rechtsanwendung erhielten soziale Argumente ein höheres Gewicht. Es käme seltener zu Konflikten, die Folgen bis hin zu Sozialgerichtsverfahren nach sich ziehen. Am wichtigsten ist jedoch, dass Leistungsberechtigte unter diesen Voraussetzungen am ehesten zur Mitwirkung motiviert werden und sich in den einzelnen Maßnahmen mit ihren Ideen und Vorstellungen wiederfinden.
Für einen teilhabeförderlichen und menschenwürdigen Umgang mit von Armut betroffenen Menschen sind auch die Forschungsergebnisse der jüngst mit dem Nobelpreis für Ökonomie geehrten Ökonomen Abhijit V. Banerjee und Esther Duflo weiterführend. Um Desillusionierungen zu überwinden und negative gesellschaftliche und politische Implikationen von Armut zu vermeiden, sind aus ihrer Sicht fünf Aspekte bedeutsam:
• Erstens geht es in Öffentlichkeitskampagnen darum, Informationen über Unterstützungsangebote angemessen zu vermitteln und falsche Informationen zu korrigieren.
• Zweitens sollten Anforderungen vermieden werden, die weit über den aktuellen Horizont der von Armut betroffenen Menschen hinausweisen; stattdessen geht es um Anstöße und Formen der Unterstützung, die eine unmittelbare Entlastung im Alltag darstellen, beispielsweise Zugänge zu Sozialleistungen oder die Verbesserung der Arbeits- und Wohnsituation.
• Drittens sind Marktzugänge zu unterschiedlichen Leistungen ungleich verteilt. Dort, wo der Markt versagt, sind staatliche Regulierungen erforderlich, etwa in den Bereichen Miete, Kreditzugänge oder ärztliche Versorgung.
• Viertens werden armutsüberwindende Maßnahmen in ihrer Wirksamkeit verbessert, wenn sie an die Lebenswirklichkeit der Menschen anschließen und mit den Adressat:innen abgestimmt werden, um ideologische Verzerrungen, Unwissenheit und Trägheit beizukommen.
• Schließlich wird fünftens aus unterschiedlichen Forschungsbefunden abgeleitet, dass es darauf ankommt, die Amtsführung zu verbessern, Regelungen und Gesetze einzuhalten und negative Klischeevorstellungen über auf Unterstützung angewiesene Menschen zu überwinden (vgl. Banerjee & Duflo 2012, 346f.).
Die Umsetzung dieser als zentral erachteten Punkte setzt eine Haltung voraus, die folgendermaßen charakterisiert wird:
»Wenn wir das träge, schematische Denken aufgeben, das jedes Problem auf die gleichen allgemeinen Prinzipien reduziert, wenn wir den Armen richtig zuhören und uns bemühen, die Logik ihrer Entscheidungen zu verstehen, wenn wir akzeptieren, dass wir uns irren können, und jede scheinbar noch so vernünftige Idee strengen empirischen Tests unterziehen, dann werden wir nicht nur in der Lage sein, effektive Maßnahmen zu entwickeln, sondern auch besser verstehen, warum die Armen so leben, wie sie leben« (ebd., 351f.).
Die referierten programmatischen Überlegungen eines die Rechte des und der Einzelnen achtenden Sozialstaats sind in den etablierten bürokratischen Strukturen grundsätzlich umsetzbar. Entgegen der verbreiteten Sicht einer ineffizienten und abzubauenden Bürokratie ist auf deren unverzichtbare Rolle in der Daseinsvorsorge und der Daseinsnachsorge sowie für die Sicherung der Demokratie hinzuweisen.
»Es ist die bürokratische Verwaltung, die eine flächendeckende Versorgung mit öffentlichen Gütern und insbesondere die Daseinsvorsorge garantiert. Zugleich verbindet sie diese abstrakte Sozial- und Wohlfahrtsstruktur mit der konkreten Prüfung jedes individuellen Einzelfalls, um die freie und gleiche Entfaltung aller Bürgerinnen und Bürger in der der Bundesrepublik zu gewährleisten« (Kersten, Neu & Vogel 2020, 27).
In der Auseinandersetzung mit dem Recht auf Unterstützung geht es also nicht darum, Bürokratie zu bekämpfen oder als Gegnerin zu betrachten, das machen schon diejenigen, die sie immer weiter kommerzialisieren und privatisieren, sondern ganz im Gegenteil um die Erhaltung bürokratisch berechenbarer Strukturen, in denen Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, auf Menschen treffen, die ihr Mandat darin sehen, allen die sozialstaatlich vorgesehenen und intendierten Hilfen für die Entfaltung ihrer Potenziale und die Teilhabe an den Errungenschaften der Gesellschaft zukommen zu lassen. Eine in diesem Sinne agierende Verwaltung berücksichtigt in ihren responsiven Reaktionen, die in Ermessensspielräumen angelegt sind, die Umstände von Einzelfällen. Die Umsetzung eines so verstandenen Verwaltungshandelns fordert ein Ethos der persönlichen Verantwortung von Mitarbeiter:innen (vgl. Seibel 2017, 78f.). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass soziale Dienstleistungen, die für das Recht auf Unterstützung bedeutsam sind, in der Regel keiner Konditionalprogrammierung folgen, sondern an Zielen orientiert erbracht werden, deren Realisierung professionelles Handeln erfordert (vgl. Ortmann 2012, 771).
Unterstützung in sozialökonomischen prekären Lebensumständen ist im System der sozialen (Grund-)Sicherung vielfältig verankert. Aus systematischer Sicht spricht nichts dagegen, ein komplexes Unterstützungsrepertoire je nach Lage des Einzelfalls zu realisieren. Betrachtet man hingegen die sozialstaatliche Realität mit Blick auf die Qualität der Unterstützung, entsteht teilweise ein ganz anderes Bild, das im folgenden Kapitel erörtert wird.