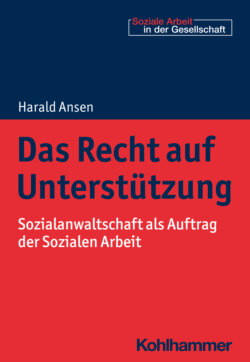Читать книгу Das Recht auf Unterstützung - Harald Ansen - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 Einleitung
ОглавлениеIn der aktuellen Sozialstaatsdiskussion wird die Auseinandersetzung über Unterstützungsleistungen überwiegend auf fiskalische Aspekte reduziert, beispielsweise wird über die Höhe der Grundsicherungsleistungen seit Jahren gestritten. In dieser Engführung wird verkannt, dass es in einer erweiterten Sichtweise um sozialrechtlich geregelte Dienst-, Sach- und Geldleistungen geht, die je nach den konkreten Lebensumständen der Leistungsberechtigten zu kombinieren sind. Die Soziale Arbeit ist in diesem Rahmen insbesondere dann gefordert, wenn Probleme nicht mit standardisierten Programmen gelöst werden können. Die kooperative Gestaltung der Sozialleistungen gemeinsam mit den Adressat:innen stößt immer häufiger an Finanzierungsgrenzen, die das Recht auf Unterstützung in Bezug auf den erforderlichen Umfang und die gebotene Qualität gerade für Menschen in armutsgeprägten Lebensumständen problematisch werden lassen.
Die Analyse der Rahmenbedingungen des Rechts auf Unterstützung aus der Perspektive der Sozialen Arbeit setzt an den sozialstaatlichen Grundlagen an, die nicht in ihrer bestehenden Form affirmativ nachvollzogen, sondern als Gestaltungsaufgabe wahrgenommen werden. Im Mittelpunkt stehen Unterstützungsrechte in armutsgeprägten Lebenslagen, die in vielen sozialarbeiterischen Arbeitsfeldern eine zentrale Rolle spielen. Gerade im Armutbereich fällt auf, dass die Interventionsschwellen für unterstützende Maßnahmen immer höher gelegt worden sind. Menschen werden zuweilen über Gebühr auf Eigenkräfte verwiesen, über die sie gar nicht verfügen. Dies impliziert weitreichende Risiken bis hin zu vermeidbaren Erkrankungen und einer Verfestigung prekärer Lebensumstände. Gerade Menschen in Notsituationen sind jedoch wegen ihrer vielfach verringerten Handlungsmöglichkeiten auf aktive und leicht erreichbare Unterstützungsleistungen angewiesen, ihnen fällt es besonders schwer, Zugangsbarrieren zu überwinden. In den folgenden Überlegungen werden Gründe für diese Entwicklung analysiert und daraus Konsequenzen für die Soziale Arbeit abgeleitet.
Im zweiten Kapitel wird das sozialstaatliche Unterstützungsverständnis in wirtschaftlich und sozial prekären Lebenslagen erörtert und damit der Rahmen für unterstützende Angebote der Sozialen Arbeit abgesteckt. Die Analyse von Armut und zentralen Konsequenzen für die Betroffenen in ihrem Alltag verweist bereits auf sozialanwaltliche Herausforderungen für die Soziale Arbeit in Bezug auf das Recht auf Unterstützung. Hierbei geht es insbesondere um die kritische Auseinandersetzung mit sozialpolitischen Armutsgrenzen, Modellen der Erfassung von Armut und sozialstaatlichen Interventionsschwellen, auf die im Interesse fairer sozialer Teilhabechancen Einfluss ausgeübt werden sollte. Das sozialstaatliche Gefüge, ausgehend vom aktuellen Unterstützungsverständnis in Gestalt von Dienst-, Sach- und Geldleistungen, liefert dafür eine breite Grundlage. Ethische Erwägungen der Leistungserbringung werden in diesem Kapitel mit empirischen Befunden über den Sozialstaat handlungsorientiert verknüpft ( Kap. 2).
Das Spektrum des sozialstaatlichen Unterstützungsverständnisses wird besonders im Armutbereich zunehmend infrage gestellt. Um die Hintergründe dieser Entwicklung geht es im dritten Kapitel. Die negativen Implikationen des sogenannten aktivierenden Sozialstaats für das Recht auf Unterstützung resultieren aus seiner immer rigideren Erwerbsorientierung, die in der systematischen Architektur nicht zwingend angelegt ist. Eigenverantwortung und ein verengtes Verständnis von Subsidiarität, die Ausblendung struktureller Faktoren für Armut und Erwerbslosigkeit und eine zunehmend moralische Argumentation im Umgang mit auf Unterstützung angewiesenen Menschen prägen das Bild. Für die Infragestellung des Rechts auf Unterstützung wird auch die Empowermentidee vereinnahmt. In einer (neo-)liberal verkürzten Lesart unter Vernachlässigung der politischen Hintergründe des Ansatzes werden Eigenkräfte, Ressourcen und Kompetenzen betont, während Probleme und Beeinträchtigungen nicht mehr benannt werden. Dass aber die Benennung von Problemen für den Zugang zu einer Reihe von Unterstützungsleistungen ausschlaggebend ist, bleibt in dieser Argumentation auf der Strecke. Wenn Empowerment primär subjektbezogen verstanden wird, bleiben überdies die für Ermächtigungsprozesse wichtigen strukturellen Faktoren in der Betrachtung außen vor. Von der Instrumentalisierung der Empowermentidee ist der Weg nicht weit, Hilfen infrage zu stellen. Für die politische Ablehnung professioneller Unterstützung werden u. a. romantisierende Vorstellungen privater Hilfequellen, die Stärkung der Selbsthilfe und die Vermeidung der Kolonisierung von Lebenswelten herangezogen ( Kap. 3).
Die im Sozialstaat angelegten Spielräume für die Soziale Arbeit, die insbesondere gefordert ist, wenn generalisierte Regelungen nicht mehr ausreichen, um Menschen in individuellen Notlagen angemessen zu unterstützen, erfordern es, ein sozialarbeiterisches Unterstützungsverständnis zu entwickeln. Dies erfolgt im vierten Kapitel auf der Grundlage aktueller Theorien der Sozialen Arbeit, die Auskunft geben über ein zeitgemäßes Gegenstandsverständnis, auf dessen Grundlage Herausforderungen für unterstützende Angebote abgeleitet werden. Nach Hinweisen auf das globale Verständnis Sozialer Arbeit werden für die Konkretisierung emanzipatorische, orts- und subjekttheoretische, lebenswelttheoretische, lebensbewältigungstheoretische, sozialökologische, systemisch-prozessuale und auf den Capabilities Approach bezogene Positionen aufgegriffen und am Ende des Kapitels zu einem sozialarbeiterischen Unterstützungsverständnis zusammengeführt ( Kap. 4).
Die Umsetzung des entwickelten Unterstützungsverständnisses im Sozialstaat erfordert vor dem Hintergrund der identifizierten Widerstände eine sozialanwaltliche Praxis, die bereits bestehende Varianten professionellen Handelns nicht ersetzt, sondern ergänzt. Nach der Erläuterung des Begriffs Sozialanwaltschaft werden im fünften Kapitel damit einhergehende Risiken im Zusammenhang mit dem freien Willen und der Beauftragung der Sozialen Arbeit erörtert. Hierbei stellt sich auch die Frage des Paternalismus in der praktischen Umsetzung sozialanwaltlicher Varianten der Interessenvertretung. Beide Risiken können nicht aufgelöst, wohl aber durch eine reflektiert-analytische Vorgehensweise verringert werden. Die Bewältigung der Gratwanderung zwischen Selbst- und Fremdbestimmung, vor der die Soziale Arbeit schon immer steht, bleibt eine permanente Aufgabe. Sie wird in Bezug auf die fallbezogene und die strukturelle Ebene der sozialanwaltlichen Praxis methodisch umrissen ( Kap. 5).
Der Ansatz der Sozialanwaltschaft zieht sich durch sämtliche Kapitel dieses Buches. Im zweiten Kapitel wird der Handlungsrahmen mit dem Ziel analysiert, Lücken und Probleme aufzudecken, für die Veränderungsvorschläge aus der Perspektive der Sozialen Arbeit eingebracht werden. Die Auseinandersetzung mit sozialstaatlichen und sozialpolitischen Argumenten gegen angemessene professionelle Unterstützungsangebote fordert die Soziale Arbeit dazu heraus, ihre Angebote zu legitimieren und Infragestellungen als eine Form der Hilfeverweigerung zu entlarven. Zugleich steht sie vor der Aufgabe, ihre Unterstützungsideen zu begründen, ein Versuch dafür liegt mit dem vierten Kapitel vor. Schließlich mündet die Vorstellung einer sozialanwaltlich orientierten Sozialen Arbeit in dem Anspruch, Vorschläge für die Umsetzung in der Praxis zu entwickeln, wie sie exemplarisch im fünften Kapitel angeregt werden.