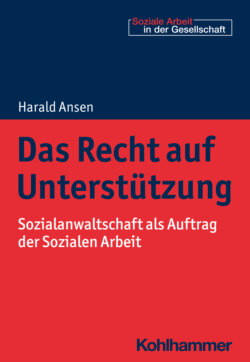Читать книгу Das Recht auf Unterstützung - Harald Ansen - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Grundsicherungsanspruch
ОглавлениеWährend die absolute Armutsgrenze der physischen Lebenserhaltung dient und die relative Armutsgrenze die soziokulturelle Armutsgrenze abbildet, die an einem statistisch festgelegten Normwert gemessen wird, handelt es sich beim Grundsicherungsanspruch um eine politische Armutsgrenze, die in Bezug auf das Recht auf Unterstützung ganz besonders zu beachten ist. Regelbedarfe werden nach dem »Gesetz zur Ermittlung der Regelbedarfe nach § 28 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz)« auf der Grundlage der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe sogenannter einkommensschwacher Haushalte ermittelt. Für Einpersonenhaushalte werden die unteren 15 Prozent, für Familienhaushalte die unteren 20 Prozent der Haushalte ohne die Bezieher:innen von Sozialhilfe- und Grundsicherungsleistungen herangezogen. Eine Begründung für die unterschiedliche Größe der Referenzhaushalte ist dem Gesetz nicht zu entnehmen, sie verzerrt die Ergebnisse der Regelbedarfsberechnung für Einpersonenhaushalte zu deren Lasten.
Von den ermittelten Ausgaben der Referenzhaushalte werden je nach politischer Auffassung noch Posten abgezogen, die für verzichtbar gehalten werden. Auch an dieser Stelle kommt der normative Charakter der Armut zum Ausdruck. Kategorial betrachtet umfasst das soziokulturelle Existenzminimum die Mittel für die physische Lebenssicherung, für die Befriedigung der Bedürfnisse des täglichen Lebens einschließlich Kosten der Unterkunft und Heizung, für Mobilitäts-, Bildungs-, Informations- und Kommunikationsbedarfe, für die Unterhaltung zwischenmenschlicher Beziehungen und für die Nutzung von kulturellen und Freizeitangeboten (vgl. Becker 2017, 273). Betrachtet man die aktuell regelbedarfsrelevanten Verbrauchsausgaben beispielsweise für einen Einpersonenhaushalt, so stehen für Bekleidung und Schuhe monatlich 34,60 EUR oder für Bildung 1,01 EUR zur Verfügung. Für Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres liegt der Anteil für Bekleidung und Schuhe bei 36,25 EUR und für Bildung bei 0,68 EUR, vom siebten bis zum vollendeten 14. Lebensjahr liegt der Anteil für Bekleidung und Schuhe bei 41,83 EUR und für Bildung bei 0,50 EUR. Diese Einblicke unterstreichen einmal mehr, dass lebensweltnahe empirische Studien fehlen, die unter Berücksichtigung besonderer Bedarfe in den jeweiligen Fallkonstellationen Auskunft über eine ausreichende Grundsicherung geben. In Bezug auf das Recht auf Unterstützung ist an dieser Stelle auf den politischen Auftrag der Sozialen Arbeit in der Auseinandersetzung, um eine angemessene Grundsicherung aufmerksam zu machen.
Zieht man die Zahl der Bezieher:innen von Grundsicherungs- und Sozialhilfeleistungen heran, um das Ausmaß von Armut darzustellen, sind etwa acht Millionen Menschen betroffen (vgl. Aust 2019, 101). Gemessen an der 60-Prozent-Armutsgrenze leben derzeit 15,8 Prozent der Bevölkerung an der Armutsgrenze (vgl. Datenreport 2021, 233). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Armutsquote vor dem Bezug von Sozialleistungen bei über 23 Prozent liegt; die Einkommensarmut in Deutschland wird durch Leistungen des Sozialstaats also verringert, aber nicht überwunden (vgl. Bäcker 2019, 302f.). Für die Soziale Arbeit interessant ist die Frage, welche Bevölkerungsgruppen vor allem von Armut betroffen sind, denn diese Daten geben Aufschluss über strukturelle Benachteiligungen. Auf der Grundlage der 60-Prozent-Armutsgrenze sind nach den jüngsten Erhebungen für das Jahr 2018 u. a. junge Menschen mit 20,6 Prozent, Alleinerziehende mit 33,8 Prozent, Menschen mit niedrigem Bildungsabschluss mit 30,5 Prozent und Erwerbslose mit 69,4 Prozent überdurchschnittlich von Armut betroffen (vgl. Datenreport 2021, 225).
Aus den ersten Annäherungen an das Armutsverständnis können bereits Herausforderungen für die Soziale Arbeit mit Blick auf das Recht auf Unterstützung abgeleitet werden. Bereitgestellte Hilfen im Bereich der absoluten Armut wie beispielsweise die Unterbringung Wohnungsloser in Mehrbettzimmern oder eine Rückfahrkarte in das Herkunftsland für mittellos in Deutschland lebende Menschen sind dahingehend zu prüfen, ob sie von den Betroffenen als Unterstützung empfunden und wahrgenommen werden. Ist dies aus nachvollziehbaren Gründen nicht der Fall, bleibt die Verelendung faktisch bestehen. Auch wenn selbstverständlich nicht allen Wünschen entsprochen werden kann, ist es legitim, die Qualität der angebotenen Unterstützung hinsichtlich ihrer Angemessenheit in den Blick zu nehmen. Die statistische Armutsgrenze von 60 Prozent relativer bzw. 50 Prozent strenger Armut sagt
• erstens nichts über die faktischen Teilhabemöglichkeiten aus,
• zweitens werden unterschiedliche Bedarfe, wie sie beispielsweise mit Krankheit oder Behinderung einhergehen, nicht gewürdigt,
• drittens kann man nicht ernsthaft davon ausgehen, dass Haushalte, die knapp über der Armutsgrenze liegen, nicht mehr unter Armutsfolgen leiden.
Diese Zusammenhänge verdeutlichen, wie wichtig es für die Soziale Arbeit ist, statistische Messverfahren mit konkreten Lebensumständen zu korrelieren, um Lücken aufzuzeigen und einen Beitrag für eine realistischere Vorstellung von Armut zu entwickeln. Hinzu kommt eine notwendige kritische Auseinandersetzung mit der soziokulturell angelegten Grundsicherung, für die weiterhin breite empirische Grundlagen für die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe fehlen. Die Forderung vieler Fachverbände, die Leistungen zu erhöhen, um dem gesetzlichen Ziel der Teilhabeförderung näherzukommen, erfordert entsprechende Forschungen, die der Durchsetzung des Rechts auf angemessene Unterstützung in diesem elementaren Bereich dienlich wären. Für die Soziale Arbeit ist im Umgang mit dem Recht auf Unterstützung weiterhin entscheidend, was sich hinter den Zahlen für die betroffenen Menschen verbirgt und welche Herausforderungen daraus resultieren.
Die statistisch-systematische Erfassung von Armut ist disziplinübergreifend angelegt. Aus der Sicht der Sozialen Arbeit sind daneben insbesondere die Auswirkungen auf die alltäglichen Lebensbedingungen der Betroffenen mit Blick auf ihre sozialen Teilhabechancen relevant. Zwar wird das Teilhabethema bereits in der Definition der relativen Armut und in der politischen Armutsauffassung, wie sie in der Grundsicherung und der Sozialhilfe zum Ausdruck kommt, aufgegriffen, doch bleiben die Ausführungen überwiegend pauschal. Für die Ausbuchstabierung des Rechts auf Unterstützung in wirtschaftlich und sozial prekären Lebenslagen sind vertiefende Überlegungen geboten.