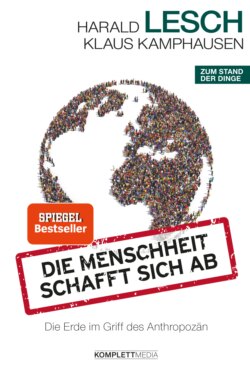Читать книгу Die Menschheit schafft sich ab - Harald Lesch - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKapitel 1
DIE WELT IST SCHON DA
Unsere Geburt konfrontiert uns mit unserer größten Herausforderung: mit der Welt, denn die ist bereits da. Und sie macht uns Schwierigkeiten. Nicht sofort, erst einmal umsorgen uns die Eltern, sie pflegen und behüten uns. Aber dann, wenn wir in die Welt hinausgehen – und wenn es nur die allerersten kleinen Schrittchen sind – arbeitet die Welt sofort unserem Streben entgegen. Wir widerstreben der Welt, und die Welt widerstrebt uns. Deshalb fangen wir sofort an, sie zu verändern. Wir wollen, dass die Dinge sich so verhalten, wie wir es gerne hätten. Schon ein kleines Kind wird stinksauer, wenn nicht alles so läuft, wie es will. Und dieses Verhalten praktizieren wir fortan bis zu unserem letzten Atemzug: Wenn irgendetwas auf der Welt nicht in unserem Sinne funktioniert, wird das eben geändert. Schon vor 500.000 Jahren hat die Menschheit begonnen, die Welt zu verändern – und sie tut es bis heute. Alles, was wir anstellen, dient dazu, unser Überleben zu sichern. Das ist Kultur, das ist die Kultivierung der Natur, das originäre Werk des Menschen.
So was wie uns hat dieser Himmelskörper noch nicht erlebt – und was hat er nicht schon alles erlebt! Diese Spezies ist wirklich einzigartig.
Aber wie konnte es dazu kommen? Wie hat das angefangen, dass die Menschen nicht nur ihre direkte Umwelt beeinflussten, sondern sich weiter um den gesamten Globus herum ausbreiteten. Dabei hinterließen sie nicht nur ihre Fußstapfen und andere Spuren, sie verwandelten diese Gebiete sogar so sehr, dass wir uns heute fragen müssen: War es nicht zu viel des Guten?
Bei der Beantwortung dieser Fragen werden wir sehen, dass bei allem, was Menschen in Bezug auf ihren Lebensraum taten und tun, immer eine gewisse Zweckrationalität dahintersteht. Wir haben nie unsinnig gehandelt, weder in globalen Zusammenhängen noch im lokalen Bereich. Immer gab es gute Gründe, etwas zu tun und etwas anderes zu lassen. Und um diese Gründe wird es uns hier gehen.
Also: Fangen wir ganz, ganz von vorn an … nein, besser nicht.
Wir fangen anders an, nicht so, wie Sie es vielleicht erwarten (der Lesch fängt doch immer mit dem Urknall an). Nein, so wird es diesmal nicht sein.
Ich stelle Ihnen eine Frage:
Mit welchem Instrument arbeiten wir Menschen eigentlich bevorzugt?
Ich gebe Ihnen eine Hilfestellung: Es ist ein Instrument, das trotz seiner allgemeinen Bevorzugung mancherorts viel zu wenig zum Einsatz kommt. Das wunderbare Ding, das wir aus guten Gründen am weitesten entfernt vom Boden bei uns tragen, ist – jawohl, das Gehirn.
Es wäre ja geradezu hirnrissig, unsere CPU (unsere zentrale Prozessoren-Einheit) über den Boden zu schleifen und sie dabei allerlei Verletzungsrisiko auszusetzen. Dieser kognitive Apparat am luftigen Ende unseres Körpers verfügt über die Möglichkeit, sich Gedanken zu machen. Nicht nur irgendwelche sinnlosen Spinnereien und wirren Träume, sondern zweckorientierte Gedanken, also virtuelle Planspiele mit dem Zweck, ein Ziel zu erreichen. Wir verfügen also über die Fähigkeit, in uns eine Wirklichkeit herzustellen, nach dem Motto: Ich gestalte die Welt nach meiner Vorstellung.
Genau das ist das Geheimnis des Erfolgs der Spezies Mensch: die Fähigkeit, sich etwas vorstellen zu können, Zukunft zu simulieren. Der Mensch kann nicht nur über das reflektieren, was er bereits getan hat, er kann sich auch in die Zukunft hineindenken. Er kann sich bestimmte Ziele vorstellen, und wie es nach Erreichen dieser Ziele sein könnte, sogar, ob sich danach noch weitere Ziele ergeben könnten. Dieses Nach-vorne-Denken in eine Zeit, die noch nicht da ist, das ist der Prometheus in uns. Immer weiter und weiter!
Aber es gibt auch seinen Bruder Epimetheus, der Zurückblickende. Er versucht, aus Fehlern zu lernen und seinen Bruder immer wieder zur Vorsicht zu mahnen: „Pass auf, wir haben da damals schon einen blöden Fehler gemacht. Bitte mach nicht so weiter, sonst geht alles den Bach runter.“ Aber der gute Prometheus hört nicht gerne auf solche Warnungen, er macht sich immer wieder zu neuen Zielen auf.
Wir haben also zwei verschiedene Geschwindigkeiten: Auf der einen Seite sehen wir, was wir schon angerichtet haben. Aber es dauert, bis wir die Fehler sortiert und eingeordnet sowie priorisiert haben: Was war der schlimmste Fehler, den wir gemacht haben? Während wir noch überlegen, ist Prometheus schon längst weitergeeilt.
Ich vergleiche die ethische Frage nach dem „Was soll ich tun?“ mit der Fahrt auf einer Draisine: Da steht man auf diesem Schienenfahrzeug, drückt den Handhebel rauf und runter und bewegt sich in gemütlichem Tempo vorwärts. Währenddessen rast der technische Fortschritt in Form der neuen japanischen Magnetschwebebahn mit mehr als 600 Kilometern pro Stunde auf dem Nachbargleis an uns vorbei in die Zukunft. Wenn wir hinterher feststellen, diese Entwicklung war ein Fehler, haben wir ein Problem. Leider handeln wir oft schneller, als wir unser Tun bewerten können.
Der Erkenntnisapparat in unserem Kopf lässt uns die Welt auf eine Weise betrachten, wie kein anderes Geschöpf auf diesem Planeten das kann. Wir sind in der Lage, Prognosen zu erstellen und zwar auf Basis von dem, was wir in der Vergangenheit gelernt haben. Ein gutes Beispiel dafür sind unsere Wettervorhersagen. Wenn der Himmel blau ist, kann es keinen Regen geben. Sehen wir Wolken am Himmel, sogar dunkelgraue Wolken, dann wissen wir seit der Urzeit: Es könnte bald Regen geben. Türmen sich gewaltige Wolkengebirge auf, dann, so lehrt uns unsere Erfahrung, könnte ein Gewitter heraufziehen.
Unsere Erfahrungen mit dem Wetter haben sich im Laufe von 500.000 Jahren sogar in unserer Genetik verfestigt und wappnen uns so gegen die Unbill des Klimas. Schon früh merkte der Mensch, dass eine Höhle bei Gewitter und auch bei Kälte einen gewissen Schutz bietet. Vorausgesetzt, es wohnt nicht schon ein Bär oder sonst irgendetwas Bedrohliches darin.
Darum geht es bis heute: Sich in einer Umwelt, die voller Gefahren ist, so zu schützen, dass das eigene Überleben und das der Sippe gewährleistet ist. Das ist der eigentliche Antriebsmotor in der kulturellen Menschheitsgeschichte: Die Feststellung, dass die Lebenswirklichkeit widerstrebend ist. Ich bin nur ein Teil des Teils, der anfangs alles war. Ich bin Teil in einer Umgebung, in der ich überleben muss und von der ich lebe. Aber gerade das Letztere ist eine Erkenntnis, zu der wir Menschen leider erst viel, viel später, vielleicht zu spät gelangt sind. Manche von uns bis heute noch nicht.
Der Mensch lernt von seinen Mitmenschen, seinen Eltern, seiner Familie, seinen Freunden, seinen Bekannten, seiner kleinen Gruppe um ihn herum. Er lernt, sich zu verhalten. Und er lernt dabei auch, dass es manchmal gut sein kann, etwas nicht zu tun.
Die Alten haben den Jungen mitgeteilt: Seht, das war der Fehler, den wir gemacht haben, macht ihr den besser nicht. Wenn die Nachkommen schlau waren, haben sie sich dran gehalten. So entwickelten sich allmählich handwerkliche Fähigkeiten und kulturelle Traditionen.
Das menschliche Bestreben, zunächst die unmittelbare und später auch die weitere Umwelt zu beeinflussen, zu manipulieren und zu gestalten, hat dem Erdzeitalter, in dem der Homo sapiens lebt und wirkt, seinen Namen gegeben: das Anthropozän.
Maßgebend dafür war und ist die abendländische Kultur, denn sie ist die Kultur, die die Wissenschaft hervorgebracht hat. Die Wissenschaften haben mit ihren technischen Anwendungen den menschlichen Einfluss auf die Umwelt, auf den Planeten insgesamt, immens potenziert. Keine andere Kultur in der Menschheitsgeschichte hat die Erde so verändert wie die abendländische.
Eigentlich brauchen wir nicht ganz vorn bei den Steinzeitmenschen anzufangen, wir können ruhig erst vor etwa 400 Jahren einsteigen, vielleicht noch ein paar Jahre früher. Denn damals begann der Mensch, Verschiedenes auszuprobieren und Neuland zu erforschen. Das Abendland entdeckte neue Kontinente und breitete seinen Einfluss über den Globus aus. Man verfügte schon über gewisse Technologien, die sich aufs Trefflichste zur Befriedigung eines Verlangens nutzen ließen, das dem Menschen schon seit Anbeginn zu eigen ist: die Gier. Der ewige Wunsch nach mehr ist in seiner Stärke vergleichbar mit dem Überlebenstrieb oder dem Fortpflanzungstrieb.
Aus der Verhaltensforschung stammt der Begriff des Säugetier-Imperativs. Das Säugetier gibt sich praktisch selbst den Befehl, fortwährend die eigene Position innerhalb seiner Gruppe zu überprüfen und wenn nötig zu verbessern. Nie wäre es zu einer solchen Wirkungsmächtigkeit eines Zeitalters gekommen, wie sie vom Anthropozän ausgeht, wenn sich statt des Homo sapiens nur eine weitere Art Ameisen oder Bienen entwickelt hätte. Kommt eine Ameise auf die Welt, ist ihre Position bereits klar definiert: Entweder ist sie Arbeiterin, Königin oder nur ein für die Befruchtung zu gebrauchendes Männchen. Ein Aufstieg ist nicht möglich.
Wenn man aber als Säugetier auf die Welt kommt, will man, nein, man muss mit den anderen konkurrieren, um die eigenen Gene besser zu verteilen. Säugetiere sind immer auf Prestigegewinn innerhalb ihrer Gruppe ausgerichtet. Diese Eigenschaft dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, wenn wir uns über das Phänomen der menschlichen Gier Gedanken machen. Wie kann eine bestimmte Spezies von Säugetieren so anspruchsvoll werden, dass sie sich mehr nimmt, als sie für ihr Überleben braucht, dass sie sich zu viel nimmt?
So geschehen zum Beispiel in der Antike. Wenn wir die abendländische Kultur als die Kultur definieren, die sich um das Mittelmeer herum entwickelt hat, können wir heute noch die Spuren ihres übermächtigen Verlangens sehen: Vor gut 2.000 Jahren begannen die Römer Schiffe zu bauen. Die wurden damals aus Holz gemacht. Und weil sie sehr viele Schiffe bauten, brauchten sie sehr viel Holz. Die Folge: Sizilien und Spanien, bis dato grüne Länder, wurden systematisch entwaldet. In Norditalien hatten die Etrusker sogar noch vor den Römern mit der Entwaldung im großen Stil begonnen, denn sie brauchten sehr viel Holzkohle, um Bronze herzustellen.
Wir stellen also fest, dass der Beginn des Anthropozän nicht erst in die Zeit der Industrialisierung im 18. Jahrhundert fällt, auch nicht in die Zeit von Kolumbus, nein, er liegt viel weiter zurück. Es ist die Geburt der abendländischen Kultur, die das menschendominierte Zeitalter einläutet. Mit einem sehr erfolgreichen Verfahren, der Empirie, hat diese Kultur die Wirkkraft der Menschheit um ein Vielfaches der physischen Kräfte des Individuums verstärkt.
Die empirischen Wissenschaften betreiben Forschungen und gewinnen Erkenntnisse auf Grund von Erfahrungen, deren Erklärungen schlagen sich in wissenschaftlichen Modellen nieder. Ganz wichtig dabei ist, dass jedes Modell, jede Hypothese, jede Theorie an der Wirklichkeit scheitern können muss, man muss sie überprüfen können. Die Erfahrung steht im Mittelpunkt von allem.
Im Grunde verhält sich die Wissenschaft damit wie der ideale abendländische Mensch: Er arbeitet mit Erfahrungen, die er als Maßstab für das Scheitern oder Bestehen einer Hypothese definiert. Mit anderen Worten: Wenn eine Hypothese Prognosepotenzial besitzt, sie etwas vorhersagen kann, dann hat sie ihre Prüfung bestanden – sie ist gut.
In diesem Buch wird es also nicht um unüberprüfbare Spekulationen wie zum Beispiel Paralleluniversen gehen, sondern wir beschäftigen uns mit etwas Relevantem, eben mit einem Thema, welches unsere bisherigen und zukünftigen Handlungsweisen betrifft und damit geradezu an uns appelliert: Bitte tu das nicht noch einmal, denn du weißt jetzt, dass es ein Fehler war. Wissen und Schlussfolgerungen, die für unser Überleben wichtig sind, besitzen höchste Relevanz. Und schon stehen wir mitten in der Problematik des Anthropozän.
Zur abendländischen Kultur gehörte von Anfang an die Auseinandersetzung mit Theorie und Experiment. Ein erster wichtiger Schritt wurde von Nikolaus Kopernikus gemacht. Seine nach ihm benannte Wende, in der er die Erde aus dem Mittelpunkt des Weltalls herausnahm und sie als einen unter vielen Planeten einordnete, wird von Freud als Kränkung der Menschheit bezeichnet, weil der Mensch dadurch seine Vormachtstellung einbüßte. Kopernikus appellierte an unsere Vernunft, nicht an unseren Verstand.
Sie kennen doch den Unterschied zwischen Vernunft und Verstand, oder? Der Verstand ist das Instrument der Vernunft, was uns zum vernünftigen Handeln befähigt. Die Vernunft bestimmt mit Weisheit und Moral unsere Handlungsweisen. Und was hat Kopernikus gesagt?
Seid nicht wie die Tiere! Richtet euch nicht nur nach euren Sinnen, die euch vormachen, dass sich die Welt um euch herum dreht. Nein, es gibt allgemeinere Prinzipien, derer unsere Vernunft mittels unseres Verstandes habhaft werden kann.
Diese Prinzipien können uns viel mehr über die Welt verraten, als das, was unsere Sinne uns vorgaukeln.
Der abendländische Mensch versucht, seine Erfahrungen vernünftig mittels seines Verstandes einzuordnen und zu verstehen. Diese Vorgehensweise brachte uns in der Geschichte Vorteile in einem Ausmaß, dass es einem ganz schwindlig wird. Sie ist das Credo der abendländischen Wissenschaften, die für die Aufklärung, den Fortschritt und den Erfolg der Spezies Mensch gesorgt hat.
NIKOLAUS KOPERNIKUS (1473–1543)
„Seid nicht wie die Tiere.“
Der kopernikanische Appell scheint
verklungen zu sein.
Doch wo stehen wir heute? Der kopernikanische Appell scheint verklungen zu sein, denn wir verhalten uns wieder wie die Tiere und zwar wie ganz niedrige. Global betrachtet vermehren wir uns unbändig, und unsere Gier hat in einer Weise zugenommen, die alle Vernunft vermissen lässt. Wir wollen alles haben und noch viel mehr, vor allem Geld. Aber darüber reden wir später.
Nun aber zurück zu unserer Ausgangsfrage: Wie hat alles angefangen? Mit dem Blick in den Himmel! Na gut, das ist für mich als Astronom ein Heimspiel. Aber jeder Mensch kann durch viele Blicke in den Himmel eine sehr vertrauenerweckende Erfahrung machen, und das schon sehr, sehr früh, sodass diese Erfahrung inzwischen sogar genetisch abgespeichert werden konnte: die rhythmischen, die periodischen Wiederholungen der Vorgänge am Himmel. Das klingt erst einmal nach nicht sehr viel, aber die sichere Wiederholung ist für uns Menschen etwas sehr Wichtiges.
Schon sehr früh haben wir festgestellt, dass es gut ist, wenn die Sonne morgens im Osten aufgeht und abends im Westen wieder unter. Und auch der Mond geht auf und unter. Die Verlässlichkeit hat Sicherheit vermittelt, Vertrauen in die Welt. Die periodischen Veränderungen am Himmel bezeugen eine Ordnung in der Natur. Gott sei Dank ist die Natur nicht chaotisch, sie bringt keine unvorhersehbaren, bedrohlichen Phänomene hervor. Nein, alles hat eine Ordnung, alles hat seine Gründe und Ursachen, alles hat natürliche Auslöser.
So kam den Astronomen bereits vor etlichen Tausend Jahren eine besondere Bedeutung zu, konnten sie doch die Bewegungen am Himmel interpretieren. Zunächst wurde die Ursache für die Bewegung der Himmelskörper den Göttern zugeschrieben. Aber schon vor rund zweieinhalbtausend Jahren verbreitete sich vom Abendland die Überzeugung aus, dass wir Menschen mittels unseres Erkenntnisapparates den Dingen auf den Grund gehen und erkennen können, was wirklich in der Welt passiert. Man wusste zwar noch nicht, warum die Welt so ist, wie sie ist, aber zumindest begann man zu verstehen, dass Ursachen Wirkungen haben. Und dieses Verständnis darüber ist unabhängig von irgendeiner übernatürlichen Erkenntnisquelle. Wir können sehr wohl aus uns heraus etwas über die Welt verstehen.
Odysseus und die Sirenen. Er traute den Göttern nicht.
Der Erste übrigens, der es in der Literatur mit den Göttern aufgenommen hat, war Odysseus. Ja, die homerische Ilias belegt genauso wie alle anderen Geschichten, die in dieser Zeit geschrieben wurden, die langsam wachsende Emanzipation gegenüber den Göttern. Odysseus, der Listige, hat sogar versucht, die Götter zu betrügen. Dabei hatte er zwar eine Göttin auf seiner Seite, aber im Wesentlichen hat er sich auf seinen eigenen Verstand und seine Vernunft verlassen. Dabei war er auch gegenüber den Göttern misstrauisch.
Dieses Misstrauen gegenüber den traditionellen, übernatürlichen Erkenntnisquellen war der Beginn der Philosophie. Zuerst machten sich die alten Griechen Gedanken über Elemente, Feuer, Wasser, Luft und Erde. Bald formierte sich erneut Kritik: Kann nicht alles auch ganz anders sein? Vielleicht besteht die Welt nur aus Atomen und dem Nichts.
Unglaublich, die Idee von den Atomen ist tatsächlich schon 2.300 Jahre alt.
Aber dann hat es noch einmal 1.700 Jahre gedauert, bis die ersten Entdeckungen der Struktur von Materie gemacht werden konnten. Damit sind wir genau genommen bis heute beschäftigt, nur hat sich unsere Arbeitsweise verändert.
Seit 400 Jahren betreiben wir empirische Forschung, indem wir unsere Theorien mit Beobachtung und Experiment überprüfen. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse über die natürlichen Vorgänge werden schließlich mithilfe einer großartigen Eigenschaft des Menschen, der Kreativität, in Technik umgesetzt. Technik kommt vom griechischen technikós, was so viel bedeutet wie Handwerk oder Kunstfertigkeit. Wir bleiben eben nicht nur bei der reinen Erkenntnis stehen, sondern erschaffen aus ihr etwas Neues.
Die Geschichte der Technik ist eine grandiose Erfolgsstory. Schon das Entfachen von Feuer war zur Zeit seiner Entdeckung Hightech, ebenso das Rad, das Seil oder die erste Schrift. Eine Kultur, die solche Techniken beherrschte, war allen anderen weit überlegen. Immer war die neueste technologische Leistung der Gewinner und dabei spielte es keine Rolle, dass die ersten Erfindungen ohne wissenschaftlichen Hintergrund gemacht wurden. Was bedeutet es aber für den Menschen, wenn er die Ursachen kennt, Wirkungen voraussehen kann, die wiederum Ursachen sein können. Was bedeutet das für den technischen Fortschritt?
Die Antwort ist einfach. Wir beobachten in den letzten 400 Jahren einen exponentiellen Anstieg der technischen Erneuerungen dank des wissenschaftlichen Fortschritts. Wissenschaftliches Wissen beinhaltet Erkenntnisse über die Welt, wie sie ist. Technisches Wissen ermöglicht die Umsetzung dieser Erkenntnisse in etwas Neues, es kann etwas Neues schaffen. Technisches Wissen ist Know-how. Wissenschaft sucht nach den Gründen, Technik sucht danach, wie diese Gründe nutzbar gemacht werden können. Technik ist niemals zweckneutral, sondern immer zweckorientiert.
Wenn wir über das Anthropozän sprechen wollen, können wir über die Wissenschaften reden, aber eigentlich müssen wir über Technologie und über Technik reden.
Angefangen hat alles vor 500.000 Jahren. Der Mensch kam auf die Welt, und die Welt war schon da.