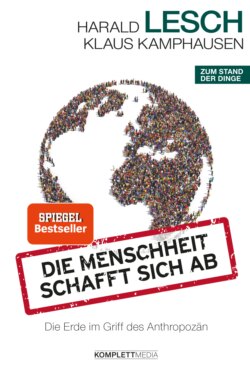Читать книгу Die Menschheit schafft sich ab - Harald Lesch - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKapitel 7
WETTBEWERB UND KOOPERATION
Hat eigentlich irgendjemand damals die Einführung der Photosynthese überlebt?
Na klar, die Lebewesen, denen der Sauerstoff nichts anhaben konnte, weil sie selbst die Umwandlung von Sonnenlicht in Zucker und Sauerstoff praktizieren: die Cyanobakterien. Diese Fähigkeit ließ sie den gesamten Planeten erobern. Trotzdem gibt es auch heute noch einige ganz seltene Arten von Einzellern, die nicht von Sauerstoff leben, sondern von sehr heißer Salpetersäure oder sogar Salzsäure. Sie leben unter extremen Bedingungen tief in der Erde oder in der Nähe heißer Quellen.
Zusammenfassend kann man sagen, dass die Photosynthese die Welt von unten nach oben verändert hat. Zunächst fand sie nur im Meer statt, aber mit der Zeit, vor circa 2,5 Milliarden Jahren, gelangte der Sauerstoff auch in die Atmosphäre, wo er sich langsam zur Ozonschicht verdichtete. Man spricht von einer Top-down-Kausalität, also von oben nach unten, die die Lebensbedingungen auf dem ganzen Planeten veränderte. Erst durch die Ozonschicht ergab sich die Möglichkeit, dass in den oberen zehn Metern der Meere Lebewesen überleben. Vorher ging das nicht, denn die ultraviolette Strahlung der Sonne drang direkt ins Wasser und zerschlug die molekularen Strukturen. Durch die schützende Ozonschicht wurden die Lebensräume größer. Das Leben atmete förmlich auf.
Der radikale Wechsel in der Energieversorgung, von chemischer Energie zur Sonnenenergie, war ein tiefer Einschnitt in der Entwicklung des Lebens. Hier wurde auf einen Schlag ein Wettbewerb ausgerufen, den nur eine ganz bestimmte Zellart gewinnen konnte.
Das sollten wir im Hinterkopf behalten: Wettbewerb erzwingt Anpassung an sich verändernde Umstände. Der Wettbewerb ist der Antriebsmotor des Lebens. Ohne ihn könnte sich nichts entwickeln und es gäbe keinen Fortschritt. Das ist auch der Grund dafür, dass niemals zwei genau gleiche Organismen einer Art auftreten. Es gibt immer kleine und kleinste Variationen unter den Vertretern einer Spezies, einer ist ein bisschen größer, ein anderer ein bisschen dicker, die einen vollziehen die Photosynthese ein wenig effizienter oder ein bisschen schneller und so fort. Welche Variante, welche Eigenart sich als Vorteil für das Individuum erweist, stellt sich erst im Nachhinein heraus, wenn genau dieses Lebewesen die nächste Veränderung seiner Umgebung erfolgreich übersteht und seine vorteilhaften Gene an die Nachkommen verteilen kann.
Die Evolution ist wie eine Wette auf die Zukunft. Auch in uns, der Spezies Mensch des 21. Jahrhunderts, spielt sich die ständige Kreativität und Vielfalt zellulären Wachstums ab.
Dabei verändern sich Zellen nicht schlagartig. Wenn sie es doch tun, wenn Zellwucherungen, gutartige und bösartige Veränderungen stattfinden, dann haben die Kontrollprozesse im Organismus nicht funktioniert, die sonst unser Dasein in der Spur halten – und der Mensch ist krank.
Wettbewerb findet in jedem Lebewesen und zwischen den Lebewesen statt, besonders zwischen den Arten. Allen Kreaturen geht es darum, sich optimal – oder zumindest so gut wie möglich – an veränderte Umweltbedingungen anzupassen. Der Mensch ist in diesem permanenten Lebenskampf schon immer besonders erfolgreich gewesen. Er bewohnt sämtliche Klimazonen der Erde und passt sich mithilfe seiner kognitiven Fähigkeiten, mit Kultur und Technik, Sprache und Wissenschaft ständig an die Umwelt an. Wir Menschen können uns nahezu perfekt vor der Natur schützen, nur den Bakterien und Viren gelingt es immer wieder, uns anzugreifen, und manchmal gewinnen sie den Kampf. Auch in puncto Anpassungsfähigkeit sind sie die Einzigen, die uns Konkurrenz machen: Man findet Bakterien überall auf der Erde, vom tiefen Erdreich bis zur Hochatmosphäre.
Kommen wir zurück zu den Prokaryoten, den Zellen ohne festen Zellkern. Die haben damals das gemacht, was Bakterien von jeher tun: Fressen und Gefressen werden. Doch plötzlich konnte ein Bakterium das Aufgenommene nicht mehr verdauen. Anstatt Bauchgrimmen hervorzurufen, lieferte das einverleibte, noch lebende Bakterium etwas ab, was das aufnehmende Bakterium gut gebrauchen konnte. Die beiden schlossen quasi eine Art Freihandelsabkommen: Ich gebe dir, was du brauchst, und du gibst mir, was ich will. So blieben die beiden im wahrsten Sinne des Wortes inniglich in einer Art Arbeitsgemeinschaft verbunden. Das nennt man Endosymbiose.
Nun gab es also erste Zellen mit einem eingeschlossenen Zellkern. Während in den Prokaryoten das Erbmaterial bisher frei in der Zelle herumschwamm, verfügte die neue Zellart jetzt innerlich über eine Arbeitsteilung wie in einer Fabrik. Da gab es spezialisierte Abteilungen, die für ganz bestimmte Aufgaben zuständig waren. In der Mitte der Zelle befand sich nun das Erbmaterial, ordentlich in einem Zellkern verstaut. Das war sozusagen die Direktion, die sagt, wo’s lang geht. Und die Mitochondrien sorgten dafür, dass Energie bereitgestellt wurde. Bei manchen Zellen entwickelten sich Chloroplasten, die in der Lage waren, den Farbstoff Chlorophyll zu synthetisieren – und damit eine ganz neue Art Photosynthese zu betreiben, die sich später bei den Pflanzen wiederfinden wird.
Übrigens: Anhand der Mitochondrien in der menschlichen Zelle lässt sich ziemlich genau bestimmen, woher wir Menschen ursprünglich kamen. Die Mitochondrien haben ein eigenes Erbgut, mit dem sich die Ur-Mutterlinien der Menschheit bis nach Ost-Afrika verfolgen lassen. Alle heutigen Menschen stammen sehr wahrscheinlich von nur sieben Müttern ab, die vor 72.000, vielleicht 75.000 Jahren im heutigen Simbabwe lebten.
Doch zurück zu den damals neuen Zellen – den Eukaryonten, die sich vor circa zwei Milliarden Jahren aus den Prokaryonten entwickelt hatten. Einmal entstanden, bildeten sich ständig neue Varianten dieses Zelltyps. Ein Eukaryont, 10.000-mal größer als die alte Bakterie, arbeitet quasi als Riesenfabrik mithilfe von Hochleistungsmitochondrien an einer immer effizienter werdenden Energiezufuhr und Proteinsynthese.
Die Urzelle der Tiere und Pflanzen hat den Betrieb aufgenommen – und ein neues Zeitalter des Lebens eingeläutet. Während bisher immer nur langweilig verdoppelt und geklont wurde – aus eins mach zwei –, machen nun plötzlich zwei zusammen ein neues Lebewesen. Holla! Ein gewaltiger Kreativitätsschub erschüttert die Welt.
Vorher gab es, wenn überhaupt, immer nur allerkleinste Variationen eines bereits bekannten Themas. Natürlich kann man auch bei den Bakterien Evolution beobachten, man muss sich nur in Geduld üben. Die einfache Vermehrung durch Verdopplung vollzieht sich rasant, aber Veränderungen dauern ziemlich lange.
Bei den Eukaryonten ist das ganz anders. Jedes neue Lebewesen stellt eine neue Kombination dar. Eine neue Art der Anpassung oder die Entwicklung einer neuen Eigenschaft, die eventuell in Zukunft erfolgreicher sein wird, als die alte Version. Der Wettbewerbscharakter der Evolution kommt jetzt noch stärker zum Tragen, denn immer mehr Wettkämpfer um Nahrung und Lebensraum treten an, immer mehr Lebensmöglichkeiten werden ausprobiert.
Der Prozess stabilisiert sich selbst, indem die gewinnbringenden Teile des Erbguts weitervererbt werden. Die Erfolglosen dagegen bleiben auf der Strecke, statistisch zumindest. Einzelfälle können in Nischen schon mal davonkommen, aber im Großen und Ganzen werden diejenigen, die am besten mit veränderten Umweltbedingungen klarkommen, am erfolgreichsten sein, was das Überleben ihrer Art anbelangt. Dieser Wettbewerb steckt in den Genen, nicht, weil die das wollen, sondern weil sie nicht anders können. Das gehört einfach zum Leben dazu.
Nun ist es raus. Tut mir leid, wenn es gerade ein bisschen philosophisch geworden ist, aber wir bekommen allein über die empirische Betrachtung nicht mehr Informationen.
Was haben wir vor uns? Wir sehen, es gibt Kausalitätsketten, elementare Bausteine, also zum Beispiel Zellen, die sich zu größeren Zellen aufbauen, und wir können schon absehen, dass sich die größeren Zellen zu komplexeren Lebewesen entwickeln werden. Dieses Prinzip läuft die ganze Zeit parallel zur Lebensgeschichte ab: Aus einfachen Bausteinen werden immer komplexere Systeme. Das ist so einfach und doch so wunderbar.
Auf der anderen Seite sehen wir, dass die Umweltbedingungen sich verändern, unter anderem durch den Aufbau von solch komplexen Lebewesen. Das wichtigste Beispiel hierfür war die Anreicherung der Atmosphäre mit Sauerstoff bis hin zur Ozonschicht. Immer deutlicher bildet sich eine Hierarchie heraus. Wir erkennen eine Strukturierung von unten nach oben und interessanterweise auch von oben nach unten. Die äußeren Bedingungen diktieren die Art des Überlebens. Ohne die entsprechenden Fähigkeiten verschwinden die Individuen und Spezies wieder. Der zeitliche Ablauf, das Hintereinander von Vorgängen und Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge führen automatisch zur Auswahl.
Erst kommt die Ursache, dann die Wirkung. Wenn die Umwelt sich verändert hat, müssen die Lebewesen sich anpassen. Gelingt ihnen das nicht, werden diese sich nicht mehr weiter vermehren können. Wie stark sie sich vermehren, hängt vom Erfolg ihrer Anpassung ab. Einige passen sich möglicherweise an, indem sie die fressen, die besonders erfolgreich sind. Aber auch diese Anpassung erfolgt erst hinterher. Selbst die Jäger können nur auf ihre Opfer reagieren. Einen Jäger kann es erst geben, wenn es ein Opfer gibt.
Hiermit geraten wir in eine Zwickmühle, die man auch das Henne-Ei-Problem nennt. Was war zuerst da? Die Henne? Oder das Ei? Es gibt eine Lösung, aber die ist nicht einfach: die Co-Evolution. Wenn Lebewesen mit unterschiedlichen Anpassungsstrategien zusammen in einer Umgebung leben, kann es passieren, dass das eine das andere auffrisst. Das führt möglicherweise dazu, dass es irgendwann kein Futter mehr hat. Was wiederum dazu führen kann, dass auch der Jäger ausstirbt. Oder aber die beiden kooperieren.
Kooperation ist ein ebenso wichtiges Prinzip der Evolution wie Wettbewerb. Hier geht es nicht um survival of the fittest. Es geht darum, sich gemeinsam die Möglichkeit zu verschaffen, dass es weitergehen kann. Evolution bedeutet, dass die gesamte Natur, Umwelt und Lebewesen, dynamisch so miteinander wechselwirken, dass das Leben weitergeht. Wenn einer alles auffrisst, ist das Spiel zu Ende. Co-Evolution ist eben genau das Gegenteil von survival of the fittest. Das System muss in einem dynamischen Gleichgewicht bleiben, nicht in einem stationären, denn das bedeutet das Ende. Ein Kristall ist im stationären Gleichgewicht, hart und unbeweglich – tote Materie.
Bei einem dynamischen Gleichgewicht kann sich das System weiterentwickeln, und zwar sowohl von unten nach oben, indem die Fähigkeiten zur Anpassung immer mehr und mehr verbessert werden, als auch von oben nach unten, indem die Veränderungen in der Umwelt den Veränderungen, die da unten stattfinden, gemäß sind.
Man stelle sich vor, unser Planet würde sich innerhalb von einer Stunde auf -100 °C abkühlen. Feierabend! Ende! Aber nicht für alle. Eine große Anzahl von Menschen und Lebewesen würde erfrieren und verhungern. Aber es gäbe Überlebende, auch unter uns Menschen. Wir hätten zwar jede Menge technische Probleme, könnten sie jedoch wahrscheinlich mit der Zeit meistern. Selbst auf drastische Veränderungen können Populationen wenigstens in Teilen reagieren. Irgendwie ist es ja offensichtlich über all die vergangenen Milliardenjahre weitergegangen.