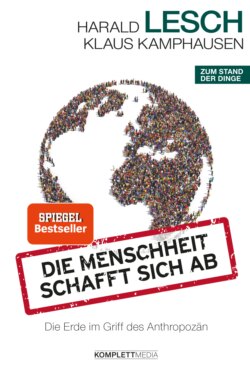Читать книгу Die Menschheit schafft sich ab - Harald Lesch - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKapitel 3
EIN WUNDERBARER STERN – EIN WUNDERBARER PLANET
Haben Sie sich schon mal überlegt, warum Sterne strahlen? Im Gegensatz zu Planeten, die von ihrer Sonne angestrahlt werden, leuchten Sterne selbst. Das tun sie, weil sie in ihrem Inneren Atomkerne miteinander verschmelzen. Aus dem leichtesten Element Wasserstoff wird Helium und daraus werden Kohlenstoff, Sauerstoff und Stickstoff und so weiter. Alle Elemente werden in Sternen erbrütet. Die Kraft, die den Reaktor antreibt, ist die Schwerkraft der eigenen Masse, sie hält den Stern als Gasball zusammen und sorgt für die gigantische Fusionsenergie.
Solange die frei werdende Energie den Schwerkraftdruck überwinden kann, strahlt der Stern. Wenn aber die Energiequelle im Inneren versiegt, der Fusionsprozess abreißt, dann bricht der Stern unter sich selbst zusammen. Bei einem solchen Kollaps wird so viel Energie in Form von Wärme frei, dass die Fusion weiterer, schwererer Atomkerne wieder in Gang kommt. Es entsteht sogar Gold und Uran. Schließlich trifft die kollabierende Sternenmasse in ihrem Innersten auf den Widerstand eines festen Kerns und wird von diesem wie von einem Trampolin zurück ins All geschleudert. So findet der Stern in Form einer Supernova sein furioses Ende: Er wird von einer Explosion zerrissen, durch die die schweren Elemente als Kondensationskeime für die Entstehung neuer Sterne und Planeten im Universum verteilt werden. Auf diese Weise sind bisher schon Hunderttausende, Abermillionen, vielleicht sogar Abermilliarden Planetensysteme in der Milchstraße und vielen anderen Galaxien entstanden.
NGC 3603
Der Nebel im Sternbild Kiel des Schiffs ist nur 22.000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Sterne zerbersten in Supernovas und blasen Gas und Staub ins All. Diese verdichten sich erneut, bis die Kernfusion wieder zündet und ein neuer Stern entsteht. So ist auch unsere Sonne entstanden.
Richten wir nun unser Augenmerk auf eines dieser Planetensysteme, unser eigenes kosmisches Zuhause im Schein unserer Sonne. Schon allein seine Entstehung ist eine schier unglaubliche Geschichte. Doch woher wissen wir, was damals passiert ist? Es war schließlich niemand dabei.
Wir begeben uns auf Spurensuche – im wahrsten Sinne des Wortes – und zwar auf die Spur der Steine. Bei der Recherche zur Entstehungsgeschichte unseres Sonnensystems können uns die Steine, die von damals übriggeblieben sind, die Meteoriten, sehr viel erzählen. Ausgehend von der universellen Gültigkeit der Naturgesetze und ihrer Naturkonstanten lässt sich von einem Meteoriten ablesen, wie er entstanden ist. Der Astrophysiker betätigt sich hier als Archäologe, eigentlich sogar als Forensiker, denn mit dem Stein hat er ein Indiz in der Hand, das ihm Aussagen über ein Geschehen erlaubt, welches etwa 4,5 Milliarden Jahre zurückliegt und ungefähr 750.000 bis 1,5 Millionen Jahre gedauert hat. Durch die Gesteinsanalyse erfahren wir, dass in der Nähe der Gaswolke, aus der irgendwann einmal das Sonnensystem werden sollte, ein Stern explodiert sein muss, und zwar bevor diese Gaswolke unter ihrem eigenen Gewicht kollabiert ist.
Durch die Explosion wurden seine chemischen Elemente in die Umgebung verteilt, wo sie später bei der Entstehung unseres Sonnensystems wieder Verwendung fanden. Aus der Häufigkeit und der Konzentration der in den Meteoriten enthaltenen Elemente können wir ablesen, dass der Stern, der damals explodierte, nur etwa ein knappes Lichtjahr von dem Ort entfernt gewesen sein kann, an dem die Meteoriten entstanden und dass dieser Stern etwa 25-mal so schwer war wie unsere Sonne.
Sie denken jetzt vielleicht, ob 25, 50 oder 200-mal so groß, das wäre egal. Von wegen! Die meisten Sterne in der Milchstraße sind ungefähr so schwer wie die Sonne. Der Durchschnittsstern in der Milchstraße hat 0,8 Sonnenmassen, somit liegt unsere Sonne also etwas über dem Durchschnitt. Aber warum gibt es nur so wenige schwerere Sterne? Ganz einfach: Je größer die Masse, umso größer der Druck auf den inneren Bereich des Sterns, wodurch wiederum die Verschmelzungsreaktionen der Atomkerne schneller ablaufen. Schwere Sterne zünden innerhalb weniger Millionen Jahre ihre gesamten Brennstufen, und am Ende explodieren sie.
Möglicherweise erhielt die Gaswolke damals durch den Beschuss mit Resten des Riesensterns sogar einen Drehimpuls. Dass sie sich gedreht haben muss, ist jedenfalls sicher, und damit auch der aus ihr entstandene neue Stern. Denn nur so konnten sich auf einer Gas-Staubscheibe in der Äquatorialebene des neuen Sterns Planeten bilden. Ohne einen Drehimpuls und damit die Fähigkeit, sich auf einer bestimmten Kreisbahn um die Sonne zu halten, wären die Planeten entweder in die Sonne gestürzt oder im Universum verschwunden.
Sie sehen, ohne Drehimpuls wäre es mit unserem Sonnensystem nichts geworden und damit auch nichts mit uns. Und schon wieder begegnet er uns, der glückliche Zufall, die perfekte Fügung, ohne die das Anthropozän niemals stattgefunden hätte.
Vor etwa 4,6 bis 4,7 Milliarden Jahren entstand also nun ein ganz besonderer Stern. Ein wunderbarer Stern, denn er war nicht zu groß und nicht zu klein, weder zu heiß, noch zu kalt. Er war genau richtig – der G-Stern, so kategorisieren ihn die Astrophysiker, G wie gut für das Leben.
UNSERE SONNE
Ein wunderbarer Stern, etwa 4,7 Milliarden Jahre alt. In etwa 8 Milliarden Jahren wird der Gelbe Zwerg zum Roten Riesen anwachsen. Spätestens dann wird auch das Anthropozän sein Ende finden.
Innerhalb kürzester Zeit bildeten sich in der ihn umgebenden Gas- und Staubwolke die ersten Planeten: die Gasriesen Jupiter und Saturn. Jupiter ist 317-mal so schwer wie die Erde und doppelt so schwer wie alle anderen Planeten zusammen. Und Saturn - das ist der Herr der Ringe.
Die beiden Riesen rieben sich am Gas und Staub der Scheibe, in der sie entstanden waren, was dazu führte, dass sie Bahndrehimpuls verloren und zunächst in Richtung Zentralgestirn drifteten. Durch einen interessanten Zufall jedoch veränderten sich später die Kräfteverhältnisse wieder, sodass Jupiter und Saturn wieder nach außen wanderten. Auf ihrer Reise mischten sie das sich bildende System von Asteroiden und Planeten kräftig durch.
Das junge Sonnensystem war ungefähr 5 Millionen Jahre alt, da bildeten sich die ersten Felsenplaneten aus kollidierenden Asteroiden. Nach circa weiteren 100 Millionen Jahren waren schließlich alle heutigen Planeten vorhanden. Einige unter ihnen waren so weit von der Sonne entfernt, dass sie gefrorenes Wasser besaßen. Durch den Tanz von Saturn und Jupiter wurden sie und ihre kostbare Fracht ins Innere des Sonnensystems geschleudert.
So kam vermutlich das Wasser auch auf den Mars, einen besonders rätselhaften Planeten. Über seine Herkunft ist man sich nicht einig. Manche Wissenschaftler halten ihn für einen entlaufenen Mond vom Jupiter, denn er ist mit nur zehn Prozent Erdmasse sehr leicht. Bis heute ist nicht klar, wie dieses Leichtgewicht auf seinen Platz im Sonnensystem als äußerer Nachbar der Erde gelangen konnte.
Wir wissen heute, dass die Asteroiden jenseits der Mars-Bahn aus einer Trümmerwolke stammen, die offenbar durch Wechselwirkung mit den Gasplaneten, aber auch den beiden Eisriesen Neptun und Uranus, in arge Turbulenzen versetzt worden war. Viele der Trümmerteile sind später ins Innere des Sonnensystems eingedrungen und brachten den dort kreisenden Planeten einen Stoff mit, der für sie noch ganz wichtig werden sollte – Wasser.
Die Bildung von Felsenplaneten ist nach wie vor ein Rätsel. Ich hatte ja schon von der Theorie der zusammenstürzenden Asteroiden gesprochen, aber dafür hätte es zumindest einen Planetenkern gebraucht, der die Asteroiden anzieht. Bis der gebildet ist, vergeht sehr, sehr viel Zeit, schließlich stoßen im Inneren des sich gerade bildenden Sonnensystems anfänglich nur Staubteilchen zusammen, Staubflusen, wirklich nicht mehr als das, was Sie bei sich Zuhause vorfinden, wenn Sie längere Zeit nicht Staub gesaugt haben.
Ja, Flusen waren die Keime, aus denen die Planeten wuchsen. Die haben sich verhakt, verknotet und zusammengepresst, so dass Bröckchen und Brocken daraus wurden, etwa in der Größe von Eigenheimen. Diese sind dann mit Geschwindigkeiten von einigen Kilometern pro Sekunde zusammengestoßen und haben sich wiederum verbunden und vergrößert. Während weiter draußen in der Gasscheibe die Gasplaneten schon längst fertig waren, wuchsen im Inneren des Sonnensystems vier felsenartige Planeten heran. Ganz innen: Merkur. Der arme Kerl ist der Sonne so nah, dass die Gezeitenkraft ihn in seiner Eigenrotation so abbremst, bis er der Sonne immer nur dieselbe Seite zeigen kann.
Die Nummer zwei: Venus. Sie ist fast so schwer wie die Erde, trotzdem hat sie sich ganz anders entwickelt. Man dachte bis weit in die Sechzigerjahre hinein, dass sich unter der undurchdringlichen Wolkendecke der Venus vielleicht Venusianerinnen und Venusianer vergnügen – deswegen nennen sie manche auch den Planeten der Liebe. Aber dann nahmen russische Venussonden mit ihren Messungen der ganzen Romanze ihren Charme. Auf der Oberfläche der Venus herrscht ein Druck von 95 Atmosphären und eine Temperatur von rund 450 Grad Celsius. Selbst die sehr robuste sowjetische Technik gab nach wenigen Minuten ihren Geist auf.
Der dritte Felsenplanet ist unsere Erde. Und noch eine Bahn weiter draußen: der Mars. Die vier Planeten entstanden genau in dieser Reihenfolge.
Noch weiter draußen ziehen heute die Gas- und Eisriesen ihre Bahnen. Ihre Schwerkraftwirkung sorgt übrigens für den angenehmen Effekt, dass viele Asteroiden nicht ins Innere unseres Sonnensystems eindringen können. Ohne den Jupiter würde auf unserem Planeten durchschnittlich alle 100.000 Jahre ein kilometergroßer Brocken einschlagen, dank ihm passiert es nur alle 50 Millionen Jahre. Wie unerquicklich ein solches Ereignis sein kann, ist seit 65 Millionen Jahren bekannt. Damals waren die Dinosaurier die Leidtragenden – sie starben aus.
UNSER SONNENSYSTEM
Der dritte Planet, beschützt vom großen Jupiter, zur Ruhe gebracht durch seinen Mond und in idealer Entfernung zur Sonne.
Kleine Randbemerkung in eigener Sache: Man sollte, nein, man muss unbedingt die bemannte Raumfahrt weiterbetreiben, und zwar in noch größerem Ausmaß als bisher. Warum ist das so wichtig? Wegen der Gefahr eines Asteroiden-Einschlags. Ein kilometergroßer, kosmischer Brocken würde der Menschheit ein abruptes Ende bescheren. Extrapolieren wir ganz einfach von der Vergangenheit in die Zukunft. Es ist nicht die Frage, ob es passiert, sondern nur noch wann – und dann sollten wir vorbereitet sein. Es ist von existenziellem Vorteil, unsere Aktivitätszone weiter ins Weltall hinauszuschieben, damit wir kosmische Eindringlinge früh genug identifizieren und bekämpfen können. Automaten können das nicht, nur Routine ist automatisierbar. Die Annäherung eines Impaktors ist aber keine Routine – und wird hoffentlich auch keine werden. Wir müssen Menschen draußen vor Ort haben, die Asteroiden aus der Bahn lenken oder zerstören können.
Wir haben also ein Sonnensystem, das sich im Laufe von 100 Millionen Jahren gebildet hat. Neben der Erde gibt es noch weitere Felsenplaneten und auch felsige Monde von Gasplaneten. Alle Planeten bewegen sich auf fast kreisrunden Bahnen um die Sonne. Das macht ihre Bahnen so stabil. Bewegten sie sich deutlich elliptisch durch das Sonnensystem, würden sie so stark abgelenkt, dass sie früher oder später entweder in die Sonne fallen, mit anderen Planeten zusammenstoßen oder aus dem Planetensystem herauskatapultiert würden.
Gleichwohl ist unser System äußerst labil, anfällig, ja geradezu empfindlich. Eine größere Störung durch einen von außen in das System eindringenden Körper würde sofort dazu führen, dass die inneren Planeten aus ihren Bahnen geworfen würden. Das hätte katastrophale Folgen, die selbst durch bemannte Weltraumfahrt nicht zu verhindern wären. Dann gehen wir eben tatsächlich in die Geschichte ein. Nur wer wird sie schreiben?
Da es die Erde aber immer noch gibt – seit 4,567 Milliarden Jahren – muss das System ganz offensichtlich über eine gewisse Stabilität verfügen, und zwar allein dadurch, dass in unserem Teil der Milchstraße keine ausreichend starken Störungen vorkommen. Kein Stern ist in geringer Entfernung an uns vorbeigeflogen, keine Sternleiche, keine Schwarzen Löcher, keine Neutronensterne, nichts. Wir leben in einem Teil der Milchstraße, in dem nichts los ist. Schon wieder ein bedeutsamer Glücksfall!
Die Erde unterscheidet sich von allen anderen Planeten, obwohl die inneren vier Exemplare sogar als erdähnliche Planeten bezeichnet werden. Dabei ist der am wenigsten erdähnliche Planet die Erde selbst, denn wir haben Wasser. Und einen Mond. Und was für einen! Wie kommt denn der da hin? Und das Wasser, ist das schon immer auf der Erde gewesen? Auch diese Geschichten sind unglaublich.
In der Frühphase des Sonnensystems war es in der Entfernung der heutigen Erdbahn viel zu heiß. Der Planet Erde, der sich dort bildete, war trocken. Wie bereits erwähnt, wurde das Wasser von kosmischen Lieferanten, den Asteroiden, eingetragen, deren Ursprung irgendwo zwischen Mars und Jupiter zu vermuten ist.
Wieso können wir so etwas behaupten, es war doch niemand dabei? Weil, ich kann es gar nicht oft genug betonen, die Naturgesetze, die wir auf der Erde kennen, immer und überall im Universum gelten. Und deshalb wissen wir, dass es von einem chemischen Element verschiedene Isotope gibt. Das sind Atomkerne mit der gleichen Zahl von Protonen, aber unterschiedlich vielen, elektrisch neutralen Neutronen. In besonderen Steinmeteoriten, den sogenannten kohligen Chondriten, finden wir die gleiche Isotopenzusammensetzung wie in unserem Wasser auf der Erde. Das beweist, dass das Wasser von Asteroiden auf unseren Planeten gebracht wurde.
Trotz der hohen Temperatur konnte die Erde das Wasser mit ihrer Schwerkraft festhalten, zunächst als Wasserdampf und später, als sie sich immer weiter an ihrer Oberfläche abkühlte, als flüssiges Wasser. Denn es fing an zu regnen und viel atmosphärischer Kohlenstoff, vor allem in der Form von Kohlendioxid, wurde vom Regen ausgewaschen und in den Meeren als Kalkgestein versenkt.
Auf der Venus hat es noch nie große Mengen Wasser gegeben. Ihre Atmosphäre enthält noch heute fast 98 Prozent Kohlendioxid. Damit ist ein gewaltiger Treibhauseffekt verbunden, der die Venus auf 450 Grad Celsius eingefroren hat. Plus, versteht sich.
Auf unserer Suche nach erdähnlichen Planeten ist uns bis jetzt noch keiner begegnet, auf dem flüssiges Wasser nachweisbar gewesen wäre. Auch in dieser Hinsicht sind wir auf der Erde wieder richtige Glückspilze. Alles Süß- und Salzwasser zusammen ergäbe übrigens eine Kugel mit einem Radius von 700 Kilometern (siehe Seite 287). Gar nicht so viel, oder? Aber für die Entstehung des Lebens hat es allemal gereicht.
Auch unser Mond kann eine großartige Geschichte erzählen. Eigentlich steht er uns dienstgradmäßig gar nicht zu, sondern gebührt eher einem großen Planeten wie dem Jupiter, dessen Schwerkraft in der Lage ist, ausreichend Material anzuziehen. Aber unsere kleine Erde, wie kommt die zu so einem Riesen-Mond?
Da kursieren noch immer die tollsten Theorien: Die Erde hat ihn eingefangen oder, auch ein schönes Szenario, sie hat sich so schnell gedreht, dass er sich wie ein Tropfen herausgelöst hat. Das ist alles ziemlicher Blödsinn.
Man weiß aus Analysen von Mondgestein (ja, die Amerikaner sind wirklich auf dem Mond gelandet), dass unser Satellit genau wie das Erdmantelgestein, aber ohne seine flüchtigen Elemente, aufgebaut ist. Ohne flüchtige Elemente? Auf was könnte das hindeuten? Genau, auf sehr hohe Temperaturen, bei denen sich gewisse Elemente in Gas auflösen. Der Mond ist also unter sehr großer Hitze entstanden.
Man weiß heute, dass er durch den Einschlag eines Impaktors auf die Ur-Erde entstanden ist, der mindestens doppelt so schwer wie der Mars, vielleicht sogar drei- oder viermal so schwer gewesen sein muss. Seine enorme Einschlagskraft führte nicht nur zur Aufschmelzung von Erdgestein, sondern sprengte auch einen riesigen Gesteinsbrocken von unserem Planeten ab, der einige 10.000 Kilometer weit weg katapultiert wurde.
Ein erheblicher Teil des Einschlägers sank ins Erdinnere ab und ist dort bis heute für die hohe Temperatur verantwortlich, die nicht nur die Lithosphären-Platten in Bewegung hält, sondern für uns heute auch eine beachtliche Energiequelle darstellt: die Erdwärme.
Ohne diese zusätzliche Heizung wäre es auf unserer Erde viel kälter und die Plattenbewegungen würden deutlich geringer ausfallen. Davon wird später noch die Rede sein, wenn wir über die große Transformation toter Materie reden.
Aber erst mal zurück zum Mond. Durch die Wechselwirkung zwischen ihm und der Erde hat sich die Rotation beider Körper völlig verändert. Während sich die mondlose Erde in zwei bis drei, vielleicht vier bis fünf Stunden um die eigene Achse gedreht hat, wurde sie durch den Satelliten an ihrer Seite auf die heutigen 24 Stunden heruntergebremst. Erde und Mond halten sich gegenseitig derart fest, dass der Trabant der Erde von Anfang an immer die gleiche Seite zeigt – wir nennen das eine gebundene Rotation.
Stellen Sie sich mal vor, die Erde würde sich heute noch in nur wenigen Stunden um die eigene Achse drehen – was hätten wir hier für ein Sauwetter! Tornados wären der Normalfall. Und eventuelle Lebewesen bekämen unentwegt Wind von vorn, die wären in jeder Hinsicht sehr flach und müssten die Ohren anlegen.
Und noch ein weiterer, aus heutiger Sicht äußerst segensreicher Effekt geht auf das Konto des Erdtrabanten. Schon seit der erdgeschichtlichen Frühphase verursacht der Mond ein rhythmisches Hin- und Herschwappen des Wassers auf dem blauen Planeten. Ja, da kommt Bewegung in die Ursuppe!
Sie müssen jetzt nicht anfangen zu schunkeln, aber wir können mit Fug und Recht ein Hohelied auf einen ganz besonderen Planeten unter unzähligen, unwirtlichen anderen singen, der nicht nur Wasser, die richtige Atmosphäre und die richtige Temperatur hat, sondern sich auch noch in der richtigen Art und Weise um sich selbst dreht. Kurzum, der Planet hat alles, um auf ihm tagtäglich das große Fest des Lebens zu feiern.
Dieses Fest hat vor vier Milliarden Jahren begonnen. Alles fing damit an, dass Moleküle das getan haben, was Moleküle hauptamtlich so tun: Man schaut mal, ob man sich mit jemandem verbinden kann.