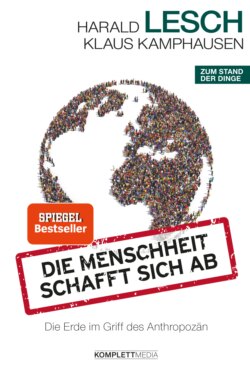Читать книгу Die Menschheit schafft sich ab - Harald Lesch - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKapitel 11
MENSCHWERDUNG
Begeben wir uns in die Zeit vor 10 bis 20 Millionen Jahren, als die Klimaveränderung in vollem Gange war. Noch gibt es keinerlei Anzeichen für hominide Kreaturen. Aber den Säugetieren geht es bestens. Sogar für die noch kommenden drastischen Umweltveränderungen sind sie gut gerüstet, denn sie verfügen über einen Stoffwechsel und damit über einen Wärmehaushalt.
Jetzt könnte man denken, die Lebewesen sind erfolgreich wegen der Eigenschaften, die sie entwickelt haben und die sie über das Erbgut an ihre Nachfahren weitergeben. Das stimmt natürlich, aber es reicht nicht ganz als Erklärung für den Mechanismus einer erfolgreichen Anpassung, denn auf diesem Weg verliefe die Anpassung wesentlich langsamer, als wir sie in der Natur zum Teil beobachten. Sie wäre für die Plötzlichkeit vieler Naturereignisse viel zu langsam, tödlich langsam.
Erfreulicherweise gibt es die Epigenetik, über die sich erfolgreiche Eigenschaften eines Individuums von einer Generation zur anderen vererben und allmählich auch im Erbgut der DNA niederschlagen. Die Epigenetik ist die Art und Weise, wie die Gensequenzen abgelesen werden, wie die Proteine aufgebaut werden. Letztlich entscheidet das darüber, wie unser gesamter Körper funktioniert. Unser Erbgut ist die zentrale Bibliothek, in der die Informationen über uns gespeichert sind. Diese Bibliothek verändert sich im Laufe von Generationen.
Wenn eine Gruppe von Lebewesen durch Veränderungen der Umwelt selbst neue Eigenschaften entwickelt – zum Beispiel wegen einer Klimaveränderung, ausgelöst durch den aufdringlichen indischen Subkontinent –, dann wird sich eine ganze Gattung möglicherweise darauf einstellen. Genauso ist es bei den Primaten passiert. Es gibt Ereignisse in den letzten 25 Millionen Jahren, bei denen sich die Primatenfamilie immer weiter unterteilt hat.
Da gab es zunächst einmal die Menschenartigen und die Meerkatzenartigen. Erstere haben sich in asiatische und afrikanische aufgeteilt. Zur asiatischen Variante gehört zum Beispiel der Orang-Utan. Zum afrikanischen Zweig gehören viele, uns heute bekannte Familien: Gorilla, Schimpanse und … genau, der Homo sapiens.
Die Geschichte der Menschheit hat mit der Trennung der Gattung der Hominini von den Schimpansen begonnen, also vor – über den Daumen gepeilt – sechs Millionen Jahren (cum grano salis, also mit einer Toleranz von ungefähr einer Million Jahren rauf und runter. Denn die Gelehrten und diejenigen, die vor Ort in Afrika die Funde machen, die sind sich da noch nicht so sicher). Dann kommen die Australopithecinen, das sind die ganz frühen Menschen. Dann kommt der Homo habilis, der Homo erectus, der Homo neanderthalensis und der Homo sapiens.
Wieso Afrika, wieso der ostafrikanische Grabenbruch, wieso stand ausgerechnet hier die Wiege des Menschen? Nun, wenn sich das Klima dort änderte, setzte sich innerhalb dieser Gattung der Hominini eine bestimmte Art durch, die besonders gut an das neue Klima angepasst war.
Was ändert sich, wenn es großräumig trockener wird? Während vorher die Bedingungen für die Vegetation mit Wärme und Feuchtigkeit optimal waren, wurde es nun kälter und trockener.
In diesem Zusammenhang hat der Biologe, Zoologe, Evolutionsforscher und Ökologe Josef Reichholf den Satz geprägt: Der kurzsichtige Affe ist nicht unser Vorfahre. Damit bezieht er sich auf die größeren Lücken in der Waldlandschaft, von Regenwald konnte schon gar keine Rede mehr sein. Stellen Sie sich mal vor, wie ein Affe versucht, von einem Baum zum anderen zu springen. Entweder ist der Arm zu kurz oder der Baum zu weit weg oder der Affe ist einfach nur kurzsichtig, jedenfalls springt er ein allerletztes Mal … daneben. Seiner Fortpflanzung ist das nicht zugutegekommen.
Stammbaum des Homo sapiens
Das ist praktische Evolutionstheorie in einen Witz gepackt.
Mit zunehmender Trockenheit breiteten sich Savannen und Steppen aus. Wegen des Mangels an Bäumen mussten unsere Vorfahren runter auf den Boden, und so konnte aus einem geschickten Vierbeiner schon mal ein Zweibeiner werden. Denn der aufrechte Gang im hohen Gras war von vielerlei Vorteil, vor allem Feinde und Beute ließen sich besser ausmachen. Schließlich konnte man sich in der Savanne nicht mehr so gut verstecken wie im Regenwald.
Eine weitere Folge des Klimawandels betrifft die Veränderung der Nahrung. Wenn es trockener wird, wird die Nahrung härter. Ein kräftiges Gebiss wird zum anatomischen Vorteil, denn wer die harte Nuss knacken konnte, war der Sieger. Veränderungen der Umweltbedingungen führen automatisch zu Veränderungen der Lebewesen.
Selbstverständlich war auch die Entwicklung des Gehirnes davon betroffen. Das menschliche Großhirn ist ein Energiefresser schlechthin: 20 Prozent unseres Energiehaushalts werden von diesem 1,4 Kilogramm großen Erkenntnisapparat verheizt. Die Wärme muss abgeführt werden, damit die Denkzentrale nicht überhitzt. Und klar, der Abtransport von Wärme ist umso leichter, wenn es außerhalb etwas kühler ist. Die Gehirne von Primaten wurden also tatsächlich leistungsstärker, weil die Temperaturen sanken. Dazu müssen die Temperaturunterschiede gar nicht so groß gewesen sein.
Doch warum hat sich nur diese eine Primatenart zu einer besonders denkfähigen Variante entwickelt, was war der entscheidende Vorteil? Schließlich brachte die Klimaänderung allen Primatengehirnen eine bessere Kühlung. Offenbar gab es genetische Gründe, die unsere Vorfahren auszeichneten.
Allerdings sind solche Erklärungen immer schwierig, denn mittels der Evolutionstheorie können wir zwar hinterher erklären, warum eine Anpassung nicht mehr richtig funktioniert hat, aber die Vorhersagen fallen bei komplexen Lebewesen naturgemäß schwerer. In der Welt der Einzeller, der Bakterien, kann die Evolutionstheorie Vorhersagen zur vermutlichen Entwicklung machen. Bei Bakterienstämmen, die sich schnell reproduzieren, lassen sich Veränderungen schnell und direkt beobachten. Auch bei den Viren lassen sich evolutionäre Veränderungen mit einiger Sicherheit prognostizieren. Das nutzen wir heute bei Grippeschutzimpfungen aus. Bei komplexeren Lebewesen ist es jedoch nicht so einfach.
Wir können aber sicher sagen, unsere Vorgänger, die Australopithecinen, gehörten offensichtlich zu der Sorte von Säugetieren, die vor sechs Millionen Jahren, im Osten von Afrika, mit den sich verändernden Lebensbedingungen ziemlich gut umgehen konnten. Deshalb haben sie sich relativ schnell über den afrikanischen Kontinent verteilt. Es entwickelten sich der Homo habilis, der fähige Mensch, der Homo erectus und schließlich der Homo sapiens, der moderne Mensch.
Um das an dieser Stelle zusammenzufassen: Wir wissen, dass eine bestimmte Primatenart von Afrika ausgehend Teile der Welt schon vor 14 bis 17 Millionen Jahren bevölkert hat. Es kam zu drastischen, klimatischen Veränderungen, die viele Arten in allen Teilen der Welt vernichteten, weil sich die Lebewesen nicht anpassen konnten.
In Afrika kamen sie aber mit den klimatischen Veränderungen zurecht und sie starteten von dort ihre Reise um die Erde. Um einmal eine Zahl zu nennen: Von den Vorläufern der Art Homo sapiens gab es vor 1,2 Millionen Jahren im besten Fall gerade 20.000 Lebewesen auf der Erde. Man errechnet die Zahl der Individuen aus den Veränderungen des Erbgutes. Es ergab sich daraus das sehr bemerkenswerte Ergebnis, dass Menschen und Schimpansen sich nur um wenige Prozent genetisch unterscheiden.
Und wo unterscheiden sie sich im Erbgut am stärksten? Bei den Genen, die für die Entwicklung des Gehirnes verantwortlich sind. Bei der Leber oder beim Blut gibt es zwischen Schimpansen und Menschen kaum Unterschiede. Hier liegt also zumindest ein Grund für die besondere Reaktion des Primatenhirns unserer Vorfahren auf die zurückgehenden Temperaturen in Afrika. Und das passierte vor sechs Millionen Jahren.
Nachdem wir 13,82 Milliarden Jahre kosmischer Geschichte und Erdgeschichte an uns haben vorüberziehen lassen, sind wir endlich an diesem ganz wichtigen Abschnitt der natürlichen Evolution angekommen. Endlich tauchen die in der Erdgeschichte auf, die durch ihre Anpassungsfähigkeit an sich ständig verändernde Umweltbedingungen und durch ihr weiterentwickeltes Großhirn zum erfolgreichsten Lebewesen der letzten Jahrmillionen werden sollten. Die werden sich mit ihrem Denken und ihrem Daumen – da komme ich noch dazu – die Erde untertan machen. Die stehen fest auf zwei Beinen, haben zwei Hände zum Anpacken, kauen mit kräftigen Gebissen und verfügen auch sonst noch über Überlebensstrategien, die es ihnen sogar ermöglichen, ihre Umwelt so zu verändern, dass es für sie vorteilhaft wird.
Der Mensch macht sich die Erde untertan.