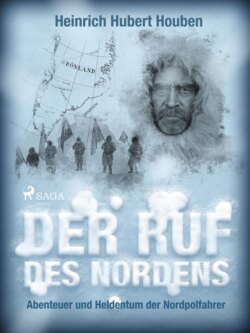Читать книгу Der Ruf des Nordens. Abenteuer und Heldentum der Nordpolfahrer - Heinrich Hubert Houben - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Apostel Grönlands
ОглавлениеDer große arktische Kontinent Grönland war den Walfischfängern im 16. und 17. Jahrhundert wohlbekannt; wenn das Eis es erlaubte, legten sie oft an seinen Küsten an, tauschten auch bei den Eskimos Seehundsfelle gegen Nadeln und Töpfe ein. Die Seefahrer, die den nordwestlichen Durchgang nach Indien suchten, Frobisher, Davis, Baffin und Hudson, kannten Grönlands Südspitze, auch Teile der Westküste. Politisch aber war es Niemandsland, als Handelsstation vergessen, und selbst die Kirche hatte ihr nördlichstes Bistum aufgegeben. Die alten Sagen aber lebten fort: von der grünen Insel, die ein Eiswall umgab, von den Normannen, die ehemals von dort auf ihren Wikingerschiffen die Meere durcheilt und Christen geworden waren, über die ein Bischof herrschte Von wilden Bewohnern, die in Fellbooten zwischen den Eisschollen umherflitzten, wußten die Walfischjäger genug zu erzählen; Christen aber waren sie da oben nie begegnet. War der Normannenstamm Eriks des Roten völlig ausgestorben und ausgerottet? Oder waren seine Nachkommen in Barbarei und Heidentum zurückgesunken und mit den Ureinwohnern verwildert? War es nicht Christenpflicht, ihre Spur zu suchen, ihnen aufs neue das Evangelium zu verkünden und sie in die Gemeinschaft der europäischen Kultur zurückzuführen?
Ein frommer lutherischer Pfarrer namens Hans Egede hing diesen Fragen nach und wurde darüber zum Missionar. In Norwegen 1686 geboren, studierte Egede in Kopenhagen Theologie; schon mit 21 Jahren war er Prediger auf den Lofoten, nördlichen Inseln seiner Heimat; er war Gatte einer tüchtigen Frau und Vater von vier Kindern. Dieses Stilleben befriedigte ihn nicht, er fühlte sich zu einer größeren Aufgabe berufen und verlangte, als Missionar nach Grönland zu gehen Der Bischof zuckte die Achseln — Missionen kosten Geld. Damals lag König Friedrich II. mit Karl XII. von Schweden im Kampf — für Kulturaufgaben blieb da nichts übrig Egede ließ sich nicht abschrecken; er gab 1718 seine Pfarre auf und suchte unternehmende Kaufleute, die sich an einer Expedition nach Grönland beteiligten. Als der Friede geschlossen war, gelang ihm in Bergen die Gründung einer „Gesellschaft für den grönländischen Handel“. Mit Unterstützung des Dänenkönigs, dem jetzt Norwegen wieder gehörte, wurde ein Segelschiff, die „Hoffnung“, ausgerüstet, und nach stürmischer Überfahrt betrat Egede mit seiner Familie und etlichen Landsleuten, die sich ihm angeschlossen hatten, die Westküste Grönlands. Seinen Landungsplatz nannte er „Godthaab“ (Gute Hoffnung); so heißt der Ort noch heute.
Leicht war aber an die „Wilden“ nicht heranzukommen. Zum Eintausch von Eisenwaren usw. waren ihnen die Grönlandfahrer oft willkommen gewesen; aber daß sich diese „Kablunaken“ (Hundesöhne) hier, wo sie nichts zu suchen hatten, niederließen, ein Haus bauten und sich auf eine Überwinterung einrichteten, machte die Eskimos doppelt mißtrauisch. Durch reiche Geschenke überwand Egede ihre anfängliche Furcht; neugierig und gutmütig, wie sie waren, halfen sie nun selbst beim Hausbau und freuten sich an den fremden Kindern; so kleine „Kablunaken“ hatten sie noch nie gesehen, denn die Walfischfänger waren durchweg vierschrötige, mürrische, oft hinterlistige, immer auf ihren Vorteil erpichte Kerle. Aber plötzlich war der ganze Eskimostamm verschwunden, seine Steinhütten bei Godthaab standen leer; auf Kajaks und Umiaks (Weiberbooten) war er mit Sack und Pack nordwärts gezogen, ohne Abschied zu nehmen, und die des Landesbrauchs unkundigen Kolonisten saßen gottverlassen da und gerieten in Not. Mehl und Grütze hatten sie aus der Heimat reichlich mitgebracht, für Fleisch aber sollte die Jagd sorgen, und nun waren die Eskimos allein in ihre ergiebigen Jagdgründe abgerückt, ohne sie den Norwegern zu verraten oder die Fremden zur Teilnahme einzuladen. Um seinen Leuten wenigstens einen Weihnachtsbraten zu verschaffen, sandte Egede einige Mann auf gut Glück nordwärts ins Innere des Landes. Ein Schneesturm überfiel sie, und sie hätten sich schwerlich zurückgefunden, hätten sie nicht zufällig ihre Eskimos wiedergetroffen. Obdach wurde nur widerwillig im Iglu, dem Schneehaus, gewährt, denn auf Gäste, die sich nicht zu helfen wissen, ist der Eskimo nicht eingerichtet; wer nicht für sich selbst sorgen kann, gefährdet in diesem schweren Kampf ums Dasein den andern, der sich seiner annimmt. Drei Tage dauerte der Schneesturm, und als er vorüber war, schieden die Fremden als gute Freunde von ihren Wirten; einer der Grönländer hieß Aroch, einer der Norweger Aron — der Zufall dieser Namensähnlichkeit hatte das Eis zwischen ihnen gebrochen. Verstehen konnte man einander nicht, aber man lachte über dieselben Dinge und kam sich so menschlich näher. Bald ließen sich die Grönländer wieder beim Stationshaus sehen, und Egede besuchte sie in ihrer Niederlassung, die 30 Hütten mit 150 Bewohnern umfaßte. „Infolge der stets brennenden Lampen“, berichtet er in seinem Tagebuch vom 21. Januar 1722, „war es in den Häusern zwar sehr warm, aber dafür herrschte ein für mich unerträglicher Gestank. Männer und Weiber waren fast nackend; sie trugen nur kleine Hosen, mit denen sie ihre Blöße notdürftig bedeckten. Sie lebten aber sehr friedlich und einträchtig miteinander und aßen alle gemeinsam. Der Umgang der Männer und Weiber miteinander war bei jung und alt züchtig und höflich. Beschwerlich wurden sie uns infolge ihrer Unreinlichkeit und des Gestankes, die von dem herumliegenden Speck und andern Dingen herrührten.“ Egede erzählt dann von einem „Affenspiel“, das er an diesem ersten Tag bei den Grönländern erlebte. „Als ich abends eben eingeschlafen war, wurde ich durch ein sonderbares Singen und Schreien wieder geweckt. Alle Lampen waren gelöscht, so daß es ganz dunkel war. Es war nun schauerlich zuzuhören, wie einer ihrer ‚Angekoke‘ oder Hexenmeister, der auf der Erde saß und auf einer Trommel spielte, mit einer abscheulichen Stimme bald leise, bald laut schrie, pfiff und plapperte. Hierauf zitterte er wie einer, der furchtsam oder erfroren ist und kaum reden kann. Als er aufhörte, sprachen alle Weibsleute in einem sachten, furchtsamen Tonfall, dann fingen sie wieder an zu singen ... Erst viel später, als ich mit ihnen gut bekannt war und ihre Sprache verstand, erfuhr ich, was dieses Affenspiel zu bedeuten hatte. Die Grönländer konnten es nämlich nicht verstehen, warum wir in ihr Land gekommen seien, und fürchteten sich vor uns. Deshalb mußten ihre Angekoke, ihre Weisen und Propheten, ihren ‚Torngarsuk‘, das ist der ‚Spiritus familiaris‘, fragen, was wir im Sinne hätten. Ob wir unsere Leute rächen wollten, die früher im Land gewohnt hätten und von ihren Vorfahren ermordet worden wären? Ihr Torngarsuk sollte uns an diesem Vorhaben hindern und bewirken, daß wir auf die eine oder andere Art verunglückten. Als ihre Angekoke merkten, daß wir ihnen nichts Böses taten, sagten sie von mir: ‚Der Priester ist selber ein Angekok‘, denn sie sahen, daß ich meinen Leuten predigte und ihnen zu befehlen hatte.“
Damit hatte Egedes friedliche und uneigennützige Eroberung Grönlands begonnen. Die Eskimos verkauften ihm Fische und lehrten seine Leute die Kunst des Fischfangs mit langen Schnüren aus Walroßhaut. Der freundschaftliche Verkehr blieb auch bestehen, als sie im Frühjahr auf die Seehundsjagd davonzogen; er dehnte sich, dank dem Wohlwollen der „Angekoke“, auf all die Nomadenstämme aus, die, je nach der Jahreszeit, sich in der Nähe des Stationshauses niederließen oder umherschweiften, um dem Walroß, den Robben oder dem Walfisch nachzustellen.
Das wichtigste Verständigungsmittel aber fehlte noch: die Kenntnis der Eskimosprache, und wie sollte Egede ohne sie diesen Heiden das Evangelium predigen? Er begann also ein systematisches Studium ihrer schweren Sprache; er legte sich ein Vokabularium an, und um schneller damit vorwärtszukommen, nahm er kleine Eskimos als Gespielen seiner Kinder ins Haus, sandte auch seine beiden Söhne von zehn und zwölf Jahren auf Wochen zu den neugewonnenen Freunden. Die Kinder verständigten sich am leichtesten; Vaters Vokabelschatz vermehrte sich so schnell, daß er schon im nächsten Jahr versuchen konnte, den zutraulichen Nachbarn, die sich um das Pfarrhaus angesiedelt hatten, einen Begriff vom Christentum beizubringen. Von Nachkommen der Normannen entdeckte aber Egede nichts; die noch lebendige Überlieferung, daß die Vorfahren seiner neuen Gemeinde vor Jahrhunderten die Reste der „Kablunaken“ in ihren Steinhäusern überfallen und niedergemacht hätten, mußte also wohl auf Wahrheit beruhen.
Die „Gesellschaft für den grönländischen Handel“ aber gedieh schlecht; sie löste sich 1726 auf. Die Eingeborenen litten selbst oft Hunger, wenn der Winter gar zu lang und die Jagd wenig ertragreich war; von ihnen war überhaupt wenig zu erhandeln, und in der Missionsstation ging es daher meist sehr knapp her; mit dem Zuschuß des Königs, 2000 Mark, war nicht viel auszurichten. Alljährlich brachte ein Regierungsschiff nur das Notwendigste, und zu Jagd und Fischerei wollten sich Egedes Leute nicht recht bequemen; sie waren faul und widersetzlich. Sträflinge und Soldaten, die der dänische König zur Ansiedlung herüberschickte, waren auch nicht die rechten Kulturpioniere. An einigen Stellen der Westküste, wo die Jagd ergiebig war, legte Egede Niederlassungen an, so auf der Insel Disko, wo der Trantierfang gute Ausbeute versprach. Er versuchte es sogar mit der Landwirtschaft; an dem Meerbusen Ameralik bei Godthaab säte er im Mai Korn und Rüben; aber die Ähren setzten keine Frucht an, und die Rüben wurden nicht größer als Radieschen. Das Innere Grönlands erwies sich als unzugängliches Eisgebiet, und an der Küste brachte der Sommer nur dürftige Weide für die Ziegen hervor. 1723 reiste Egede in zwei kleinen Schaluppen nach der Südspitze Grönlands und fand hier als Überreste der Normannenzeit Ruinen von Häusern und Kirchen, aber keine Menschen von europäischem Typus. Die dort wohnenden Eskimos kamen ihm erst feindlich entgegen; als sie aber von seinen Begleitern, ihren Landsleuten, hörten, wer er sei, waren sie bald gute Freunde, und sein Ansehen stieg zu dem eines Wundermanns, als er einen Augenkranken durch glückliche Behandlung vor Blindheit rettete. Als er abreiste, begleiteten ihn 40 Boote der Eingeborenen, und die Weiber sangen ihm zu Ehren. Gar zu gern wäre Egede auch nach der Ostküste vorgedrungen; aber der Sommer war zu kurz, und dorthin wollte ihn niemand begleiten, denn da wohnten Menschenfresser, versicherten die Eskimos.
Die Christengemeinde Egedes vergrößerte sich schnell. Die einfachen Naturkinder hörten es gar zu gern, wenn Egede ihnen von Christus erzählte, und wenn auch die heidnischen und christlichen Vorstellungen noch bunt durcheinander liefen, versicherten sie treuherzig, sie verständen ihn sehr gut, und er möge nur ja immer bei ihnen bleiben. Nicht selten brachten ihre kindlich naiven Fragen den Lehrer in nicht geringe Verlegenheit. Warum nur Gott einen Teufel geschaffen habe? meinten sie, der sei doch recht überflüssig; und wenn sie, denen Streit und Haß völlig unbekannt waren, die Unverträglichkeit der Kolonisten untereinander sahen, schüttelten sie den Kopf; diese Leute, erklärten sie, hätten offenbar vergessen, daß sie Menschen seien und nicht Hunde. Mit seinen Untergebenen hatte Egede dauernd seine liebe Not; 1729 kam es gar zu einer Meuterei, und das Pfarrhaus wurde zur Festung gegen seine eigenen Landsleute. Der Skorbut raffte viele der Ansiedler hin; nur wer sich zu den Eskimos in Pflege gab, wurde bei deren derber Fleischkost gesund. Als 1730 Christian VI. den dänischen Thron bestieg, hörte der Zuschuß aus der königlichen Schatulle zunächst auf; Egedes Kolonie war sich selbst überlassen. 1732 schleppte das Proviantschiff die schwarzen Pocken ein, und die Seuche hauste furchtbar unter den Eingeborenen. Gegen 2000 starben, obgleich Egede selbst, seine tapfere Frau und seine Töchter als Krankenpfleger Tag und Nacht furchtlos ihr Leben aufs Spiel setzten. Die schreckliche Heimsuchung weckte in den eben getauften Wilden rohe Instinkte des Aberglaubens: ein Vater, dem zwei Kinder gestorben waren, tötete seine Schwägerin, weil sie die Kleinen verhext habe. Ein Mord war unter den Eskimos etwas Unerhörtes und seit Menschengedenken nicht vorgekommen. Egedes ganzes Lebenswerk schien bedroht.
Da war es Graf Zinzendorf, der Begründer der Herrnhuter, der den König von Dänemark bestimmte, sich der Kolonie in Grönland aufs neue anzunehmen. Missionare der Herrnhuter wurden nach Godthaab gesandt; im nächsten Jahr kam Egedes Sohn Paul ebenfalls herüber als Gehilfe und baldiger Nachfolger seines Vaters. Im selben Jahr starb dessen treue Gefährtin, seine Frau Gertrud; die letzten schweren Jahre der Prüfung hatten ihn müde gemacht, auch die Zusammenarbeit mit den Herrnhutern ging nicht reibungslos vor sich. 1736 verließ Egede Godthaab und ging nach Kopenhagen, um von dort aus sein Werk fortzusetzen. Er begründete ein Seminar für Grönlandmissionare, an das ihm 1740 auch sein Sohn Paul folgte.
Egedes Name ist für alle Zeit mit dem Grönlands verknüpft als der eines Apostels, eines ehrlichen und selbstlosen Seelensuchers, dem die Religion nicht, wie leider so oft, nur Mittel zu recht irdischen Zwecken bedeutete. Er hat Grönland zum zweitenmal entdeckt und durch die Schilderung seiner Erlebnisse die erste genauere Kunde von der größten Insel der Erde und ihren Bewohnern gegeben. Sein Vokabularium vermittelte die erste Kenntnis der Eskimosprache. Egedes Sohn Paul schuf daraus 1760 eine grönländische Grammatik und vollendete auch die von seinem Vater begonnene Übersetzung des Neuen Testaments ins Grönländische. Die von Egede begründeten und benannten Ansiedelungen blühten auf und sind jetzt wertvoller dänischer Kolonialbesitz. Für die weitere Entdeckung der Arktis bildeten sie wichtige Stützpunkte, und von den erfolgreichsten Polarforschern haben die meisten ihr Gesellenstück durch eine Grönlandfahrt geleistet.