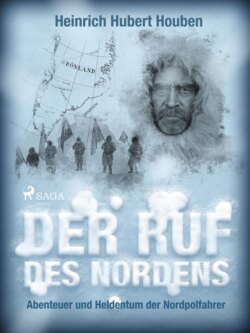Читать книгу Der Ruf des Nordens. Abenteuer und Heldentum der Nordpolfahrer - Heinrich Hubert Houben - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Ende der Welt
ОглавлениеWer war der erste Nordpolfahrer? Wer versuchte zum erstenmal, sich mit eigenen Augen vom „Ende der Welt“, an das man ehemals glaubte, zu überzeugen? Beide Fragen hängen aufs engste zusammen.
Die Kulturvölker des Altertums sahen sich mit der gespannten Aufmerksamkeit erster Entdecker in der Welt um; sie studierten ihre Nachbarn, Land und Volk, sie fragten, was hinter diesen wohne, und dann wieder dahinter nach Mitternacht, nach Norden. Die Irrfahrten des Helden Odysseus im 12. Jahrhundert v. Chr., die nicht über das Mittelländische Meer hinausgingen, lebten in Homers unsterblichen Gesängen fort und machten Schule; bald gab es eine Menge abenteuerlustiger Gesellen, die weit umherkamen und noch viel zahlreicherer Menschen „Städte gesehen und Sitte gelernt“ hatten; und wo ihre eigene Odyssee, ihr persönliches Erlebnis endete, wußten sie weitere Fragen vom Hörensagen zu beantworten und phantastisch auszuschmücken. Wahrheit und Dichtung verwuchs untrennbar ineinander. Griechenlands erster Geschichtschreiber, Herodot von Halikarnaß, erwähnt die Sage von den Hyperboräern, die über dem brausenden Boreas (dem Sturm) wohnen sollten; aber obwohl auch Homer davon erzählt, erscheint dem Historiker diese schon alte Tradition sehr verdächtig; ebenso die Sage von den Einäugigen, als deren Heimat ebenfalls der Norden galt. „Gibt es Menschen über dem Nordwind, so gibt es auch welche über dem Südwind“, erklärt Herodot; „es ist geradezu lächerlich,“ fügt er hinzu, „so oft man schon den Umkreis der Erde gezeichnet hat, noch keiner hat ihn mit rechtem Verstand dargestellt. Da malen sie den Ozean rings um die Erde fließend und die Erde kreisrund, wie mit dem Zirkel gezogen.“ Mit der alten Vorstellung von der festen Erdscheibe, die auf dem Okeanos, dem Meere, schwimme, konnte also auch er sich nicht mehr befreunden. Die Sage von den Hyperboräern, den „übernordischen Leuten“, erhielt sich aber trotz Herodot und lebte ein halbes Jahrtausend nach ihm bei den Römern wieder auf. Da oben im Norden sollte ein seliges Volk wohnen, dem die Sonne nur einmal auf- und untergehe und alle Früchte aufs schnellste reiften. In diesen alten Überlieferungen, deren Träger wir kaum ahnen können, steckt also immer ein Stück Wahrheit: man wußte damals schon von dem langen Tag und der ebenso langen Nacht im Norden.
Etwa 1000 Jahre v. Chr. kamen die Phönizier, das klassische Seefahrervolk des Altertums, schon hoch in den geheimnisvollen Norden hinauf; auf ihren ziemlich großen, kunstvoll gebauten und hochgeschnäbelten Ruderschiffen, die auch mit Mast und Segel versehen waren, gelangten sie bis zu den britischen Inseln. Dort erhandelten sie Zinn, und die hochentwickelte Kultur der Phönizier ist gewiß nicht ohne Einfluß auf die nordischen Barbaren, die keltischen Ureinwohner, geblieben. Auf den breiten Straßen der Flüsse drangen sie auch weit ins Innere Englands hinein.
Der erste indes, der eine regelrechte Entdeckungsfahrt nach dem Norden unternahm, war Pytheas aus Marsilia, dem heutigen Marseille. Er lebte zur Zeit Alexanders des Großen (4. Jahrhundert v. Chr.) und war, ebenso wie sein Zeitgenosse Aristoteles und andere, schon von der Kugelgestalt der Erde überzeugt. Wenn man Spitzen von Bergen, Türmen usw. aus der Ferne zuerst erblickte, mußte deren Grundlinie tiefer liegen als der Standpunkt des Beschauers. Diese Biegung der Erdoberfläche wollte er mit eigenen Augen beobachten und die „Steigung des Pols“ untersuchen. Pytheas war es, der zum erstenmal die „Sonnenhöhe“ eines Ortes feststellte, er ist jedenfalls auch der Erfinder der dazu nötigen nautischen Instrumente, ohne die — natürlich in ihrer unendlich vervollkommneten Gestalt — heute kein Schiff auch nur die kürzeste Seefahrt unternimmt. Seine Reise ins Blaue oder richtiger ins Dunkle hinein beschrieb er in einem Werk „Vom Ozean“, das nur in Bruchstücken erhalten ist; aber sie zeigen doch, mit welch geschultem, klarem Blick der alte Grieche die ihm so völlig neue Welt des Nordens mit ihrem Nebel, Schnee und Eis erfaßt hat. Ihm verdanken wir auch die erste geschichtliche Erwähnung der Germanen, von denen er Bernstein einhandelte.
Pytheas umschiffte zunächst das heutige Frankreich und kam zu den britischen Zinninseln. Er fand das Land feucht und eiskalt, doch schon ziemlich bevölkert. Darauf segelte er nach Island und Norwegen, berührte „wüste, dunkle Eilande“, die Orkney-Inseln, und kam nach den Shetlandinseln Foula und Unst, die er als das Land „Thule“ ausführlich beschreibt. Hier aber, angesichts der mit Eisschollen bedeckten dunklen Wasserwüste, glaubte er das Ende der Welt, das Ende alles festen Landes erreicht zu haben. Die keltischen Ureinwohner, die er da oben fand und mit denen er sich durch Dolmetscher zu verständigen wußte, versicherten ihm zwar, erst eine Tagereise jenseits Thules beginne das tote Meer, Marimarusa; damit meinten sie jedenfalls das ewige Eis. Für den Südländer, der kein Eis kannte, war aber schon das, was er hier sah, ein unheimlich seltsames Phänomen. Wo das Meer „dick geworden, geronnen“ sei, erklärte er, könne es kein Land mehr geben, auch kein Meer und keine Luft, sondern nur ein Gemisch von all diesem, so daß dort alles schwebe und niemand gehen oder fahren könne. Jedenfalls war er in dichten Nebel, Sturm und heftiges Schneegestöber geraten; dieses Toben der Elemente schien ihm alles Feste aufzulösen. Hier war daher für ihn das Ende der Welt, und weiter getraute er sich nicht. Auf der Rückfahrt kam er in die Nordsee, wahrscheinlich bis zur Elbmündung, und hier war es, wo er ein neues Volk kennenlernte, die Teutonen, unsere Vorfahren. Kehrte Pytheas auch auf halbem Wege um, so ist doch seine Entdeckungsreise die größte und bewundernswerteste des Altertums; kein Grieche oder Römer hat sich je so weit in den Norden vorgewagt.
Erst lange nach Christi Geburt kamen Nordpolfahrten aufs neue wieder auf. Die Irländer, die Bewohner der britischen Inseln, waren schon im 3. Jahrhundert Christen geworden, wenn auch der heilige Patrick, ein vom römischen Bischof ausgesandter Gallier, erst um 490 das dortige Bekehrungswerk vollendete. Die Kultur des Landes hatte sich dadurch früh gehoben. Die Klöster waren auch hier der Sitz der Gelehrsamkeit, und die irischen Mönche studierten mit Eifer die Schriften der Alten; einer dieser Mönche namens Dicuil sprach um 825 von der Kugelgestalt der Erde als einer feststehenden Tatsache. Er berichtet auch von den nördlichen Inseln, die man bei günstigem Wind in zwei Tagen und Nächten erreichen könne; seit lange schon wohnten dort fromme Eremiten, die von Schafzucht und Fischfang lebten, aber von den kriegerischen Normannen viel zu leiden hätten. Dicuil meint damit wohl die Inselgruppe der Faröer (Far = Schaf, Oe = Insel). Durch alte Ortsnamen wie „Papas“ oder „Papil“ ist die Anwesenheit solcher frommen Väter auf diesen Inseln sprachlich beglaubigt; auch auf Island lassen sich Spuren alter Eremitenbesiedelung nachweisen.
In der Erzählung Dicuils begegnen uns zum erstenmal die Normannen, die verwegenen Seefahrer des Nordens Ihre hochgebordeten Schiffe durchkreuzten auf Kriegs- und Beutefahrten furchtlos die Meere; Kompaß und dergleichen kannten sie nicht, aber sie beobachteten Wetter und Gestirne und gewannen dadurch so viel meteorologische Erfahrung, daß sie es wagen konnten, allen Launen der offenen See Trotz zu bieten. Suchten sie Land, dann ließen sie einen Raben in die Luft steigen, einen von Odins heiligen Vögeln, die sie an Bord hielten, und warteten, wohin er fliegen würde: dort war sicher Land — oft genug neues, ganz unbekanntes Land, wo reiche Beute winkte. Im 9. Jahrhundert waren die Wikingerzüge besonders häufig und für die ganze Umwelt eine gefährliche Plage. Zur Winterszeit saßen diese Räuberhorden auf der nordischen Halbinsel, in Schweden und Norwegen, als freie Männer in der Mitte ihres Weidelandes, jeder für sich ein König. Mit dem Christentum durfte man ihnen nicht kommen; schon daß sich in ihrer Gemeinschaft selbst aus den Geschlechtsältesten, die im Thing Recht sprachen, eine Art Königtum entwickelte, wurde der jüngeren Generation in ihrem unbändigen Freiheitsdrang unerträglich. Sie begann auszuwandern und in einer unbekannten Welt ihr Heil zu suchen. So kamen Normannenheere nach der Normandie, die noch heute ihren Namen trägt, dann zur spanischen und italienischen Halbinsel. Andere Scharen, die im Norden blieben, verjagten die heiligen Väter von den dortigen Inseln und setzten sich hier fest. Der Normanne Ottar segelte bis ins Weiße Meer und brachte die erste Kunde von den Lappländern heim. Der Seeräuber Floki geriet nach Island, dem Eisland. Andere, die sich dem heimatlichen Regiment nicht beugen wollten, wurden auf ihren Schiffen nach den nordamerikanischen Inseln und nach Labrador verschlagen und entdeckten Amerika ein paar Jahrhunderte vor Kolumbus. Die nordischen Sagas und die Edda sind voll von diesen Heldentaten der Wikinger, die nichts weiter als verwegene Banditen waren, aber immerhin das „Ende der Welt“ schon um ein gut Stück weiter steckten als der alte Grieche Pytheas.