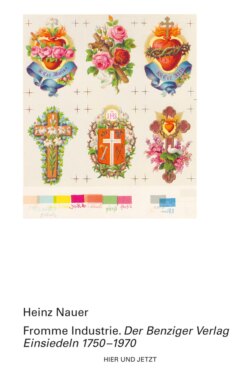Читать книгу Fromme Industrie - Heinz Nauer - Страница 31
Topografie der Verlagstätigkeit
ОглавлениеEinen Einblick in die Topografie der Geschäftstätigkeit ermöglichen die zahlreich überlieferten Korrespondenzbücher des Verlags. Exemplarisch soll im Folgenden die Korrespondenz anhand eines dieser Bücher ausgewertet werden. Es handelt sich um den Band «Allgemeine Correspondenz», der Abschriften von insgesamt 1154 Briefen enthält, die zwischen November 1876 und April 1877 verfasst wurden (Karte 1, S. 367).225
Die internationale Ausrichtung der Firma wird schnell sichtbar. Zwar korrespondierte sie im genannten Zeitraum auch regelmässig mit Personen im lokalen Umfeld sowie in Zürich und – etwas weniger intensiv – an anderen Orten der Deutschschweiz wie Basel und St.Gallen, der Schweizer Binnenraum als Ganzes spielte für die Firma aber eine untergeordnete Rolle. Weniger als ein Viertel aller Briefe im gewählten Zeitraum gelangte an Adressaten in der Deutschschweiz (275), eine vernachlässigbar kleine Zahl von Briefen ging in die französisch- und italienischsprachigen Schweiz (11).226
Beinahe fünfzig Prozent der Briefe unserer Auswahl schickte die Firma Benziger nach Deutschland, rund dreizehn Prozent an Empfänger in Frankreich, rund sechs Prozent gelangten nach Österreich, je rund zwei Prozent nach England und Italien sowie in weitere Länder insbesondere im osteuropäischen Raum.227 Innerhalb Deutschlands schickte die Firma Benziger die meisten Briefe an Adressaten in Leipzig, München und Stuttgart. In der Buchhandelsstadt Leipzig gingen die meisten Briefe an dort ansässige deutsche Verlage und Verleger: Brockhaus, Otto Spamer, Ernst Keil, Albert Henry Payne, Velhagen & Klasing, E. A. Seemann, B. G. Teubner und andere. In München gehörten vor allem Maler, Zeichner sowie Kupferstecher und Lithographen zu den Adressaten, darunter auch bekannte Namen wie Georg Hahn (1841–1889), Heinrich Merté (1838–1917) oder Adrian Schleich (1812–1894). Auch mit Johann Baptist Obernetter (1840–1887), dem Erfinder des chemischen Lichtdruckverfahrens, wurde eine recht intensive Korrespondenz geführt. In Stuttgart gehörten Eduard Hallberger (1822–1880), der Verleger der auflagenstarken Unterhaltungszeitschrift «Ueber Land und Meer» (ab 1858), der Allgaier & Siegle-Verlag sowie einige Illustratoren und Holzstichmacher zu den häufigsten Adressaten. Die Korrespondenz mit Frankreich konzentrierte sich wenig überraschend in erster Linie auf Adressen in Paris, wo die Firma Benziger in dieser Zeit unter anderem mit den Verlagen Borrani und Didot sowie mit Charles Lorilleux, einem Fabrikanten von industriellen Druckfarben, in Kontakt stand. Daneben bestanden auch Kontakte mit dem katholischen Verleger Alfred Mame (1811–1893) in Tours.
Die Topografie der Verlagstätigkeit, wie sie auf der Karte aufscheint, zeigt freilich nur einen unvollständigen Ausschnitt. Die Korrespondenzen mit den Künstlern und Literaten beispielsweise wurden damals in separaten Büchern geführt und sind auf der Karte nicht verzeichnet. Auch nicht sichtbar werden der ganze nordamerikanische Raum, für den die Filialen in den USA zuständig waren, sowie die Beziehungen nach Südamerika: Dahin, vor allem nach Mexiko und Brasilien, exportierte der Verlag ab den 1860er-Jahren ebenfalls Verlagsware, vor allem Andachtsbilder.228
Gut ersichtlich wird hingegen die Bedeutung des deutschen Sprachraums. Gebetbücher, Kalender, Zeitschriften und Belletristik der Firma Benziger waren lange hauptsächlich auf eine deutsche Leserschaft ausgerichtet. «Im Deutschen liegt Ihre Kraft u. natürliche Stärke», schrieb der damals dienstälteste Associé Louis B.-Mächler (1840–1896) im Jahr 1893 von New York nach Einsiedeln und riet seinen jüngeren Kollegen, dem deutschen Sprachraum unbedingt die höchste Beachtung zu schenken.229 Sein Rat blieb mitten in einer Phase, in der die Firma Benziger ihren Bücherverlag konsequent internationalisierte, ungehört. Das Verlagsprogramm beinhaltete zwar schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts vereinzelt auch religiöse Literatur in Französisch, Italienisch und Lateinisch, und mit der Errichtung der Filialen in den USA wurden ab den späten 1850er-Jahren englischsprachige Bücher verlegt. Einen wirklichen Trend, den Bücherhandel stärker zu internationalisieren, gab es aber erst ab den späten 1880er-Jahren. Im Nachlassarchiv des Verlags sind Gebetbücher in mehr als zwanzig Sprachen überliefert, unter anderem in Spanisch (ab 1886) und Portugiesisch (ab 1892), Flämisch (ab 1891), Serbokroatisch (ab 1887) und Polnisch (ab 1891). Über die Missionen verbreiteten sich Bücher aus dem Benziger Verlag bis in periphere Regionen des Globus. Im Nachlassarchiv finden sich beispielsweise Gebetbücher in Swahili (1892), einer Bantusprache Ostafrikas, sowie in Quechua (1891), einer im Andenraum Südamerikas verbreiteten indigenen Sprachgruppe.