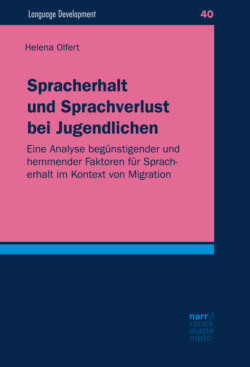Читать книгу Spracherhalt und Sprachverlust bei Jugendlichen - Helena Olfert - Страница 9
2 Spracherhalt und Sprachverlust in der Migrationssituation 2.1 Spracherhalt und Sprachprestige
ОглавлениеSpracherhalt und Sprachverlust im Kontext von Migration sind untrennbar mit gesellschaftlichen Strukturen verbunden. Will man also der Frage nachgehen, weshalb manche Sprachen in der Migrationssituation aufgegeben werden, während andere noch über Generationen hinweg gesprochen werden, erweist sich die Betrachtung sozialer Machtverhältnisse und historisch gewachsener Habitualisierungen als unerlässlich. Oftmals entscheiden sie darüber, welche Sprachen als nützlich und wertvoll angesehen werden, welche es sich zu lernen und zu erhalten lohnt und welche wiederum eine überflüssige Bürde darstellen, die es möglichst hinter sich zu lassen gilt. Dieser sozial konstruierte Bewertungsmaßstab für Sprachen kann aufgrund seiner symbolisch-hierarchischen Machtfunktion derart hohen Druck auf einen Sprecher aufbauen, dass dieser, rationaler Denkweise folgend, sich gegen das Festhalten an vermeintlichen sprachlichen Altlasten und für ein scheinbar schnelleres Vorankommen ohne eine nicht prestigeträchtige Sprache entscheidet bzw. sich zu dieser Entscheidung gedrängt sieht (vgl. Fishman 1991).
Wird Einsprachigkeit in der Mehrheitssprache gesellschaftlich als der natürliche Zustand angesehen, so bedarf der Erhalt einer Minderheitensprache seitens eines Individuums umso mehr Aufwand hinsichtlich Energie, Zeit und Rechtfertigung, da ihm eine entsprechende Unterstützung in Form von staatlich etablierten Strukturen und gesellschaftlicher Anerkennung nicht zur Verfügung steht (vgl. Herdina & Jessner 2002). Im Gegensatz dazu ist Unterstützung für die gesellschaftlich legitime Mehrheitssprache sichergestellt, da sie auf dem „sprachlichen Markt“ als Ressource fungiert, die in ökonomisches Kapital umgewandelt werden kann und somit sozialen Aufstieg und Bildungserfolg erst ermöglicht (vgl. Bourdieu 1991). Als Folge habitualisierter Bewertungsmechanismen zum einen und der Betrachtungsweise von Mehrsprachigkeit als nur einer Übergangsphase zum anderen können sich Individuen in der Migrationssituation dazu gezwungen sehen, ihre mitgebrachten Sprachen aufzugeben.
Der gesellschaftlich festgelegte Marktwert von Sprachen ist omnipräsent und lässt sich mittels eines hierarchisch geordneten Modells von De Swaan mit einem Kern und einer Peripherie beschreiben (vgl. De Swaan 2001; s. Abbildung 1). Die Position der jeweiligen Sprache in dem Modell symbolisiert gleichsam ihren kommunikativen Wert und ihr Prestige. So befinden sich nach der Analyse von De Swaan ca. 98 % aller derzeit weltweit gesprochenen Sprachen in der Peripherie des globalen Sprachsystems. Obwohl hierunter mehrere tausend Sprachen fallen, werden sie von nur ca. 10 % der Bevölkerung in sehr kleinen Sprechergruppen verwendet. In Abgrenzung zu den im Zentrum des Modells positionierten Sprachen werden periphere Sprachen ausschließlich über negative Attribute beschrieben: Sie verfügen über keinen schriftsprachlichen Ausbau, sind keine National- oder Amtssprachen und werden weder als Mutter- noch als Fremdsprachen unterrichtet. Ihre Sprecher sind zudem aufgrund der geringen Größe der eigenen Sprachgemeinschaft zu Kommunikationszwecken auf Kenntnisse anderer Sprachen angewiesen, sei es anderer ebenfalls peripherer Sprachen oder aber Sprachen mit einem höheren Kommunikationswert.
Abb. 1:
Struktur des globalen Sprachsystems nach De Swaan (2001), eigene Darstellung
Als zentrale Sprachen betrachtet De Swaan (2001: 4f.) ungefähr 100 Sprachen, die von etwa 95 % der Bevölkerung gesprochen werden. Diese Sprachen zeichnen sich durch eine Kodifizierung aus, d.h., sie verfügen über einen verbindlichen Standard. Dies ermöglicht wiederum ihre Einrichtung als Nationalsprachen, ihre Unterrichtung sowie ihre Verwendung in Medien, Verwaltung und Justiz. Sprecher zentraler Sprachen können monolingual sein, da ihre Sprache über genügend Kommunikationswert in ihrem Nationalstaat verfügt.
Superzentrale Sprachen erfüllen über die Funktionen als Staatssprachen hinaus weitere Aufgaben und gestatten u.a. internationale Kommunikation. Zu diesen Sprachen zählt De Swaan Arabisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Hindi, Japanisch, Malaiisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch und Swahili (vgl. ebd.: 5). Bis auf Swahili haben sie mehr als 100 Millionen Sprecher, die meisten fanden weltweite oder übernationale Verbreitung vor allem durch Kolonialisierung und Besetzung. Heutzutage dominieren sie nach wie vor das öffentliche Leben in den entsprechenden Staaten und schreiben somit die historisch gewachsenen sprachlichen Machtkonstellationen fort. Sie finden sich in höheren Bildungsinstitutionen, in der Wissenschaft, Politik, Technologie und Administration. Superzentrale Sprachen bilden ferner die typischerweise schulisch vermittelten Fremdsprachen in anderen Staaten.
Im Zentrum des gesamten Systems steht allerdings Englisch, das als hyperzentrale Sprache, als Lingua Franca, eine globale Kommunikation ermöglicht und in der Lage ist, Sprecher anderer Sprachen miteinander zu verbinden. Dies macht Englisch momentan zur Sprache mit dem größten Prestige weltweit.
Die hierarchische Anordnung von Sprachen hat einen starken Einfluss auf das Lernen von Sprachen, das stets zentripetal funktioniert, also von der Peripherie ins Zentrum, was zu einer steten Verfestigung dieser sprachlichen Hegemonie führt (vgl. De Swaan 2001: 5). Je zentraler sich eine Sprache im System befindet, desto mehr Sprecher (als Erst- oder Zweitsprache; L1 bzw. L2) lassen sich mit ihr erreichen, desto höher ist ihr Kommunikationswert und desto größer ihr Prestige. Das bedeutet, je höher das Prestige einer Sprache in der globalen Rangordnung ist, umso mehr wird ein Sprecher bereit sein, Zeit, Energie sowie monetäre oder andere Ressourcen in ihr Erlernen zu investieren.
Diese Prägung bzw. Überlagerung von Sprachlernentscheidungen durch Sprachprestige lässt sich mit einigen Modifikationen auf die Migrationssituation übertragen. In einem konkreten Kontext haben Migrantensprachen in der Diaspora wie Minderheitensprachen per se einen geringeren Kommunikationswert als die offizielle Nationalsprache des jeweiligen Staates. Belegt eine Minderheitensprache zusätzlich hierzu generell nur einen unteren Rang in dem globalen Sprachprestigegefüge und wurde sie auch im Herkunftsland der Sprecher als peripher angesehen, so sind der Wunsch und das Bestreben nach ihrem Erhalt in der Migrationssituation sogar für die Sprecher selbst nur schwer über rationale oder ökonomische Argumente zu begründen. Der Druck zu ihrer Aufgabe ist gesellschaftlich umso größer. Sprachverlust verläuft also in diesem Modell ebenfalls von außen nach innen, sodass diejenigen Sprachen am schnellsten und am häufigsten aufgegeben werden, die sich in der Peripherie befinden.
Das Modell von De Swaan (2001) zeigt zudem, dass Sprachprestige keine natürlich gewachsene Rangordnung von Sprachen ist, die auf objektiven Kriterien o.ä. basiert. Vielmehr ist Sprachprestige gesellschaftlichen Umbrüchen, sozialen Ordnungen sowie historischen Entwicklungen geschuldet und über längere Zeitperioden entstanden. Es ist eng verknüpft mit ökonomischen Vorteilen für die Sprecher und mit ihrer Positionierung im sozialen Raum, weshalb es nicht losgelöst von diesen Faktoren betrachtet werden kann (vgl. ebd.: 6). Sprachprestige durchzieht darüber hinaus die Bildungspolitik und äußert sich über die zentripetale Lernrichtung in gesetzlichen Bestimmungen europäischer Sprachenpolitik, in institutionell etablierten und geförderten Fremdsprachen sowie in den Einstellungen der Bevölkerung bestimmten Sprachen gegenüber.
Die Eurobarometer-Umfrage zu den in der EU gesprochenen Sprachen stellte beispielsweise fest, dass die offiziellen europäischen Bemühungen um eine m+2-Sprachenpolitik1 sich in erster Linie in einem Ausbau der Englischkenntnisse, also der hyperzentralen Sprache, niederschlagen (vgl. Europäische Kommission 2012). Diese Dominanz des Englischen reflektierend betitelt De Swaan das Kapitel zu europäischen Sprachverhältnissen in seiner Arbeit auch passenderweise mit „The European Union – The more languages, the more English“ (vgl. De Swaan 2001). Nach wie vor stellt Englisch gefolgt von Französisch und Deutsch die am häufigsten gelernte europäische Fremdsprache dar (vgl. Europäische Kommission 2012: 7). Zwei Drittel der europäischen Bürgerinnen und Bürger sind davon überzeugt, dass Englisch nach ihrer Landessprache die wichtigste Sprache sei (vgl. ebd.: 8). Minderheitensprachen – ob autochthone oder allochthone – werden in der Umfrage nicht thematisiert, was erneut ihre Stellung in der Peripherie der öffentlichen Wahrnehmung unterstreicht.
Eine repräsentative Umfrage zu Sprachprestige im deutschen Kontext, die auch Minderheitensprachen berücksichtigt, legten Gärtig und Kollegen vor (2010). Sie konnten die Ergebnisse der Eurobarometer-Studie bestätigen: Die deutsche Bevölkerung befürwortete stark das europäische Mehrsprachigkeitsziel (vgl. ebd.: 250) und bekräftigte, dass Englisch, Französisch und Spanisch in der Schule als Fremdsprachen gelehrt werden sollten. 7,5 % wünschten sich zudem, dass zukünftig Chinesisch an deutschen Schulen unterrichtet wird (vgl. ebd.: 250). Chinas Entwicklung zur global agierenden und aufstrebenden Nation steigerte also in den letzten Jahren stark den Kommunikationswert des Chinesischen und spiegelt sich bereits in einer wahrnehmbaren Erhöhung seines Prestiges wider. Gleichzeitig empfanden die Deutschen fremdsprachige Akzente oben genannter Sprachen sowie Sprachen beliebter angrenzender Urlaubsländer auf subjektiver Ebene als besonders schön (Französisch, Italienisch, Englisch, Spanisch). Gefragt nach den unangenehmsten Akzenten, wurde hingegen eine russisch-, türkisch- oder polnischgefärbte Aussprache genannt (vgl. ebd.: 244-247). Jeweils ein Drittel der Befragten gab an, Schwierigkeiten bei der Verständigung mit Migranten zu haben oder es nicht gutzuheißen, wenn diese in manchen Bereichen ausschließlich ihre Muttersprache verwendeten (vgl. ebd.: 236ff.). Auf der anderen Seite begrüßten über 80 % der Bevölkerung den Erhalt von autochthonen Minderheitensprachen in Deutschland.
Die Studie von Gärtig und Kollegen (2010) verdeutlicht zusätzlich zu einer ubiquitären Rangordnung unterschiedlicher Sprachen zwei weitere Punkte: Zum einen führt die große Befürwortung autochthoner Minderheitensprachen offenbar nicht dazu, dass auch deren Unterrichtung in der Schule gefordert wird. An dieser Stelle spielt sicherlich der Kommunikationswert dieser Sprachen abseits von ideellen Vorstellungen eine, wenn nicht sogar die entscheidende Rolle. Zum anderen ist ein hohes Prestige einer Sprache wie Russisch im globalen Sprachsystem noch kein Garant für ihre Akzeptanz. Dass Sprachprestige sogar top-down installiert werden kann und gesellschaftliche Machtverhältnisse noch lange nach einer Änderung dieser unmittelbar reflektiert, wird in der Studie gerade am Russischen deutlich. So sprachen sich noch zwanzig Jahre nach der Wiedervereinigung gut 40 % der Bevölkerung in den Bundesländern der ehemaligen DDR für Russisch als Fremdsprache in der Schule aus (vgl. ebd.: 251).
Eine von der deutschen Bevölkerung ausdrücklich verlangte Förderung erfahren die Sprachen von autochthonen, auf europäischem Territorium alteingesessenen Minderheiten offiziell in der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen (ECRM, vgl. Europarat 1992). Ihr Ziel ist der Erhalt und der Schutz dieser Sprachen, was insbesondere das Recht auf ihre institutionelle Verankerung im Bildungswesen umfasst. Aber auch ihre Verwendung in den Bereichen Medien, Justiz, Kultur und Verwaltung soll gesetzlich gestärkt und garantiert werden. Von diesem Schutz profitiert in Deutschland beispielsweise die dänischsprachige Minderheit in Schleswig-Holstein. Hier bestehen neben einem sehr gut ausgebauten Netz an bilingualen Programmen in Bildungseinrichtungen aller Stufen und Zweige rein dänischsprachige Schulen, zahlreiche sprachlich-kulturelle Angebote und Lerngelegenheiten für alle Altersgruppen (vgl. Andresen 1997: 96; Boysen 2011: 13). Diese geradezu mustergültige Unterstützung des Dänischen trägt entscheidend zu seiner Stärkung, Anerkennung und zu seinem Erhalt bei, sodass heutige Schätzungen von bis zu 50.000 aktiven Dänischsprechern in Schleswig-Holstein ausgehen (vgl. ebd.).2
Für die anderen autochthonen Minderheitensprachen auf deutschem Territorium, also Sorbisch, Nord- und Saterfriesisch, Niederdeutsch sowie Romanes, stellt sich die Lage trotz eines ebenfalls durch die ECRM garantierten Schutzes gänzlich anders dar. Im Gegensatz zu ihnen verfügt das Dänische nicht nur über einen schriftsprachlichen Standard, sondern auch über den Status als Nationalsprache des benachbarten Königreichs Dänemark, was es zu einer zentralen Sprache macht, ihm einen größeren Wert auf dem „sprachlichen Markt“ zuschreibt und sein Prestige erhöht (vgl. Maas 2008: 67). Hierdurch wird die Tradierung der Sprache an nachfolgende Generationen vereinfacht, ihre Verwendung als Medium der Bildung und Unterrichtskommunikation gerechtfertigt und der Spracherhalt erleichtert. Obwohl beispielsweise Sorbisch genauso über einen schriftsprachlichen Ausbau und bilinguale Bildungsangebote verfügt, bedarf es eines starken sprachpolitischen Engagements der Sprecher, um den Verlust dieser peripheren Sprache auf lange Sicht aufzuhalten (vgl. Bundesministerium des Innern 2015: 48) – für sie gibt es keinen „Markt“. An dieser Stelle wird bereits deutlich, welche Position Sprachprestige für den Erhalt oder Verlust von Sprachen in Minderheitenkonstellationen einnimmt, selbst wenn diese offiziell anerkannt und per Gesetz geschützt und gefördert werden. Dies gilt umso mehr für allochthone Sprachen von zugewanderten Minderheiten, die von dieser Förderung explizit ausgeschlossen sind.
Die an etablierten großen Nationalsprachen ausgerichtete europäische Sprachpolitik spiegelt sich ebenso in dem Fremdsprachenangebot an deutschen Schulen wider. Nicht nur die flächendeckende Einführung des Englischen3 ab Klasse 1, auch die Teilnehmerzahlen an in der Schule angebotenen modernen Fremdsprachen belegen diese implizite Rangordnung unterschiedlicher Sprachen (s. Tabelle 1). So lernte beispielsweise in dem Schuljahr 2015 / 2016 die größte Mehrheit der Schülerinnen und Schüler in Deutschland Englisch als Fremdsprache (87 %), mit weitem Abstand gefolgt von Französisch (18 %) und Spanisch (5 %). Der Anteil an erteiltem Unterricht in Russisch oder Türkisch, den größten allochthonen Sprachen in Deutschland, lag hingegen bei 1,3 % bzw. 0,6 %.
| Fremdsprache | TN gesamt | TN Grundschule | TN Gymnasium |
| Englisch | 7.221.431 | 1.725.656 | 2.264.245 |
| 86,6% | 23,9% | 31,4% | |
| Französisch | 1.495.193 | 96.695 | 908.808 |
| 17,9% | 6,5% | 60,8% | |
| Spanisch | 416.997 | 2.720 | 295.342 |
| 5,0% | 0,7% | 70,8% | |
| Russisch | 111.185 | 2.267 | 51.208 |
| 1,3% | 2,0% | 46,1% | |
| Türkisch | 50.862 | 28.823 | 2.827 |
| 0,6% | 56,7% | 5,6% |
Tab. 1:
Teilnehmer am Fremdsprachenunterricht im Schuljahr 2015 / 2016 im Vergleich (vgl. Statistisches Bundesamt 2017a)
Unter dem Aspekt der Schulformen betrachtet, lässt sich ebenfalls ein Ungleichgewicht zwischen den Sprachen erkennen. Während der Anstieg an Teilnehmern für die meisten angebotenen Fremdsprachen durch das Hinzukommen der zweiten und dritten Fremdsprache ab der Sekundarstufe I zu erklären ist, finden 56,7 % des Türkischunterrichts an Grundschulen4 statt – vermutlich im Rahmen des sog. herkunftssprachlichen Unterrichts. Sein Status als Ergänzungsunterricht ist grundsätzlich problematisch, da er im deutschen Bildungssystem nach wie vor nur eine marginale Rolle spielt (vgl. Gogolin & Oeter 2011: 40; Küppers & Schroeder 2017). Schwierigkeiten bei der Zertifizierung von erbrachten Leistungen, fehlende Lehrkräfte, ungeklärte Verantwortlichkeiten und Finanzierungsprobleme sowie die Voraussetzung einer bestimmten (sprachlichen, geographischen, ethnischen) Herkunft (vgl. Lengyel & Neumann 2016: 12) verhinderten bisher seine Integration in den regulären Unterricht (vgl. Schroeder 2003: 25ff.; für eine ausführliche Diskussion s. auch Abschnitt 4.4.4).
Debatten über die Funktion, den Nutzen und die Zielsetzungen herkunftssprachlichen Unterrichts werden bisweilen ebenfalls von Sprachprestigemechanismen bestimmt und münden in einem „Kosten-Nutzen-Kalkül“ (Niedrig 2011: 102). Diskutiert wird hier vor allem, ob der Erhalt und die Förderung von allochthonen Minderheitensprachen in der Verantwortung des Staates und somit der Schule lägen. Schließlich stehe diese Forderung im Widerspruch zu der symbolisch-unitarisierenden Funktion einer Nationalsprache als der einzig legitimen Sprache (vgl. Krüger-Potratz 2011: 54). Dies hat zur Folge, dass die meisten Kinder allochthoner Minderheiten in Deutschland im Rahmen von Submersionsmodellen beschult werden, eventuell mit zusätzlichen Förderangeboten in der Mehrheitssprache Deutsch (vgl. Reich & Roth 2002: 20).
Werden herkunftssprachliche Kurse dennoch eingerichtet, so lassen sich je nach Kontext folgende Beweggründe hierfür finden (vgl. Broeder & Extra 1999): Auf der einen Seite steht die Rückkehroption in das Herkunftsland, auf die die Schülerinnen und Schüler durch herkunftssprachlichen Unterricht vorbereitet werden sollen. Die sprachliche Eingliederung in die Mehrheitsgesellschaft ist hier nicht im Fokus. Diese Perspektive wurde in Deutschland vor allem in den 1970er Jahren eingenommen und wird heutzutage zumindest nicht mehr explizit angeführt (vgl. Schroeder & Küppers 2016: 201). Bei einer Bleibeperspektive wird oftmals in einem kompensatorischen Sinne für die Einrichtung herkunftssprachlichen Unterrichts argumentiert. Durch Transfer von in der Minderheitensprache Gelerntem könne die Mehrheitssprache gefestigt werden. Unterricht in der Minderheitensprache wird in diesem Argumentationsansatz durch eine Überbrückungsfunktion bzw. durch einen Ausgleich sprachlicher Defizite bis zu einer Eingliederung in die Regelklasse gerechtfertigt (vgl. Niedrig 2011: 102f.). Diese Modelle stehen nur einigen wenigen wertschätzenden Ansätzen gegenüber, die Pluralität und sprachliche Diversität unterstützen möchten. Sprachprestige durchdringt also über gesellschaftliche Machtordnungen auch die Bildungsinstitutionen, was Auseinandersetzungen über negative Auswirkungen von Spracherhalt auf Bildungserfolg befeuert und die Aufgabe peripherer Sprachen mit einem geringen Kommunikationswert zusätzlich forciert.